Wie besiegen wir die Trägheit?
Rede gehalten am Jahresfeste der Universität Basel
vom Rektor
Professor der Theologie .
Basel. Benno Schwabe, Verlagsbuchhandlung. 1904.Hochansehnliche Versammlung!
Ich heisse die Mitglieder des Regierungsrats und der Erziehungsbehörden, die Kollegen, die studierenden Kommilitonen und alle Freunde und Freundinnen der Universität bei deren Jahresfeste willkommen.
Alter Sitte gemäss soll ich vor Ihnen in dieser Stunde eine wissenschaftliche Frage behandeln und zwar wenn möglich eine solche, die das allgemeine Interesse erwärmen mag. Als Lehrer der Ethik bin ich um den Stoff nicht verlegen; denn die Ethik geht alle an.
Immerhin möchte ich, geleitet durch eine Stelle meines Amtsgelübdes Discentium commoda pro virili promovere contabor" heute mehr als an die ältern an die jüngern, die studierenden Kommilitonen, meine Worte richten: Sprechen wir von dem grössten Feind der Universität und des gelehrten Wesens überhaupt und davon, wie ein junger Mann (und auch ein alter) desselben Herr werden mag.
Über diese Frage spreche ich zwar, wie Sie sehen, ex cathedra, aber ohne Unfehlbarkeitsdünkel und ohne die Absicht, die alten und die spärlichen neuen Gedanken, die ich vortrage, jemand aufzudrängen; ich lade Sie nur freundlich ein, dieselben in Erwägung zu ziehen. Auch spreche ich zu Ihnen nicht wie einer, der selbst jenen Feind in seinen Jugendtagen besiegt hätte und seitdem Sieger geblieben wäre; im Gegenteil, in aller Bescheidenheit als einer, der selbst von jenem Feind viel Schaden
erlitten hat und der nun, zurückblickend, jüngere zu warnen und vielleicht zu leiten in der Lage ist.
Zur Sache. Der Feind, von dem wir reden, heisst Trägheit. Sie ist der grösste und in der Regel der einzige Feind alles Guten und Besten unter der Sonne. Jeder Stand und Beruf hat ja freilich einen widerstrebenden Stoff zu bearbeiten; aber das Misslingen liegt gleichwohl auf jedem Gebiet weit weniger an diesem Widerstand als daran, dass die Menschen unwillig und untüchtig sind, ihre Seele einzusetzen für das, was sie sollen. Dieser Feind jedes Standes ist nun vollends der grösste und in der Regel der einzige ernstliche Feind des Gelehrtenstandes. Studiosus kommt doch von studendo, eifrig streben, sich befleissigen; und den stolzen Namen eines Studiosus führt mit Recht nur derjenige, der seine Seele an die geistige Eroberung irgend eines Bezirks der Wirklichkeit gesetzt hat; Studiosus bleibt bis ins Alter unser schönster Titel, der mehr wiegt als der Doktor aller vier Fakultäten. Der Studiosus zeugt den Doktor, und er zeugt ihn nicht bloss, er muss den Gezeugten stetsfort am Leben erhalten. Der Verfassung eines echten Studiosus entgegengesetzt ist die Verfassung der schlaffen Seele, welche unwillig und untüchtig ist, sich der geistigen Durchdringung, Verarbeitung, Eroberung eines Gegenstandes zuzuwenden; und Trägheit ist ihr Name.
Will man sagen, es gebe neben der Trägheit noch andere ebenso böse Feinde des gelehrten Wesens, so die Streberei, so das Exzedieren in Baccho et Venere, so andres mehr?
Sehn wir zu, wie es sich damit verhält! Die Streberei ist dem Studium, dem echten Streben, ähnlich wie der Lolch dem Weizen. Der Streber weiss die schönen Dinge, die dem echten Studium normalerweise als Früchte beschieden sind, wohl zu schätzen; aber er möchte die Früchte ernten, ohne die entsprechende Arbeit dafür einzusetzen. Streberei ist nicht ein neues,
originales Laster, sie ist nur eine Form der Trägheit. Trägheit, drapiert mit dem Mantel der Arbeitsamkeit, im übrigen aber wirkend mit Augendienerei, Heuchelei, moralischer Rückgratsverkrümmung, mit kleinen Mitteln und Mittelchen, das ist die Streberei.
So ist auch das Exzedieren in Baccho et Venere, wie es, Leib und Seele verwüstend, eventuell das ganze Leben knickend, in akademischen Kreisen vorkommt, kein originales Laster sondern eine Erscheinungsform der Trägheit. Man sehe zu! Die menschliche Seele hat enge Grenzen; es haben in der Helle des Bewusstseins nur wenige Gedanken und Strebungen neben einander Platz. Ist die Seele vom Studiengeist erfüllt, so können keine andern Mächte sie okkupieren. Ist dagegen dieser Studiengeist nicht da, so drängt sich in das Vakuum, damit der Mensch nicht vor Langeweile berste, irgend ein Dämon, der das Lehen ohne ernste Arbeit halbwegs erträglich macht; einer der willfährigsten dieser Dämonen heisst Alkohol. Und ist er erst da und hat die Seele okkupiert, so wäre nun ein doppelt intensiver Arbeitsgeist nötig, ihn wieder auszutreiben. Aber wenn die Energie fehlte, dem Eindringling zu wehren, woher soll die grössere kommen, ihn wieder auszutreiben?
Etwas anders steht es mit dem Geschlechtstrieb. Der drängt sich nicht wie der Alkohol als fremder Dämon in das Vakuum einer unbestellten Seele; er ist in Fleisch und Blut geboren und tritt normalerweise in den Jahren der Pubertät mit Heftigkeit in der Jünglingsseele auf. Aber wenn dieser natürliche Trieb überwuchert, wenn er in diesen Jahren so oder so Leib und Seele knechtet und das Leben verwüstet, so liegt das doch immer daran, dass der betreffende Jüngling zu schlaff, zu träge war, den angemessenen Widerstand zu leisten. Was war zu tun? Wenn dir die Aufgabe gestellt wäre, eine Flasche luftleer zu machen, so würdest du dieselbe vielleicht mit der Luftpumpe in Verbindung setzen. Es ist ein umständliches Verfahren, und luftleer bekommst
du sie so doch nicht; mit aller Anstrengung bringst du es immer nur zur Luftverdünnung. Weit einfacher und sicherer ist das Verfahren, wenn du die Flasche an den Wasserhahn hältst; das schwerere einströmende Wasser treibt die Luft aus. Nicht anders in unserm Fall. Lass Arbeitsgeist in die Seele einströmen, so muss die Begierde weichen; schon körperliche Arbeit leistet das Wunder: Wer ein Gartenbeet umspatet, wer einen Berg ersteigt, wer tüchtig an Reck und Barren arbeitet, wird jedenfalls unterdessen von der Begierde nicht gebändigt; wer vollends intensive geistige Arbeit unternimmt, seine Seele mit allem Fleiss den Erkenntnisobjekten zuwendet, wird unterdessen von jener nicht geknechtet. Es bleibt also dabei: Wo immer die Begierde einen Jüngling zu Schaden bringt, ist es im letzten Grund eine Folge der Trägheit.
So sind weiter der Erscheinungsformen der Trägheit gar viele: So mancher akademische Bürger möchte bei Leibe nicht dafür gelten, träge zu sein; er sitzt am Schreibtisch und liest. Aber was liest er? Einen Roman vielleicht, während er einen Abschnitt im Corpus juris oder im Neuen Testament durcharbeiten sollte. Oder er liest zwar das betreffende Kapitel, aber er liest es obenhin, ohne redlich und tapfer die sprachlichen und andre Hilfsmittel zu Rate zu ziehen; oder er zieht zwar diese Hilfsmittel zu Rate, aber seine Seele ist dabei in der schlaffen Haltung, in der sie sich leicht einen herrschenden Jrrtum suggerieren lässt, während er bei redlicher Anspannung seiner geistigen Kräfte sich der Suggestion erwehren und das Richtige finden könnte. Oder er liest und rezipiert, während er schreiben und produzieren sollte; oder er produziert zwar, hat aber nicht die Energie, das Produzierte in eine gute, andre gewinnende Form zu giessen. Trägheit und immer wieder Trägheit! Nicht nötig, deren kaleidoskopische oder vielmehr kakeidoskopische Vielgestalt erschöpfend zu beschreiben oder auch nur zu skizzieren.
Warum doch, so fragen wir jetzt, ist Fleissigsein eine so schwere und grosse Kunst? Wir akademischen Bürger haben uns doch allzumal einer Erkenntnisaufgabe verschrieben. Warum wird es uns trotzdem so schwer, unsre Seele treu der Erforschung und Eroberung des Gebietes, das wir uns erwählt, zuzuwenden?
Das liegt daran, dass der Mensch eben nicht eine wirkliche Einheit ist. Platon hat mit gutem Grunde drei Seelenteile unterschieden und hat die drei (die Begehrlichkeit, den Mut, die Vernunft) in drei Bezirke des Leibes lokalisiert; und in dem Prachtbild des Phädrus vom Wagenlenker mit dem Zwiegespanne eines schlechten, störrischen und eines im ganzen willigen, edlen Rosses hat er uns eindringlich genug gesagt, wie wenig die Interessen und Strebungen der drei Seelenteile zusammengehen. Omne ensa in suo esse perseverare conatur; die sinnliche Seele will sich ausleben, der Mut auch und desgleichen die Vernunft. Die Vernunft aber kann sich nicht ausleben, ohne den andern Teilen und zumal der Sinnlichkeit Beschränkungen aufzuerlegen; aus den Kollisionen einer innerlich vielgeteilten Natur kommt die Not unsres Lebens, die Schwierigkeit des Ethos. Es ist von Stunde zu Stunde die Frage, ob der oberste Seelenteil sich gegenüber den andern durchsetzen und sie zu seinem Dienste zwingen könne.
Was Platon und ihm folgend andre Philosophen fixiert, ist uns seitdem entwickelungsgeschichtlich etwas verständlicher geworden. Die verschiedenen Seelenteile stammen eben aus verschiedenen Entwickelungsstadien der Menschheit. Es stammt der Mensch von einem niedrigeren Typus ab, in welchem der Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungstrieb in primitivster Form sich darstellte. Von hier aus ging die Entwickelung — gleichviel welches nun der Motor oder die Motoren waren — aufwärts zu der leiblichen und seelischen Gestalt, deren wir mit gar nicht ungemischter Freude uns heute erfreuen; und unsre theoretische
und praktische Vernunft und das ethische Ideal, dem nachzujagen wir uns verpflichtet fühlen, gehören jedenfalls den letzten Stadien unsrer Entwickelung an. Der Drang, die Welt zu erforschen und den Brüdern zu dienen und allen Fleiss an die Vollendung dieses Reichs der Erkenntnis und der Liebe zu setzen, ist relativ späten Ursprungs; das ist Neuland im menschlichen Wesen.
Die Entwickelung ist nun aber in der Menschheit wie anderwärts nicht derart, dass hinter jeder erreichten Etappe die frühern versunken und verschwunden wären; das Frühere lebt vielmehr im Spätern und neben demselben fort. Die Vererbung ist im Leiblichen ausserordentlich zäh; sie ist es ebenso im Seelischen. Es lebt z. B. in mir und will in mir zur Wirklichkeit werden das Ideal des Duldens und Verzeihens, das in der Bergpredigt auf die Formel gebracht ist "dem Bösen nicht widerstehen" . Aber hinter diesem Ideal, dessen Verwirklichung frisch angeschwemmtem Neuland ist, auf das man noch nicht mit Zuversicht bauen kann, steckt in mir das Ideal der talio, der Wille, alles böse Tun der Nebenmenschen entsprechend zu vergelten, den Schlag also mit einem gleich starken Schlag, die Beleidigung mit einem nicht minder wehtuenden Wort. Und hinter diesem Ideal, das in Recht und Moral höchststehender Kulturvölker verfestigt ist, steckt in mir als kräftige Entwickelungsreminiszenz ein noch tiefer liegendes Ideal, nämlich einen Streich mit zehn Streichen und wenn möglich kräftigeren, eine Beleidigung mit einer grössern und wenn möglich mit Blut zu sühnen. Und hinter diesem Racheideal steckt in uns als Entwickelungsreminiszenz noch ein andres, nämlich den Nebenmenschen, der uns nichts zuleid getan, unsre Überlegenheit fühlen zu lassen, ihn so oder so zu vergewaltigen.
Ein andres Beispiel. Es lebt jetzt in mir das Ideal rastlosen Fleisses; ich fühle mich innerlich verpflichtet, meine Stunden auszukaufen und redlich zu wirken, so lange mein Lebenstag
dauert. Ader neben diesem Ideal lebt in mir ein Arbeitsideal mit bescheidenern Ansprüchen, mit ausgiebigen Perioden süssen Nichtstuns. Und dahinter steckt mir in Fleisch und Blut als Entwickelungsreminiszenz noch ein andres Ideal, das Bärenhäuterideal unsrer germanischen Vorfahren, die sich die Jagd, das Spiel und den Trunk reservierten, alle ernste Arbeit aber nach Möglichkeit den Weibern und den Knechten aufhalsten. Und auffallend ist dabei, dass bei der Blüte der Nation, den Studenten, sich leicht der Rückschlag einstellt, dass sie wie die Altvordern am heiligen Werktag auf der Bärenhaut liegen und aus Kuhhörnern Bier trinken, wie bei den nämlichen auch der Atavismus auftritt, dass sie in Sachen der Ehre und Revanche einem Kanon folgen, der vor dreitausend Jahren im deutschen Urwald modern war.
Bei dieser Sachlage ist die Not unsres Lebens, die Schwierigkeit des Ethos leicht begreiflich. Es entstehen in uns Reibungen, ja schwere Konflikte zwischen den früher erworbenen Anlagen und Trieben und den später erworbenen. Wir sirid zu stetigem Fortschritt berufen; aber die höhere Stufe kann sich jeweilen nur unter Kämpfen gegen den abgelagerten Bestand unsres bisherigen Wesens durchsetzen. Und das sittlich Böse besteht doch wohl darin, dass wir aus Trägheit eine niedere Entwicklungsstufe bejahen und festhalten, während eine höhere in uns Gestalt gewinnen will und behauptet werden sollte und könnte. Warum ist es so schwer, ein rechter Studiosus zu sein? Der Wissenstrieb im Menschen ist doch gewiss nicht von gestern her; er hat der Menschheit auf ihrem ganzen Kultursiegesgang geleuchtet; nur von ihm geleitet, konnte sie von der Tierheit aufwärts zu der Höhe klimmen, auf der sie heute steht. Aber ein Wissenstrieb von der Reinheit, Tiefe und Intensität, wie er zum Betrieb und zur Mehrung unsrer Wissenschaft nötig ist, der stetige, zähe, zur Überwindung von tausend Hemmungen und zur Bändigung
einer widerstrebenden Natur nötige Fleiss, ist gewiss eine relativ junge Errungenschaft und derer, denen solch' ein mächtiger Wissenstrieb als Erbe in die Wiege gelegt ist, sind wenige. Sie sind die berufenen Studiosi, denen das Studium zur grossen herrschenden Leidenschaft wird. In andern erkämpft der Erkenntnistrieb die Hegemonie unter grossen Schwierigkeiten, mit viel Niederlagen. In noch andern, die recht zahlreich sind, gewinnt er überhaupt nie die Führung, sondern führt neben stärkern Trieben ein recht bescheidenes, ja prekäres Dasein.
Platon macht in seinem Staat den Hellenen das Kompliment, dass bei ihnen die Wissbegierde überwiege, während bei den Thrakern und den nordischen Barbaren überhaupt der Zornmut prävaliere, bei den Ägyptern und Phöniziern der Erwerbstrieb. Gleichviel nun, wie weit dies Kompliment an seine Volksgenossen begründet sei, wir müssen jedenfalls wünschen, dass die hohen Schulen von solchen bevölkert werden, die jenem hellenischen Typus entsprechen; und wir würden gern den vorbereitenden Anstalten, dem Gymnasium und der Realschule, die Aufgabe zuweisen, dass sie, unerbittliche Selektion übend, keinen über die Schwelle der Maturität springen lassen, der sich nicht darüber ausgewiesen, dass wirklicher Wissenstrieb ihn beseelt. Ich fürchte nur, dass damit diesen Schulen zu viel zugemutet wird; sie entscheiden noch nicht endgültig, ob der junge Mann zu selbständigem Studium taugt; denn in der Schule ist, um beim Bilde des Phädrus zu bleiben, dem Wagenlenker mit dem ungleichen Zwiegespann in Gestalt des Lehrers noch ein spiritus rector beigegeben, der jenem täglich den Willen und die Hände stärkt und ihm mit Zügel und Peitsche die Rosse in Ordnung halten hilft. Fällt aber in der akademischen Freiheit der spiritus rector weg, so zeigt sich nun oft genug, dass der Wagenlenker seiner Aufgabe nicht gewachsen ist; es sieht dann gelegentlich so aus, wie wenn das edlere Ross ihm ausgespannt wäre, während
das schlechte das Gebiss zwischen die Zähne nimmt und den kraftlosen Händen durchgeht.
Man möchte an die Selbstliebe der Jünglinge appellieren, dass sie, von keiner Eitelkeit verführt, sich doch ja nicht für das Studium entscheiden, wenn sie nicht innerlich kräftig dazu berufen sind, und auch nicht von der Eitelkeit der Eltern sich verführen lassen, nach dem hohen Gelehrtenstand zu trachten. Denn der höchste Stand ist für jeden der, zu dem er das Zeug hat. Ein Mensch hätte vielleicht die Gaben und die Energie gehabt, treffliche Kleider oder solide Schuhe zu machen, als Handwerker Holz oder Eisen zu bearbeiten und wäre dabei, im Vollgefühl, eine nützliche Sache recht zu betreiben, des Lebens froh geworden, während er im gelehrten Stand, zu dem die vollen Dispositionen fehlten, ein tiefes Missbehagen lebenslang nicht los wird. — Von einem richtigen Bewusstsein über Vererbung geleitet, suchten sonst Eltern die Kinder in ihrem Stand und Beruf festzuhalten; sie glaubten an erworbene und sich vererbende Anlagen und lebten der Zuversicht, dass der Sohn am besten fahre, wenn er sein Leben auf diese durch eine Reihe von Geschlechtern erworbenen und gefestigten Anlagen aufbaue. Die moderne Welt dagegen ist stark von dem Trug geleitet, dass man aus jedem Holz alles machen könne; und das Unbehagen des gegenwärtigen Geschlechts hängt gewiss u. a. damit zusammen, dass so viele, ohne die Gesetze der Vererbung zu beachten, aus einem Stand zu einem ganz andern überspringen. Der einzelne Mensch findet meines Erachtens nur darin das rechte Lebensbehagen in seinem Beruf, wenn er zu demselben entschiedene, halbwegs fest gewordene Dispositionen mitbrachte. Ich habe gewiss nicht den tollen Mut, zu wünschen, dass Luther und Zwingli und andre Bauernsöhne, die im Lehrstand Grosses geleistet, beim Nährstand möchten geblieben sein. Trotzdem gehört es im allgemeinen zum schwersten, was einem Bauernsohn, dessen Ahnen in zehn aufsteigenden Generationen
weiter nichts als den Acker gebaut, passieren mag, wenn er zur Strafe dafür, dass er das Abc etwas rascher gelernt als seine Kameraden, zum Gelehrtenstand bestimmt wurde. Seine Instinkte gehen in andrer Richtung; sein Leib in nicht darauf eingerichtet, lebenslang am Schreibtisch zu sitzen, seine Hand nicht, Buchstaben zu malen, sein Auge nicht, Lautzeichen zu fixieren, sein Gehirn nicht, ohne Erschöpfung lebenslang der Gelehrtenarbeit obzuliegen, und er bringt es lebenslang kaum fertig, einen Bauer, der in Sonnenschein und Regen über Gottes Erde schreitet, beim Pflügen, Säen, Ernten ohne Neid zu betrachten. Die ererbten Anlagen seines Leibes und feiner Seele muss er zum Teil an die Kette legen; die Gaben aber, die sein neuer Beruf erheischt, muss er zum Teil erst mühsam erwerben; ein Glück, wenn er aus dem Bauernstand wenigstens die zähe Geduld, die vor keinem widerstrebenden Stoff ermattet, mitbringt. Die Übergänge aus einem Stand in einen weit entlegenen andern sollten nicht in einem grossen Sprung sondern in mehrern Schritten allmählich vollzogen werden; und die volle Virtuosität des Könnens und das damit verbundene Lebensbehagen entstehen in der Regel nur dort, wo mehrere aufeinander folgende Geschlechter das nämliche Werk betrieben, die nämlichen Anlagen ausbildeten.
Aber genug nun dieser Gedanken über das, was ist und besser nicht wäre, was nicht ist und eigentlich sein sollte. Werte Kommilitonen, nehmen wir die Dinge nun kühl und gelassen, wie sie sind! Es sind ja wohl wenige unter uns, die mit ihrem leiblichen und geistigen Erbe ganz zufrieden sind. Es sind wenige, bei denen die theoretische und praktische Vernunft schlechthin die Hegemonie hat, also dass das Studium wie eine gewaltige Leidenschaft ihre Seele erfüllt; wenige, deren Leib als immer williger, nie erschöpfter Diener des Geistes sich brauchen lässt. Die meisten haben mit der widerstrebenden Kraft des
natürlichen Menschen und, was schlimmer ist, mit seiner Unkraft zu kämpfen, und fleissig studieren ist für sie eine Kunst. Die Frage ist jetzt: Wie lernen wir diese grosse Kunst? Ist sie überhaupt lernbar?
Ja, meine Herren, sie ist es. Es braucht niemand wegen seiner widerstrebenden Natur zu verzagen.
Wie heisst der grosse Trost? Erwarten Sie keine absonderliche Zauberformel! Wenn der Herr der Welt die für unsre Ernährung nötigen Stoffe in die Erde gelegt hat und uns einladet, dieselben dem Erdboden abzugewinnen, wäre es töricht, die Hände in den Schoss zu legen und Manna vom Himmel zu erwarten. So dürfen wir auch in unsrem Falle kein Wunder erwarten; die Formel des Heils heisst so trivial wie möglich "Gewöhnung" . Wie magst du trotz einer stark widerstrebenden Natur, trotz einem dem Studium ungünstigen Erbe doch ein fröhlicher, glücklicher wissenschaftlicher Arbeiter werden? Aus nichts wird freilich nichts. Etwas von wissenschaftlichem Eros muss als Einsatz in dir sein. Im übrigen aber lautet nun der Rat: Fang nur an! Tu den ersten Schritt! Die erste Viertelstunde aufmerksamen Lesens oder produktiven Schreibens mag dir sehr schwer fallen. Aber wenn du dich bezwingst, wird die Selbstüberwindung in der folgenden Viertelstunde schon leichter sein, und in der dritten und vierten ist die Anstrengung noch kleiner. Ich nehme an, dass du dir als weiser, vorsichtiger Mann, um keine schädliche Übermüdung herbeizuführen, heute nach der einstündigen Anstrengung Ruhe gönnst. Aber wenn du morgen zur Arbeit wiederkehrst, machst du die Erfahrung, dass dir das Anfangen leichter wird als gestern, dass die Fortsetzung unter weniger Anstrengung von statten geht, also dass dir auch eine zweite Stunde des Studiums resp. Schreibens keine unmögliche Zumutung scheint. An den folgenden Tagen nehmen die Widerstände noch mehr ab; die somatische und
psychische Bahn ist geöffnet, das Beharrungsvermögen treibt dich weiter.
Das Beharrungsgesetz gilt für das menschliche Handeln, die moralia und immortalis genau so wie für die physica. "Unsre scheinbar unbedeutendsten Handlungen," sagt Jules Payot in seinem trefflichen Buche ,die Erziehung des Willens', "bilden, ' wenn wir sie nur wiederholen, mit den Wochen, Monaten, Jahren ein ungeheures Kapital, das im organischen Gedächtnis in Gestalt unausrottbarer Gewohnheiten verzeichnet bleibt. Die Zeit, dieser so kostbare Verbündete unsrer Befreiung, arbeitet mit derselben ruhigen Hartnäckigkeit gegen uns, wenn wir sie nicht zwingen, für uns zu arbeiten. Sie nutzt in uns, für oder gegen uns, das herrschende Gesetz der Psychologie, das Gesetz der Gewohnheit aus. Welch kostbaren Verbündeten haben wir da nicht in der Zeit für Handlungen, die wir wollen, und wie gut versteht sie sich darauf, den steinichten Pfad, dessen Betretung uns widerstrebte, flugs in eine schöne breite Strasse umzuwandeln! Sanft tut sie uns Gewalt an, um uns dorthin zu geleiten, wohin wir uns vorgenommen hatten zu gehen, wohin zu gehen unsre Faulheit sich aber weigerte!" So Payot.
Es ist auffallend, dass eine so einfache und handgreifliche Sache nicht klarer ins sittliche Bewusstsein der modernen Menschen gelangt ist. In breiten Schichten unsrer sogenannten christlichen Welt herrscht eine andre Lehre, dahin lautend, all unsre sittlichen Anläufe nützten wenig oder nichts; nach all denselben finde sich der Mensch in der alten sittlichen Gebundenheit; da könne nur eine radikale Neugeburt Wandel schaffen, und diese komme nur zustande durch eine Intervention göttlicher Gnade. Was sagen wir dazu? Antwort: Die angebliche Erfahrung, dass wir mit unsrem sittlichen Bemühen unsre Natur nicht ändern, also beispielsweise unsre Trägheit nicht überwinden können, ist genau analog unsrer andren Erfahrung, dass wir mit
unsres Leides Kraft eine Eiche nicht umreissen können; ob wir heute zerren und morgen und übermorgen, sie steht. Aber etwas andres können wir; ich kann mit Picke und Schaufel um die Eiche graben, kann mit dem Beil Span um Span, eine aufgedeckte Wurzel nach der andern abhauen, endlich fällt die Eiche. So in unsrem Fall; ich kann im gegenwärtigen Augenblick meinen Willen einsetzen, im nächsten wieder u. s. w. , es summiert sich Kleines mit Kleinem und erzeugt wie in der Natur so im Moralischen den grössten Effekt: die Faulheit wird überwunden . Im übrigen verwerfe ich damit die Lehre, dass die Umwandlung unsrer Natur nur durch Intervention der göttlichen Gnade zustande komme, keineswegs; ich suche und finde die Gnade nur in der Gestalt, in der Gott sie wirklich zu offenbaren beliebt. Ich erwarte nicht, dass er mich, den schlechthin Nachlässigen und Unwilligen aus den Ketten befreie; diese Hoffnung lässt jeden im Stich. Darin vielmehr, dass die Zeit meine redlichen Anstrengungen summiert und mit Zins und Zinseszins zu einem gewaltigen Kapital anwachsen lässt, schaue ich Gottes freimachende, ja meine alte Natur umwandelnde Gnade; das ist der wirkliche ordo salutis. In der Zeit wird sein Zorn wie seine Gnade offenbar. Die Tatsache, dass dem Menschen, der sich gehen lässt, eine progressive Schwäche, eine böse Gewohnheit, eine Gebundenheit erwächst, wird vom Apostel Paulus dahin interpretiert, dass Gottes Zorn über solchem Menschen offenbar ist und ihn hingibt in die Knechtschaft. Wer dagegen im gegenwärtigen Augenblick das Mögliche tut, dem lässt Gott diese Anstrengung für den folgenden Augenblick Frucht bringen; und wenn er fortfährt, gibt er ihm zum Lohn des redlichen Wollens von Stunde zu Stunde eine grössere Kraft, ja führt ihn endlich in die volle Freiheit. Das ist Gottes Gnade. Es liegt auf der Hand: Die naturwissenschaftlich-philosophische Theorie vom Werden der schlechten und der guten Gewohnheiten
 und die christliche Lehre vom Offenbarwerden des Zornes Gottes
einerseits, seiner Gnade anderseits, sind nur verschiedene Formulierungen
des nämlichen Gedankens. Das ist so, auch wenn
meine Privatansicht, dass die Zeit nur ein profaner Name für
den heiligen der Gottheit ist, vermutlich auf Ihre Zustimmung
nicht rechnen kann.
und die christliche Lehre vom Offenbarwerden des Zornes Gottes
einerseits, seiner Gnade anderseits, sind nur verschiedene Formulierungen
des nämlichen Gedankens. Das ist so, auch wenn
meine Privatansicht, dass die Zeit nur ein profaner Name für
den heiligen der Gottheit ist, vermutlich auf Ihre Zustimmung
nicht rechnen kann.
Wir verfolgen unsre Frage, wie wir des grössten Feindes, der Trägheit, Herr werden mögen, weiter. Wer erst mit ganzer Seele sich daran gemacht hat, der helfenden Zeit vertrauend sich die gute Gewohnheit fleissigen Arbeitens zu erringen, hat die Hauptsache getan. Aber es erwachsen ihm aus dieser Hauptsache eine Fülle von Einzelpflichten, die zu beschreiben meine heutige Aufgabe überschreitet.
Nur das meines Erachtens Wichtigste: Der Mensch ist nicht in geistiges perpetuum mobile, leider nicht. Die Sache wäre so schön, wenn ich im glücklichen Vollgefühl eines wachsenden Kraftkapitals in infinitum fortfahren könnte, — wenn ich, der mich ach oben führenden vis inertiae gehorsam, mich könnte vorwärts treiben lassen von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg, in die volle Freiheit. Zufällig tritt aber nach wenig Stunden die Ermüdung ein, es werden Ausspannung und Schlaf nötig, und dies Intervall ist für unsern Fortschritt gefährlich; es bleibt die Frage, ob ich morgen nach Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit dort anfange, wo ich heute geblieben. Zur Überwindung dieser Gefahr nun gilt das Gesetz, dass wir die isolierten Tage über die Intervalle hinweg aneinanderbinden müssen. Konkret gesagt: Du sollst dich keinen Tag zur Ruhe legen, ohne das Pensum des kommenden Tages fixiert und die Stunde des Anfangens bestimmt zu haben. Es soll am Morgen nicht eine Sache des Deliberierens sein, ob man überhaupt arbeit wann man anfangen, und was man angreifen wolle. Das Dass, das Mann, das Was müssen durch die gestrige Entschliessung bestimmt
sein. So kommen wir mit weniger Gefahr über die Erholungspausen hinweg; wir verbinden durch die zum kommenden Tag übergreifenden Entschliessungen die einzelnen getrennten Arbeitstage sozusagen zu einem Kontinuum.
Sind wir so weit, dass wir nächst der Generalregel die soeben beschriebene Ordnung befolgen, so gilt es nun in der einzelnen Arbeitsstunde die Faulheit, die sich unter hundert Formen und Verkleidungen einnisten will, auszumerzen; z. B. das Erforschen eines Kapitels, ja eines einzigen Verses des Matthäusevangeliums erfordert hundert verschiedene Anstrengungen; der alte Adam möchte sich davon einiges z. B. das Vergleichen der andern Evangelien, das Nachschlagen alttestamentlicher Stellen, die Benutzung des Wörterbuchs und andrer Hilfsmittel schenken. Da gilt es denn nach der Hauptregel die gute Gewohnheit des gründlichen Arbeitens sich zu erwerben und immer völliger auszubilden und so den alten faulen Adam aus all seinen Schlupfwinkeln auszutreiben.
Ist ein junger Mann damit, dass er die Gewohnheit fleissigen Arbeitens errungen, jedes heute dem morgen durch feste Entschliessung verkettet und in der einzelnen Arbeitsstunde gründliche Arbeit macht, nun nicht jeder Gefahr entgangen? Keineswegs. Es ist gewiss hocherfreulich, wenn der geistige Mensch den sarkischen (das Tier in uns) besiegt und zu völligem Gehorsam genötigt hat. Aber wenn seine ganze Kunst damit erschöpft ist, kann das Ende leicht schlimmer werden, als der Anfang war. Das wussten wir längst, dass ein mutiger Mann mit Kraft und Klugheit ein wildes und widerspenstiges Pferd zähmen, zu jeder Gangart und ausdauerndem Lauf zwingen kann; aber wenn er stundenlang zureitet, so wird er demnächst nicht ein gezähmtes, sondern ein totes Pferd haben. So in unsrem Fall. Der alte Adam muss zum Dienen erzogen werden; von einem Diener aber wünschen wir, dass er gesund und kräftig
sei. Der geistig Mensch soll den natürlichen zur Arbeit willig, aber ja nicht schwach und krank machen; von dieser Gefahr ein Wort:
Es ist eine schöne Sache, wenn ein von Haus aus träger Mensch durch Selbstzucht ordentlich in Gang gekommen ist; aber wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Augenblick geistiger Tätigkeit Nervenkraft verbraucht; wie immer der Zusammenhang zwischen Leib und Seele sei, es muss jeder geistige Akt durch Stoffumsatz ausgelöst, mit Blut bestritten werden. Studieren bedeutet in leiblicher Hinsicht ein stetes Tröpfeln von Blut. Wenn nun für dies wegtröpfelnde Blut nicht Ersatz geschafft, die verbrauchte Nervenkraft nicht erneuert wird, kommt Ermattung, im schlimmern Fall Erschöpfung, zustande, um so leichter, wenn der Aufbau eines noch nicht ausgewachsenen Leibes auch Blut fordert, und weil das Studium in ungünstiger Körperhaltung und in Stubenluft vor sich zu gehen pflegt. Unter diesen Umständen kann angestrengter Fleiss zum Verderben werden.
Was tun? Der studierende Mensch muss der Gefahr begegnen, indem er isst und trinkt, gut isst und trinkt. Was heisst gut essen und trinken? Es ist sehr charakteristisch, dass auf der Höhe unsrer vielberühmten Kultur die Diskussion über die Elementarfrage "Was sollen wir essen und trinken? was frommt uns?" so intensiv entbrannt ist. Warum die Diskussion? Weil wir uns schlecht befinden, weil, von andrem zu schweigen, die Neurasthenie, zu deutsch Erschöpfung, eine Kalamität der ganzen Kulturmenschheit und jedenfalls der geistigen Arbeiter zu werden droht. Woher kommt uns die Plage? Die herrschende Meinung geht dahin, dass wir den Anforderungen unsrer Kultur erliegen. Das moderne Leben sei so ruhelos, der Kampf ums Dasein so hart, die Eindrücke, die auf uns eindringen, seien so vielfältig geworden, dass unsre Kraft dem allem nicht gewachsen sei. Diese Auslegung des Tatbestandes ist sehr niederdrückend.
Wenn wir den Anforderungen der Kultur erliegen, ist uns nicht zu helfen; dann gehen wir zugrunde. Aber es ist nicht gesagt, dass diese Auslegung wahr ist, auch wenn sie einer dem andern nachsagt und nachschreibt. Ich bin versucht, schon die Prämissen zu bestreiten. Es ist nicht wahr, dass die moderne Menschheit so ruhelos von Arbeit gehetzt ist. Zeigen doch unsre Bierhallen und andre Örter ausgiebige Oasen der Ausspannung und Ruhe; und die Frauen mindestens der obern Zehntausend leiden nicht an Überarbeitung und sind doch vielfach neurasthenisch. Ich mag's auch nicht glauben, dass der Kampf um das Notwendige grimmiger, die Sorge, zu darben und zu verhungern, gegenüber frühern Tagen grösser geworden sei. Die Geschichte zeigt, dass frühere Geschlechter sich im allgemeinen in prekärerer Lage befanden, dass sie öfter mit dem Hunger Bekanntschaft machten und von teurer Zeit heimgesucht wurden, dass sie Jahrzehnte hindurch den Krieg mit all seinen Mühsalen und Schrecken und aller Unsicherheit des Lebens erduldeten und doch nicht neurasthenisch wurden. Und an der Fülle der auf uns einstürmenden Eindrücke geht der Mensch schwerlich zugrunde; wir haben eine ziemlich dicke Haut, und die Segnungen der Kultur überwältigen uns nicht. So wenig der Führer eines Tramwagens sich am Wunder der Elektrizität überstudiert, so wenig der Durchschnittsrnensch an den Wundern materieller und geistiger Kultur — und ist doch neurasthenisch.
Es gibt eine zweite Auslegung des Tatbestandes, die jedenfalls das Verdienst hat, uns nicht pessimistisch zu stimmen; denn sie lautet dahin, dass die Misere nicht eine notwendige Folge unsrer Kultur ist, sondern an Dingen liegt, die wir meiden können. Wir sagen uns: Auch Griechenland und Rom haben vordem eine hohe Kultur gesehen; auch das Zeitalter der Renaissance und der Reformation zeigte ein intensives Studium und eine so hochgradige Erregung der Geister, wie sie im 19. Jahrhundert
kaum erreicht wurde; und dazu tranken die Kulturvölker des Altertums und der Renaissance aus dem Becher der Freude nicht eben mässig, und bei alledem litten sie nicht auffallend an Erschöpfungs- und Depressionszuständen. Warum nicht:? Es ist ein wissenschaftlich erlaubtes Vorgehen, in den Dingen, die wir im Unterschied von jenen in unsern Leib einführen, die Störefriede zu vermuten. Im Verdacht stehen Koffein, Tein, Nikotin, Alkohol, vier Brüder, von denen nur der letzte den Zeitgenossen Platons, Luthers, Newtons seine Liebesdienste leistete. Der Chemiker und Physiologe wagt sie etwa Gifte zu nennen. Aber es gibt unzählige Kulturmenschen, die skrupellos unter den 3 x 365 Mahlzeiten des Jahres kaum eine einnehmen, ohne einen oder zwei oder drei jener verdächtigen Stoffe miteinzuführen. Da bekommt jede Blutzelle, ja es bekommt jeder der Milliarden Bürger unsres Zellenstaats seine Dosis Koffein, Nikotin u. s. w. Dass damit der Lebensstrom unsres Blutes zu all seinen Leistungen tüchtiger wird, die sämtlichen Zellen in ihren Funktionen ungestört bleiben, mag "der Böse" glauben.
Aber nötigt uns nicht unser Rückblick auf frühere Kulturepochen, die Anklage wenigstens gegen den vierten, den Alcohol, fallen zu lassen? Doch wohl nicht. Wenn frühere Kulturvölker von vieren den einen ertrugen, ohne daran zugrunde zu gehen, so ist damit dessen Unschädlichkeit noch nicht erwiesen; ja hier brauchen wir gar nicht erst von blossen Verdachtsgrüden zu reden. Dass reichlicher Alkoholgenuss die Gesundheit der Völker schädigt, die leibliche und geistige Leistungsfähigkeit der einzelnen herabsetzt und namentlich der Jugend gefährlich ist, ist so klar erwiesen, dass ich mir in dieser erlauchten Versammlung jedes weitere Wort darüber ersparen kann. Dazu ist zwischen dem Alkoholkonsum jener frühern Kulturvölker und dem der Gegenwart ein namhafter Unterschied. Die alten Deutschen und Schweizer nahmen bekanntlich immer noch einen, eh ' sie gingen;
aber sie hatten doch eine Tugend, sie tranken nie mehr, als zur Verfügung stand. Die Produktion war beschränkt, der Import schwierig. Seitdem ader die moderne Technik das Bier in Strömen produziert, seitdem diese Technik aus Rüben, aus Holz und nun glücklicherweise auch aus Exkrementen Alkohol zu produzieren weiss, ergiesst sich davon ein breiter Strom über alles Volk. Während früher die Schicht der obern Zehntausend, die reichlich tranken und etwan in Wein und Bier ertranken, sich aus dem relativ nüchternen Volk erneuern konnte, fehlt jetzt dies nüchterne Volk und damit die Möglichkeit der Erneuerung.
Aber mit welchem Recht mag man Kaffee und Tee anklagen? Deren wohltätige Wirkung gibt sich ja doch unmittelbar zu fühlen. Während der Alkohol fühlbar unsre geistige Leistungsfähigkeit, exaktes Denken, korrektes Produzieren und Reproduzieren herabsetzt, wird unsre Leistungsfähigkeit durch Tee und Kaffee (und in gewissem Sinn auch durch die Zigarre) allemal erhöht; sie helfen uns die Schwere und Trägheit überwinden, erweisen sich also augenscheinlich als Gehilfen unsrer Arbeit. Ich sage: Gerade darin werden sie als gefährliche Freunde offenbar. Denn sie, die keine Nahrungsmittel sind, bestreiten die erhöhte Leistung nicht selber, sie bestreiten dieselben aus einem fremden Fonds und führen möglicherweise zur Erschöpfung desselben. Ja, hier wird ihre angebliche Harmlosigkeit vor dem Alkohol zuschanden. Wer Alkohol in seinen Leib einführt, hat ein Alkoholgegner gesagt, tut wie einer, der in einem Fabriketablissement die Lichter auslöscht. Gut! Ich akzeptiere das Bild: Wer Lichter auslöscht, spart Öl und gibt den Arbeiterinnen Feierabend. Wenn etwa der Alkohol, mässig genossen, den Arbeiterinnen in unsrem Gehirn, den Ganglien, Feierabend und Ausspannung gibt, wollen wir sein relatives Recht anerkennen. Wer dagegen Kaffee und Tee geniesst, schraubt den Docht in die Höhe und facht die Flamme stärker an; er braucht mehr Öl, vielleicht das Ol, das
 er morgen nötig hätte. Unser Leib ist mit reichlichen Kraftakkumulatoren
ausgestattet; wie dieselben beschaffen sind, mögen
die Herren Physiologen ausmachen. Aber das wissen wir, dass
glückliches Menschenleben nur möglich ist, wenn diese Akkumulatoren
geladen sind, wenn wir als wohlsituierte Kapitalisten
aus einem Überfluss vorhandener Kraft den Anforderungen des
Tages genügen können. Kaffee und Tee nun fördern freilich
heute unsre geistige Arbeit. Aber wie? Es sind ausgezeichnete
Mittel, jene Akkumulatoren zu entladen und so das Zustandekommen
eines Kapitals von Spannkräften zu hindern. Der
Kaffee- und Teetrinker zieht Wechsel auf morgen und bleibt
immer ein armer Mann. Hinc illae lacrimae, das Leidwesen
vieler Neurastheniker, wobei die Störung der Verdauung durch
das viele warme Getränk und das Wegspülen der noch nicht
völlig verdauten und ausgenutzten Speise zumal durch den starkgebrannten
Kaffee noch nicht einmal in Rechnung gebracht ist.
Beim Wucherer Geld zu leihen, gilt nicht als übermässig klug;
man lebt zwar von dem Geld heute ganz nett; aber das Zurückzahlen
von Kapital und Zinsen in den kommenden Tagen ist
weniger angenehm. Der Kaffeetrinker borgt beim Wucherer.
Gewiss, wenn ich schläfrig und träge bin, wenn das Herz müde
ist und darum das Gehirn ungenügend mit Blut versieht, wenn
infolgedessen meine Gedankenentwickelung matt von statten geht,
wird freilich der Kaffee helfen, wie die Peitsche der Gangart
eines trägen oder müden Pferdes aufhilft. Aber wer ein müden
Tier heute mit der Peitsche vorwärtstreibt, wird morgen und
übermorgen noch kräftiger peitschen müssen und hat bald einen
ganz erschöpften Gaul. Welch bedenkliche Zustände fortgesetzter
resp. zunehmender Kaffeegenuss herbeiführt, lehrt manch ein
Geistesmensch, vor andern Voltaire; wie bitter, gallig, moros war
der alte Mann bei seiner Kaffeetasse! Und manch ein andrer
musste das Getränk lassen, wenn seine geistige Produktion nicht
er morgen nötig hätte. Unser Leib ist mit reichlichen Kraftakkumulatoren
ausgestattet; wie dieselben beschaffen sind, mögen
die Herren Physiologen ausmachen. Aber das wissen wir, dass
glückliches Menschenleben nur möglich ist, wenn diese Akkumulatoren
geladen sind, wenn wir als wohlsituierte Kapitalisten
aus einem Überfluss vorhandener Kraft den Anforderungen des
Tages genügen können. Kaffee und Tee nun fördern freilich
heute unsre geistige Arbeit. Aber wie? Es sind ausgezeichnete
Mittel, jene Akkumulatoren zu entladen und so das Zustandekommen
eines Kapitals von Spannkräften zu hindern. Der
Kaffee- und Teetrinker zieht Wechsel auf morgen und bleibt
immer ein armer Mann. Hinc illae lacrimae, das Leidwesen
vieler Neurastheniker, wobei die Störung der Verdauung durch
das viele warme Getränk und das Wegspülen der noch nicht
völlig verdauten und ausgenutzten Speise zumal durch den starkgebrannten
Kaffee noch nicht einmal in Rechnung gebracht ist.
Beim Wucherer Geld zu leihen, gilt nicht als übermässig klug;
man lebt zwar von dem Geld heute ganz nett; aber das Zurückzahlen
von Kapital und Zinsen in den kommenden Tagen ist
weniger angenehm. Der Kaffeetrinker borgt beim Wucherer.
Gewiss, wenn ich schläfrig und träge bin, wenn das Herz müde
ist und darum das Gehirn ungenügend mit Blut versieht, wenn
infolgedessen meine Gedankenentwickelung matt von statten geht,
wird freilich der Kaffee helfen, wie die Peitsche der Gangart
eines trägen oder müden Pferdes aufhilft. Aber wer ein müden
Tier heute mit der Peitsche vorwärtstreibt, wird morgen und
übermorgen noch kräftiger peitschen müssen und hat bald einen
ganz erschöpften Gaul. Welch bedenkliche Zustände fortgesetzter
resp. zunehmender Kaffeegenuss herbeiführt, lehrt manch ein
Geistesmensch, vor andern Voltaire; wie bitter, gallig, moros war
der alte Mann bei seiner Kaffeetasse! Und manch ein andrer
musste das Getränk lassen, wenn seine geistige Produktion nicht
zur Essigfabrik werden sollte. Goethe z. B. merkte noch zu rechter seit die Gefahr und entzog sich derselben; er, der seine Flasche Wein und gelegentlich auch zwei vertrug und dabei ein vollgewichtiger Geistesmensch blieb, merkte, dass ihm Kaffee und auch schon Tee nicht bekamen, und dass er, um leistungsfähig und bei Stimmung zu bleiben, ihrer entraten müsse; er war höflich genug, das Getränk den Gästen, die sein begehrten, reichen zu lassen er selbst hütete sich davor. In welchem Jahr er die Gefahr merkte, weiss ich nicht zu sagen; vermutlich kam ihm die Ahnung des Richtigen schon früh. Oder ist es ganz zufällig, dass er uns den willenskranken Werther wiederholt bei der Kaffeetasse zeigt?
Neurastheniker merken einige Stunden nach dem Genuss guten Kaffees, dass eine mutlose Stimmung über sie kommt. Das merken die relativ Gesunden freilich nicht; aber die Wirkung kann doch auch bei ihnen nicht gleich Null sein. Vielleicht werden die für sich unmessbaren, addierten Wirkungen in der Gesamtstimmung und dem Lebensgefühl der modernen Menschheit offenbar. Welches ist das auffallendste Defizit der modernen Menschen? Freude fehlt ihnen, die lieblichste der Himmelstochter, die Mutter so vieler guter Dinge. Menschen fehlen uns, die inmitten schwerer Arbeit jauchzen und singen und lachen und von Herzen Gott danken können. Stete Fröhlichkeit ist aber nur möglich bei gesundem Blut und einem Überschuss akkumulierter Nervenkraft. Wenn nun unser schwarzes Nationalgetränk diesen Überschuss nicht zustande kommen lässt, dann ist doch wohl der allgemeine Tiefstand des Lebensgefühls damit im Zusammenhang. Jedenfalls geht mein Rat dahin, daß Studierende, welche viel arbeiten und bei viel Arbeit stark und fröhlich bleiben wollen, sich des schwarzen Gehilfen und auch des blonden Bruders, der heute als der relativ ungefährliche gepriesen wird, sich recht wenig bedienen.
Tabakrauchen gibt dem fleissigen, ernsten Arbeiter für eine. Stunde Ablenkung und Ausspannung; wäre dies das Ganze, so wäre Tabakrauchen schlechthin zu empfehlen. Aber der Tabak gibt nun leider dem, der an fleissige Arbeit noch nicht gewöhnt ist, die Möglichkeit, Stunden, ja Tage, allenfalls auch ohne Arbeit hinzubringen; er dient ihm nicht zu heilsamer Ausspannung, sondern als Ersatz der Arbeit. Überdies ist die Wirkung des Rauchens auf Magen, Herz, Gehirn ungünstig.
Wie man essen soll, um zu geistiger Arbeit recht tüchtig zu sein und zu bleiben, darüber sind die Gelehrten, wie noch über einige andere Dinge, nicht einig. Ich will nur eins berühren: Frühere Kulturvölker, und jedenfalls die südlichen und die Orientalen, genossen Fleisch als bescheidene Zukost zu Vegetabilien; modernen Kulturvölkern ist es zur Hauptnahrung geworden. Dass uns das auf die Dauer frommt, gilt heute nicht mehr als ausgemacht. Das Beefsteakevangelium, das von deri Fachleuten bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts verkündigt wurde, hat heute bedeutend an Kredit verloren. Ob Gebiss und Darm des Menschen uns mehr den Frugivoren oder den Karnivoren oder den Omnivoren angliedern, mögen die Anatomen ausmachen. Schon ausgemacht aber scheint, dass überwiegende Fleischnahrung nicht jenes kraftvolle Blut liefert, welches die grössten Leistungen von Leib und Seele ermöglicht, und dem Magen auf die Dauer nicht frommt. Bewiesen ist, dass Vegetarier in Kraftleistungen wie im Dauerlauf ceteris paribus die Fleischesser immer zuschanden machen. Geistige Leistungen aber sind von den leiblichen weit weniger verschieden, als man gewöhnlich annimmt; es ist von vorneherein wahrscheinlich, dass die Ernährung, welche durch Bildung eines kräftigen Blutes die höchsten Leistungen des Leibes ermöglicht, auch den geistigen zuträglich ist. Unter uns sind noch viel zu wenig geistige Arbeiter, welche das Experiment gemacht haben; in England sind ihrer mehr, und ich habe begeisterte
Zeugnisse gelesen über den Zuwachs an geistiger Leistungsfähigkeit bei vegetarischer Diät. Zu denken geben auch Tolstoi und William Booth; es sind ja zwei wunderliche Heilige, aber grosse Arbeiter sind sie immerhin dass jeder der beiden Vegetarier im achten Jahrzehnt seines Lebens eine nicht ganz kleine Welt bewegt, ist gewiss. Was bewegen denn die meisten der Fleischesser in ihrem achten Jahrzehnt?
Werte Kommilitonen! Es gab seinerzeit und gibt wohl heute noch Schüler- und Studentenpensionen nach folgendem Zuschnitt. Das Frühstück: Kaffee, Milch und Brot. Das Mittagsmahl: Suppe, Ochsenfleisch von mehr oder weniger alten Kühen, sechsmal gesotten, einmal gebraten, dazu Brot und Gemüse. Um 4 Uhr: Kaffee, Brot und Milch, der Kaffee wenn möglich ordentlich schwarz gebrannt, damit er auch als laxans wirkt, was bei der üppigen Kost selbstverständlich von grossem Vorteil ist. Abends: Suppe (im schlimmern Fall Tee), Brot, Wurst. Dass der Mensch nach einer alten Ordnung essen soll von allen Bäumen des Erdgartens (einen ausgenommen), ist in diesen Pensionen, auch wenn sie etwan christlich heissen, fast ganz vergessen. Der junge Mann, der, statt sich an diesen Tischen zu laben, gutes Brot und Milch, Mehlspeisen, Gemüse und reichlich Obst, dazu wie unsre Väter zwei-, drei-, viermal die Woche, meinethalb auch siebenmal, aber nicht vierzehnmal eine Portion Fleisch geniesst, wird besser fahren. Wenn er dazu je und je (nur nicht täglich) zur Ausspannung von der geistigen Arbeit, zur Erquickung nach Märschen, bei Sang und Klang im Freundeskreise sich ein Glas Wein oder Bier gönnt, wird ihm das nicht schaden, auch nicht, wenn das Glas nochmals gefüllt wird. Kaffee und Tee aber wird er am besten den alten Herren mit fünfzig und mehr akademischen Semestern überlassen, deren Leibesmaschine je und je ein solches Stimulans bedürfen mag.
Immer unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsdiät bespreche
 ich nun in grosser Kürze ein paar weitere Angelegenheiten, nämlich
die sexuelle Frage, Schlaf und Erholung, das Geld, das.
V Vereinsleben.
ich nun in grosser Kürze ein paar weitere Angelegenheiten, nämlich
die sexuelle Frage, Schlaf und Erholung, das Geld, das.
V Vereinsleben.
Den Geschlechtsartikel zuerst. Weise sein in den Jahren der Jugend, wo jede Ader nach Vergnügen lechzt, — die gefährlichste Strecke unsres Lebensweges zurückzulegen, ohne böse Beulen und Flecken davonzutragen, ist Gnade von Gott; aber Gott ist wirklich gnädig allen, die sich wollen helfen lassen. — Recht hat zunächst das Dichterwort "Qui studet optatam cursu contingere metam, multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit abstinuit Venere et vino". Der Dienst der Sophia und der Venus vertragen sich schlecht zusammen. Körperlich sich entwickeln und dabei intensiv geistig arbeiten und zugleich in Venere exzedieren, sind vereint drei ungebührliche Zumutungen an die Natur; der Schaden bleibt nicht aus, auch wenn das vierte, die Gefahr einer Infektion, vermieden wird. Die Physiologie lehrt, dass geistige Arbeit und sexuelle Leistung aus dem nämlichen Kraftfonds des Leibes bestritten werden. Viele junge Leute hüten sich freilich mit grosser Klugheit, die Kerze an beiden Enden anzuzünden; sie zünden sie nur an einem Ende an, aber leider am unrichtigen. Sie studieren nicht ernstlich, aber sie laufen den Weibern nach. Noch bösere Wege seht der andre, der solitäre Wollust sucht; er wird zwar seinen Leib nicht infizieren, aber seine Seele infiziert er mit dem Makel der Unnatur und der Feigheit; er hat eine Schmach zu verbergen und wird voraussichtlich zeitlebens etwas zu verbergen haben; sein Charakter erleidet einen bleibenden Schaden; er wird nicht der mutige und ausdauernde, nicht der sonnige und fröhliche, nicht der aufrechte und zum Siegen berufene Mann werden, den der Schöpfer eigentlich aus ihm machen wollte.
Drum sag ' ich jedem Jüngling: Widersteh' der Lüsternheit lerne warten! Du sollst ja von allem haben. Reichliche, goldene,
saftige Früchte sind vom Schöpfer dir zugedacht. Wer wird so unklug sein, die Früchte unreif herunterzuschütteln? Alles vorzeitige, lüsterne Naschen verdirbt hundertfache dir zugedachte Freude. Willst du verarmt auf der Höhe des Lebens ankommen und dann eine Ehe schliessen, ohne dich recht freuen zu können und ohne Freude zu machen?
Arbeite, und wenn die Arbeit allein nicht hilft, den Dämon aus der Seele zu bannen, so ruf noch zu Hilfe, was dir gross und heilig ist! Sag' dir zumal: Dieser junge Leib gehört nicht mir sondern dem zukünftigen Weib meiner Wahl; ihr will ich ihn bewahren ohne Makel und Schaden. Mein Leib gehört nicht mir sondern meinen zukünftigen Kindern; ich will nicht meine Kraft vergeuden und sie hernach mit allen Spuren leiblicher und geistiger Minderwertigkeit ins Leben einführen. Vor allein: Ruf Gott zu Hilfe! Schon die Gegenwart eines würdigen Mannes, einer edlen Frau bewahrt dich vor dem Bösen. Wer aber weiss "der heilige Gott ist gegenwärtig, sieht alles, hört alles, weiss alles, und schreibt mir alles, was ich denke und tue, ins Buch des Lebens oder des Todes", hat daran eine noch weit kräftigere Bewahrung. Wir sind sittlich so ohnmächtig, weil das Bewusstsein der göttlichen Allgegenwart uns nicht wirklich erfüllt. Das Bewusstsein "Gott ist gegenwärtig und hilft den Willigen" muss als eine fixe Idee in der Helle unsres Bewusstseins stehen. Dann ist uns geholfen.
Sprechen wir vom Schlaf und der rechten Erholung! Wie lange soll der geistige Arbeiter und zumal der jugendliche schlafen? Er soll genug schlafen, soll ausschlafen; nur dann wird seine Arbeitsleistung vollwertig werden. Wann schlafen? In der Nacht und nicht am Tage. Es ist kaum klug zu nennen, wenn Studenten und andre Leute dei Lampenlicht arbeiten und hernach bei Sonnenlicht schlafen. Ohnehin sind die bei Lampenlicht ausgeheckten Gedanken oft derart, dass sie das Sonnenlicht nicht recht vertragen können.
Die Zeit neben dem Schlafen und Essen können wir nicht mit kontinuierlicher Geistesarbeit ausfüllen. Wir haben daneben Allotria nötig. Wichtig aber ist nun, dass wir diese Allotria so wählen, wie sie wirklich unsrer Erholung dienen, damit wir wirklich gestärkt und nicht vollends ermüdet an den Schreibtisch wiederkehren. Erster Rat: Weil wir beim Lesen und Schreiben in der Regel etwas vornübergebeugt sind, wodurch die Brust und damit die Sauerstoffaufnahme etwas gehemmt ist, und weil diese unvollkommene Atmung zudem in Stubenluft vor sich geht, so haben wir die Erholung so viel wie möglich im Freien zu suchen. Den Sitz am Schreibtisch mit dem Sitz am Biertisch, das Atmen der Hörsaalluft mit dem Atmen der Wirtshausluft zu vertauschen, kann wenig frommen. Der zweite Rat: Weil beim Studieren die meisten unsrer Muskeln zur Untätigkeit verurteilt sirid, empfiehlt sich zur Erholung eine recht vielseitige Betätigung der Muskeln, also Marschieren, Laufen, Turnen, Fechten, Schwimmen, Reiten, nicht zu vergessen Holzhacken und Gartenarbeit. Nicht dass wir wähnen durften, intensive geistige Tätigkeit durch intensive Muskeltätigkeit zu kompensieren; das würde vollends ermüden. Aber die Muskeltätigkeit, mit Mass und Verstand betrieben, bringt den Stoffumsatz in Ordnung, hilft die Schlacken ausscheiden, erhöht das Kraftgefühl, schafft dem Zentralnervensystem Ablenkung und Entlastung und kommt so schliesslich der geistigen Arbeit doch zugut. Es ist fast unverantwortlich, dass deutsche Studenten im allgemeinen so wenig tun, ihren Leib tüchtig zu erhalten und tüchtig zu machen. Der dritte Rat lautet: Härte dich ab! Wenn die Studenten erst so fleissig, wie sie sonst den Leib von innen mit Bier behandelten, ihn von aussen mit kaltem Wasser behandeln, wird ihr Wohlbefinden und damit ihre Arbeitsfreudigkeit und Leistungsfähigkeit erheblich wachsen.
Sprechen wir vom Geld! Es ist unter den Erfahrenen
ausgemacht, dass es frommt, Geldsachen nie nachlässig und leichtsinnig zu behandeln. Es wird gut sein, wenn der Student diese Lebensweisheit früh lernt. Wenn ein philiströser Sorgengeist ihm schlecht stünde, so wird doch die kluge Ökonomie und Providenz seinen Studentencharakter nicht verunzieren. Es ist ein grosser Gewinnst, wenn er es durch Wirtschaftlichkeit dahin bringt, dass seine Studien nicht durch Nahrungssorgen gehemmt und verdüstert werden und ein zweiter, wenn er sich neben Brot und Kleid immer die nötigen Lehrbücher und sonstigen Hilfsmittel anschaffen kann.
Sprechen wir unter dem Gesichtspunkt der Arbeit vom Vereinsleben! Frommt es dem Studiosus, einem Verein beizutreten? Das lässt sich nicht generell entscheiden. Es kommt auf sein Naturell an und auf die Natur der Vereine. Es gibt, wenn ich recht sehe, zweierlei Studentenvereine, solche, die es dem einzelnen möglich machen, die Zeit ohne ernste Arbeit "mit wenig Witz und viel Behagen" hinzubringen, unb andre, welche die einzelnen zu allem Guten, also in erster Linie zur Arbeit ermuntern. In Basel gibt's selbstverständlich nur von der zweiten Art, und es ist überflüssig, vor der erstern zu warnen; also spreche ich hier nur zum Fenster hinaus für andre hohe Schulen, welche nicht unsträflich sind wie wir: Vor der ersten Art soll ein Student, der sein Leben lieb hat, sich hüten wie vor der Pest, ebenso vor einzelnen Kommilitonen, die sich gern Freunde nennen lassen, aber uns tatsächlich nur brauchen, um mit unsrer Hilfe die Zeit erträglich totzuschlagen. Gut sind die Vereine, deren Korpsgeist jeden einzelnen in seiner Individualität gewähren lässt und ihm nicht Kanten und Ecken abschleift, dagegen jede Individualität zum höchsten Streben, zu gewissenhafter Arbeit ermuntert. Gut sind die Vereine, welche statt der atavistischen Moral, die das Faulenzen am heiligen Werktag, das Vergeuden des vom Fleiss der Eltern erworbenen Geldes, das Kneipleben
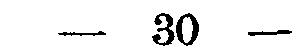 und dazu vorsündflutliche Ehr- und Revanchegedanken begünstigt,
die gemeine Moral hochhalten und in der gemeinen Moral die
nichtakademische Jugend zu übertreffen suchen. Gut sind vornehmlich
die Studentenvereine, welche dem einzelnen die heilsame
Ausspannung und Erholung schaffen, die ihn also weniger zu
Sitzungen einladen, als zu Märschen, Spielen, Körperübungen
in Luft und Sonnenschein und allenfalls in Regen und Schneegestöber.
Da wäre von den englischen Studenten einiges zu
lernen.
und dazu vorsündflutliche Ehr- und Revanchegedanken begünstigt,
die gemeine Moral hochhalten und in der gemeinen Moral die
nichtakademische Jugend zu übertreffen suchen. Gut sind vornehmlich
die Studentenvereine, welche dem einzelnen die heilsame
Ausspannung und Erholung schaffen, die ihn also weniger zu
Sitzungen einladen, als zu Märschen, Spielen, Körperübungen
in Luft und Sonnenschein und allenfalls in Regen und Schneegestöber.
Da wäre von den englischen Studenten einiges zu
lernen.
Studentenvereine pflegen allerlei hohe Parolen wie Freiheit, Vaterland, Freundschaft, Wissenschaft, Gott auf ihre Fahnen zu schreiben; einige haben sogar die sanche christliche Moral zu ihrem Prinzip gemacht. Wohl ihnen, wenn sie es ernst meinen. Ich ersehne den Verein, der statt all jener höchsten Worte das schlichte Wort "Arbeit" auf seine Fahne schreibt. Wer arbeitet, das heisst seine Freiheit erkämpft gegen alle hemmenden Potenzen, hat eben damit für Freiheit und Vaterland, für Freundschaft und Wissenschaft, ja für Gott genug getan. Ja, die ganze christliche Moral dürfte bei ihm nicht übel fahren. "Arbeite und dann tue, was du willst!" dürfte eine erlaubte Variante eines bekannten Wortes des heiligen Augustin fein.
Alle Vereinsbrüder aber und alle "Wilden" sollen den Verein aller Vereine, das ist die Kirche resp. die religiöse Gemeinschaft, kultivieren. Die christliche Kirche heisst eine Gemeinschaft der Heiligen; sie könnte auch eine Gemeinschaft der Glaubenden, der Liebenden, der Arbeitenden genannt werden. Wohl jedem, der ein lebendiges Glied ist am Leib der religiösen Gemeinschaft, der sich von ihr tragen und zu allein guten Tun, zu allseitig treuer Arbeit ermuntern lässt. Es in noch keiner, der ein lebendiges Glied einer lebendigen Gemeinde war, ein verbummelter Student geworden .
Hochgeehrte Versammlung! Es bleibt mir eine Schlussbetrachtung übrig, die ich Ihnen trotz vorgeschrittener Stunde nicht schenken kann. Wir haben bis jetzt immer nur gefragt, was der Student tun kann und soll, um ein fleissiger Arbeiter zu werden und sich dabei arbeitstüchtig zu erhalten; die Frage ist jetzt, was etwa die Universität tun kann und tun soll, um diese Bestrebungen des Studenten zu unterstützen.
Die alma mater des deutschen Sprachgebiets ist bekanntlich eine Mutter, welche ihre Kinder nicht beständig unter Augen hält und am Gängelbande führt, sondern ihnen weitgehendste Freiheit gewährt, Freiheit zu arbeiten oder zu faulenzen, Freiheit die Kollegien zu besuchen oder nicht zu besuchen, Freiheit nach dem Höchsten zu streben oder zu "sumpfen" und zu verderben. Eine wunderliche Mutter! Sind denn ihre Kinder majorenn und völlig reif, sich selbst zu führen? Die Resultate sprechen nicht dafür. In keinem andern Stand geht ein so grosser Prozentsatz der Jugend verloren, kommt ein so grosser Prozentsatz an Leib und Seele geschädigt und mit ungenügender Ausrüstung fürs Leben ans Ziel oder vielmehr nicht ans Ziel. Eine Statistik über die Kümmernisse der Väter und die Tränen der Mütter gibt es nicht; ich fürchte aber, dass die Zahlen für die akademische Jugend höher ausfallen würden als für die Söhne, die eine andre Laufbahn erwählt haben. (Ich habe nichts dagegen, dass Basel relativ unsträflich dasteht, dass unsre Studenten, vom Milieu einer durchweg fleissigen Bevölkerung umfangen, im allgemeinen auch vom Arbeitsgeist erfüllt sind. Umso besser darf ich davon reden, weil wir nicht besonders grosse Sünder sind.)
Die Freiheit, welche die alma mater ihren Söhnen gewährt, ist von reicher Poesie umkränzt worden und gilt weithin als unantastbares Gut. Dennoch frage ich: In welchem andern Stand und Beruf wagt man dies Experiment, die Jugend zwischen dem siebzehnten und fünfundzwanzigsten Jahre aus dem Elternhaus
 zu entlassen, sie den Gefahren der Gross- und der Kleinstadt
zu überantworten, ihr genügend Geld in die Hände zu
geben und zu alledem die Freiheit, zu arbeiten oder nicht zu
arbeiten, zu garantieren?
zu entlassen, sie den Gefahren der Gross- und der Kleinstadt
zu überantworten, ihr genügend Geld in die Hände zu
geben und zu alledem die Freiheit, zu arbeiten oder nicht zu
arbeiten, zu garantieren?
Man sagt "Ohne Gefahr wird nichts Grosses erreicht. Die Freiheit ist zur Entwicklung und Erprobung derer, die einst an der Spitze der Nation marschieren sollen, nötig." Und man setzt hinzu: Um der Wägsten und Besten willen, deren Charakter nur in der Freiheit sich voll entfalten könne, müssten wir die Minderwertigen riskieren und einige vom Mittelgut dazu. Ich frage: Riskieren wir wirklich nur die Geringen und das Mittelgut? Gehörte z. B. jener Johann Wolfgang Goethe, der sich im Oktober 1765 in Leipzig immatrikulieren liess, zum Mittelgut oder gar zu den Geringen? Er hatte auf die Universität nicht nur die reiche Mitgift einer herrlichen genialen Mutter mitgebracht sondern in nuce auch des Vaters Statur, den Willen, das Leben ernst zu nehmen und ernst zu führen. Dennoch kam er mit sehr reduzierter Gesundheit von Leipzig nach Frankfurt zurück; und es waren nicht die Verwüstungen allzu fleissigen Studiums, die ihn krank gemacht. Wenn wir — es ist ein netter Gedanke — zur Selektion und Erprobung die Töchter in voller Freiheit der Grossstadt anvertrauen würden, wer würde dann den Schaden davontragen? Doch nicht die minderwertigen und hässlichen. So sind auch unter den Studenten die flott ausgestatteten, die sozial brauchbaren, die Menschen von Geist und Witz, mit Feuer im Blut und Mark in den Röhren den grössten Gefahren ausgesetzt. Die schlauesten, edelsten Bäume haben den Pfahl zum Schutz gegen den Wind am nötigsten.
Man darf das Dogma, dass die Studenten der vollen akademischen Freiheit bedürften, um zu freien, vollwichtigen Männern ausreifen zu können, füglich in Zweifel ziehen im Blick auf die
 Engländer. Die Engländer sind doch wohl ein freies Volk; an
charaktervoller Mannheit und Männerstolz vor Königsthronen
stehen sie doch — bescheiden gesagt — keinem Volk der Erde
nach. Aber sie hüten sich, ihrer Jugend unsre deutsche akademische
Freiheit zu geben. Auf ihren alten Hochschulen von
Dublin und Cambridge sind die meisten Studenten interniert;
sie können sich nicht willkürlich ausleben, sie sind von allerlei
Nötigungen zur Arbeit umgeben. Und in solcher Beschränkung
der Freiheit wachsen sie zu freien Männern aus.
Engländer. Die Engländer sind doch wohl ein freies Volk; an
charaktervoller Mannheit und Männerstolz vor Königsthronen
stehen sie doch — bescheiden gesagt — keinem Volk der Erde
nach. Aber sie hüten sich, ihrer Jugend unsre deutsche akademische
Freiheit zu geben. Auf ihren alten Hochschulen von
Dublin und Cambridge sind die meisten Studenten interniert;
sie können sich nicht willkürlich ausleben, sie sind von allerlei
Nötigungen zur Arbeit umgeben. Und in solcher Beschränkung
der Freiheit wachsen sie zu freien Männern aus.
Man wird auch nicht sagen dürfen, dass unsre Internate mit ihrer Beschränkung der akademischen Freiheit und gelinden Nötigung zur Arbeit sich als schädlich erwiesen haben. Das Tübinger Stift z. B. darf sich sehen lassen; die "Stiftler" haben jedenfalls ihren vollen Prozentsatz zu den freien Fortschrittsmännern und Kulturträgern deutscher Nation gestellt. *)
Man hat aus Zeitungen gehört, dass eine Bewegung im Gange sei, den Studierenden des schweizerischen Polytechnikums, welche bis jetzt durch Repetitorien, Semesterzeugnisse und andre Vorkehrungen zur Arbeit genötigt werden, die Freiheit der Universitätsstudenten zu erkämpfen. Wär's nicht vielleicht zeitgemässer, die Universitäten den Einrichtungen des Polytechnikums anzunähern?
Ich weiss es nicht. Ich habe meine Fragezeichen gemacht. Im übrigen ist unsre akademische Freiheit nun da und sieht nicht darnach aus, als wenn sie bald abdanken wollte. Die fruchtbare Fragestellung kann nur sein, was sich auf dem Boden des Bestehenden zu Nutz und Frommen der Studierenden tun lässt.
Zur Sache. Hat die Universität nicht alles Nötige getan, wenn sie den Studierenden bei der Immatrikulation ein Gelübde
des Fleisses abfordert? Dies Verfahren kommt ja wohl noch da und dort vor und ist überaus einfach. Aber schwerlich hat daran ein Psychologe, Pädagoge, Ethiker seine Freude. Auch wenn sie es wollten, können doch nicht alle Studierenden solch' ein Versprechen halten. Dergleichen Gelübde fordert ja freilich auch das Kloster. Aber erstens ist das Kloster uns nicht unbedingt vorbildlich; und zweitens werden die Gelübde im Kloster unter wesentlich günstigern Bedingungen geleistet: Das Kloster bereitet die Novizen durch Unterweisung, Exerzitien, Gebete auf die ernste Sache vor, nimmt sie in ein der Erfüllung überaus günstiges Milieu auf, kontrolliert den Gehorsam und ahndet die Übertretung. Davon fehlt in unserm Fall nicht weniger als alles. Besser wäre drum, werin solches Gelübde nicht wäre.
Was denn nun? Ein Arzt, dem ich unsre Frage vorgelegt, erklärte sich unter anderm folgendermassen "Der übliche Gebrauch der studentischen Freiheit erweckt mit vielen Erscheinungen den Eindruck ,sie wissen nicht, was sie tun'. Eine Besserung ist aber nicht zu erwarten durch Einschränkung der studentischen Freiheit. Wenn sie nicht wissen, was sie tun, so gibt sich der Weg zur Besserung der Verhältnisse von selbst. Es ist der Weg der Aufklärung. Es sind also für die ersten Semester obligatorische Vorlesungen über Lebensweisheit notwendig." So der Arzt. Das lässt sich hören. Freilich, weil die studentische Freiheit nicht eingeschränkt werden soll, dürften wir auch diese "Hodegetik oder Ethik für Studenten" nicht obligatorisch machen, sondern nur anbieten. Ein einstündiges Semesterkolleg könnte die Fragen, die ich heute bloss gestreift und die vielen andern. die ich auch nicht einmal gestreift, auf gedeihliche Weise behandeln. Es wird sich in jedem Lehrkörper ein Philosoph finden, der Physiolog und Hygieniker genug ist, oder ein Mediziner, der Philosoph und Seelsorger genug ist, um dieser Materie gewachsen zu sein und sich mit Hingebung derselben anzunehmen.
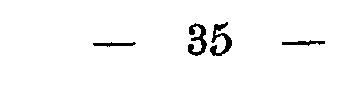
Ein andres. Durch die Entwicklung der Seminarübungen in den letzten dreissig Jahren hat sich der Hochschulbetrieb dem gewöhnlichen Schulbetrieb angenähert. Hier ist der Monolog des Professors abgedankt, und der Student ist zum Reden und vorher zum Denken und Arbeiten genötigt. In den Seminarien und Repetitorien soll nun aber auch wirklich der Selbstbetätigung des Studenten ganz freier Naum gegeben werden. Mancher Professor, der sich an den Monolog gewöhnt hat, ist in Gefahr, auch im Seminar wieder selber zu tun, was die Studierenden leisten sollten. Auch in den eigentlichen Vorlesungen darf die Alleinherrschaft des Monologs etwas begrenzt werden. Es wird wenigstens in unsern kleinern Fakultäten möglich sein, durch einzelne Fragen den Monolog zu unterbrechen und so die Selbsttätigkeit der Studierenden immer wach zu erhalten.
Noch auf einem andern Punkt nähert sich die Hochschule immer mehr der Normalschule, nämlich punkto Semesteranfang. In der guten alten Zeit, da die Musensöhne per pedes und per Postkutsche zur alma mater wallfahrteten, konnten sie ihre Ankunft nicht mit Sicherheit berechnen. Also wartete der Professor wie billig, Gewehr bei Fuss, noch zehn bis vierzehn Tage, bis der Heerhaufe beisammen war, und glich etwa den Ausfall der zwei Wochen am Anfang des Semesters damit aus, dass er drei Wochen früher schloss. Es frommt gewiss dem Fleiss der Studenten, dass wir im Zeitalter der Blitzzüge und der Chronometer jene alte Gepflogenheit nur mehr vom Hörensagen kennen.
Dem Fleiss der Studierenden förderlich ist meines Erachtens auch die Teilung der Examina in mehrere Sektionen. Da nähern sich unsre medizinischen Fakultäten fast idealen Verhältnissen; es ist für den jungen Mediziner ein trefflicher Sporn, wenn ihm schon am Ende des zweiten Semesters das erste, am Ende des vierten das zweite Examen winkt. Nach dem zweiten ist er dann reif genug, über eine grössere Zeitspanne hinweg dem Endziel fleissig
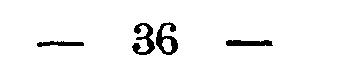 zuzusteuern. Auch das in dem Fleiss der Medizinstudierenden
gewiss förderlich, dass ihre Professoren zugleich die Prüfungsbehörde
bilden, was nicht in jeder andern Fakultät der Fall ist.
zuzusteuern. Auch das in dem Fleiss der Medizinstudierenden
gewiss förderlich, dass ihre Professoren zugleich die Prüfungsbehörde
bilden, was nicht in jeder andern Fakultät der Fall ist.
Zum Schluss immer unter dem nämlichen Gesichtspunkt
noch eine Bitte an Gymnasium und Realschule: Überladen und
übermüden Sie die Schüler nicht! Das Gymnasium machte,
zwar nicht hier, aber an manchen andern Orten, je und je solche
Zumutungen an die obersten Klassen, dass man hernach das Ausruhen
während eines oder auch zwei Semestern als ganz naturgemässe
Reaktion zu betrachten pflegte. Diese Ausspannung
würde man den "Füxen" zwar gönnen und die halb oder ganz
verlorenen Semester nicht zu tragisch nehmen. Wenn nur nicht
nach den Ruhesemestern der Rückweg zu fleissiger Arbeit so schwer
zu finden wäre! Es ist weit spekulativer, wenn den Schülern
zwar ernste Arbeit, aber nichts Ungebührliches zugemutet wird.
Sie sollen, an fleissige Arbeit gewöhnt, aber ganz unermüdet an
die Hochschule entlassen werden, damit sie hier frisch und fröhlich
mit wahrem Heisshunger sich ins Studium stürzen mögen .






