Schweizerisches Strafrecht
Rektoratsrede
gehalten an der 84. Stiftungsfeier der Universität Bern
den 14. Dezember 1918
von
Professor Dr. jur. Philipp Thormann.


Als mein juristischer Vorgänger vor 6 Jahren an dieser Stelle seine
gehaltvolle Rektoratsrede begann, konnte er an ein Ereignis
des Jahres 1912 anknüpfen, das Inkrafttreten des schweizerischen
Zivilgesetzbuches, mit dessen Werden und Entstehen unsere Universität
in besonders hervorragender Weise verbunden war 1). Der
Kriminalist, der heute zu Ihnen spricht, muss bescheidener auftreten;
die Zivilisten haben uns im Wettlauf um die Priorität in der eidgenössischen
Gesetzgebung schon um ein volles Jahrzehnt geschlagen
und noch steht es nicht fest, wann und wie wir das
Ziel erreichen werden. Und doch wird das Jahr 1918 in der
Entwicklungsgeschichte des schweizerischen Strafrechtes Erwähnung
finden, wir haben nach beinahe 3 Jahrzehnten die Periode
wissenschaftlicher Vorarbeiten zur Rechtseinheit abgeschlossen und
die parlamentarische Beratung des Strafgesetzentwurfes steht unmittelbar
bevor. Am 23. Juli 1918 hat der Bundesrat seine Botschaft
an die Bundesversammlung zum Entwurf eines schweizerischen
Strafgesetzbuches erlassen und der Entwurf ist in der
Fassung veröffentlicht worden, welche die Grundlage der Beratung
in den eidgenössichen Räten bilden soll. Dieses Ereignis
ist zunächst wohl nur von den besondern Interessenten und einigen
sehr gewissenhaften Zeitungslesern gebührend vermerkt worden,
es bedeutet aber einen wichtigen Markstein in der Entwicklung
unseres Strafrechtes und die Gelegenheit, an der Stiftungsfeier
unserer Alma mater bernensis vor einer ausgewählten Zuhörerschaft
auf die Bedeutung dieses Zeitpunktes aufmerksam zu machen,
erschien mir zu reizvoll, um sie vorübergehen zu lassen. Nicht
als ob in der Bevölkerung das Interesse für Strafrechtswissenschaft
und Strafrechtspflege besonders geweckt zu werden brauchte, es
besteht schon; und jeder grössere Strafprozess und jede öffentliche
Diskussion über diese oder jene Strafart erbringt hierfür den
Beweis. Nicht ganz neidlos hat unser Kollege Gmür vor 6 Jahren

an dieser Stelle erklärt, es werde ihm vielleicht nicht so leicht
gelingen, die Aufmerksamkeit der Zuhörer für den von ihm behandelten
zivilrechtlichen Gegenstand wachzurufen, wie z. B. seinem
kriminalistischen Kollegen, wenn er über Todesstrafe spreche,
obgleich ich seine damals ausgesprochene Ansicht als ob schon
dieses Thema an sich angenehm spannende Gefühle in der Brust
des Zuhörers auslöse 2), nicht teilen kann. Es ist nicht zu bestreiten
und bedeutet übrigens für den Strafgesetzgeber durchaus
nicht immer eine Erleichterung seiner Aufgabe, dass die Nichtjuristen
sich in sehr intensiver Weise um die Probleme des Strafrechtes
kümmern und die praktische Anwendung des Rechtes bald
billigend bald missbilligend verfolgen; ist doch die Frage, was ein
Verbrechen sei und wie das Verbrechen zu bekämpfen sei, eine
solche, deren Beantwortung in letzter Linie auf die grundlegende
Weltanschauung des Einzelnen zurückgeht. Alle grösseren Zeit- und
Geistesströmungen äussern hier ihren Einfluss, man beachte z. B. das
18. Jahrhundert mit seiner Aufklärungsbewegung und die neuesten
Erscheinungen der positivistischen Schule in Italien. Bei einer solchen
Diskussion stellt sich jetzt der Einzelne gewöhnlich auf den
Standpunkt des die allgemeinen Interessen verfolgenden Gemeinwesens,
wenn er nicht noch subjektiver die Stellung eines durch
ein Verbrechen Verletzten sich vorstellt, selten nur denkt er daran,
dass er vielleicht auch der die Strafe erleidende Teil sein könnte,
und wenn er dies versucht, so fehlt ihm gewöhnlich aus guten
und an sich gewiss löblichen Gründen die durch die Erfahrung
geschaffene Fähigkeit hierzu 3). Jeder erwartet vom Strafrecht und
seiner Anwendung, der Strafrechtspflege, zunächst den Schutz seiner
selbst und seiner rechtlich anerkannten Interessen, und denkt, dass damit
auch das Interesse des Gemeinwesens geschützt sei. Erst eine
Jahrhunderte dauernde Entwicklung hat das Interesse des Gemeinwesens
vorangestellt und die zunehmende Bedeutung der res
publica im Gegensatz zum Individuum lässt sich in der Strafrechtsgeschichte
deutlich verfolgen.
Die Sorge um die Gesetzgebung im Allgemeinen, die Strafgesetzgebung
im Speziellen, bildet ein Kennzeichen jedes bedeutenden
Herrschers und jeder fürsorglichen Regierung seit altersher:
man erinnert sich für Frankreich an die Namen Franz I., Ludwig
XIV. und Napoleon I., für Deutschland an Karl V., Maria Theresia,
Joseph II. von Oesterreich und Friedrich II von Preussen, bis
dann im 19. Jahrhundert ein allgemeines Kodifikationsfieber ausbrach,
dem nur einige kleinere Staatswesen sich entziehen konnten,
so Uri, 4) und Nidwalden in der Schweiz bis zum heutigen Tag,
die beiden Mecklenburg 5), Schaumburg-Lippe und Bremen 6) in
Deutschland bis 1870. Die hübsche Sitte, dem lateinischen Titel
Constitutio criminalis den Namen des Herrschers beizufügen, hat
klangvolle Bezeichnungen hervorgebracht, von denen die Carolina 7),
die Ferdinandea 8), die Theresiana 9) und Josephina 10) die bekanntesten
sind; ja auch an Verwandtschaft hat es diesen jüngern
oder ältern Damen nicht gefehlt, wie man denn z.B. die Bambergensis
von 1507 als mater Carolinae und die Brandenburgica von 1516 als
soror Carolinae bezeichnete; ihre nähere Bekanntschaft dagegen
pflegte nicht sehr gesucht zu sein und jahrhundertelang hat der
sanfte Name Carolina keine angenehm spannenden Gefühle in der
Brust der Zuhörer ausgelöst.
Doch kehren wir zur schweizerischen Strafrechtsgeschichte
zurück. Als die drei Waldstätte 1291 ihren ewigen Bund schlossen,
gehörten sie zum allemannischen Rechtsgebiete; das Recht ihrer Bewohner
war allemannisches Stammesrecht, gewohnheitsrechtlich
weiter entwickelt und der Zersplitterung des germanischen Rechtes
anheimgefallen. Der kurz vorher entstandene Schwabenspiegel
von 1275 wird damals in den wilden Bergtälern noch nicht bekannt
gewesen sein; später mag er in der Ostschweiz Beachtung
gefunden haben, wenn gleich die besten Kenner der alten schweizerischen
Strafrechtsgeschichte wie Osenbrüggen und Pfenninger
ihm keinen grossen Einfluss zugestehen wollen 11).
In Wirklichkeit werden die alten Eidgenossen von der Strafrechtseinheit
nicht wesentlich entfernt gewesen sein, da ihre
Täler und Wohnstätten nahe beieinanderlagen und ähnliche Lebensbedingungen
schafften: es ist aber für die damalige Rechtsunsicherheit
charakteristisch, dass sie dieser mehr oder weniger
übereinstimmenden Rechtsüberzeugung nicht trauten und gewisse
wichtige Fragen schriftlich regelten. So enthalten die Art. 6 bis 8
der ersten Bundesurkunde Bestimmungen über Tötung, Brandstiftung,
Begünstigung, Raub und Schädigung am Vermögen. Auf Totschlag
wird die Todesstrafe angedroht, wer den Totschläger begünstigt
oder beschirmt, soll verbrannt werden; "Der Brandstifter
soll nimmer für einen Landsmann gehalten werden" Ganz ähnliche
Bestimmungen finden sich im Bundesvertrag von 1315, Art. 12
bis 15, den die Eidgenossen nach der Bluttaufe von Morgarten,
nicht mehr in gelehrter lateinischer Sprache sondern deutsch und
allgemein verständlich niederschrieben 12). Doch ist die Aeusserung
unseres Kollegen Hilty in seiner Nationalratsrede vom 16. Juni
1898 bei Anlass der Beratung über die Eintretensfrage auf die
Verfassungsbestimmungen über die Rechtseinheit, die älteste Eidgenossenschaft
habe eine grössere Zentralisation im Strafrecht besessen
als die heutige Eidgenossenschaft von 1898 13), nur cum
grano salis und als politisches Argument verständlich, man vergleiche
den Umfang der 4 Bestimmungen der ältesten Bünde
mit dem Bundesstrafrecht, das in der Kronauerschen Sammlung
von 1902 über 300 Druckseiten ausfüllt 14); und von Zentralisation
kann bei einer Uebereinstimmung des Gewohnheitsrechtes nicht
wohl gesprochen werden.
Der kleine Ansatz eines geschriebenen eidgenössischen Strafrechtes
verkümmerte überdies bald wieder, indem die spätem
Bünde, namentlich die mit Luzern (1332), Zürich (1351) und Bern
(1353), keine einheitlichen Strafrechtsbestimmungen mehr enthielten,
sondern nur die Bundeshülfe für den Fall einer vom Gericht eines
Bundesgliedes ausgesprochenen Todesstrafe versahen. Zwischen
Stadt und Land bestand wahrscheinlich die Uebereinstimmung der
Rechtsüberzeugung schon nicht mehr, und die Städte hielten es
wohl mit Rücksicht auf ihre. Rechtsaufzeichnungen nicht für notwendig,
sich einem gemeinsamen Recht unterzuordnen 15).
Dagegen finden sich uns interessierende Stellen in den 3
grossen folgenden Bundesbriefen, dem Pfaffenbrief von 1370,
dem Sempacher- oder Frauenbrief von 1393 und dem Stanser
Vorkommnis vom 22. Dezember 1481. Art. 3 des Pfaffenbriefes
verbietet den Geistlichen die Anrufung eines geistlichen oder
eines fremden weltlichen Gerichts, "denn sie sollen von jeglichem
Recht nehmen an den Stätten und vor dem Richter, da er ansässig
ist, es wäre denn in betreff einer Ehe oder in geistlichen Sachen",
unter Androhung der Entziehung von Schutz und Schirm (Art. 4);

der Sempacherbrief stellt in seinem 2. Artikel die Verpflichtung
der verbündeten Länder und Städte auf, den Eidgenossen jeden
Hausfriedensbruch und jede Plünderung zu untersagen "es sei im
Krieg, im Frieden oder in Sühne" ohne freilich eine bundesrechtliche
Strafnorm aufzustellen. Dagegen enthalten die Artikel 4 ff. eine
eigentliche Kriegsordnung, ein Militärstrafrecht für Kriegszüge in
Erfüllung von Bundespflichten, aus der speziell das Verbot der
Fahnenflucht, des Plünderns während der Schlacht, ferner Bestimmungen
zum Schutze der Klöster, Kirchen und Kapellen, ferner
zum Schutze der Frauen vor Gewalttat und Ungebühr hervorgehoben
seien. "Und zu Ehren der Jungfrau Maria, damit sie ihre
Gnade nicht entziehe, befehlen die Eidgenossen, dass man Frauen
und Töchter nicht stechen, schlagen oder misshandeln soll; nur
wenn diese selbst durch Gewalttat oder Geschrei erheblich schaden,
soll man sie strafen nach verdienen". Das Stanser Vorkommnis
endlich enthielt Bestimmungen gegen Friedensbruchs ("Uebermut,
Aufruhr oder Gewaltsamkeit") wobei Gerichtstand und Recht des
Ortes der begangenen Tat vorbehalten bleiben (Art. 2 bis 5), und
in Art. 11 werden die Bestimmungen des Pfaffenbriefes von 1370
bestätigt, was den Beitritt von Bern und Glarus, die 1370 nicht mitgewirkt
hatten, sowie der neuen Bundesglieder Freiburg und
Solothurn zu den Grundsätzen der Ausscheidung zwischen weltlicher
und geistlicher Gerichtsbarkeit im Sinne der Nichtanerkennung
der Immunität der Geistlichen vor den weltlichen Gerichten
bedeutete.
Abgesehen von diesen wenigen geschriebenen bundesrechtlichen
Rechtssätzen galt überall allemannisches Gewohnheitsrecht
in geschriebener oder ungeschriebener Form (Stadtrechtssatzungen,
Weistümer, Urteilsbücher), zweifellos in Bern und Freiburg auch
Recht burgundischen Ursprungs, ohne dass, wie Pfenninger nachweist
16) eine Trennung oder Ausscheidung nach Herkunft getroffen
werden könnte. Wenige öffentliche Strafen, aber dafür um so strengere,
z. B. bei unehrlicher oder schändlicher Tötung (Mord) das Rad,
Todesstrafe in der Regel auch bei Brandstiftung, Raub, Notzucht
Diebstahl im 2. Rückfall; in Fällen ehrlicher Tötungen im Affekt
(Totschlag) wird von Obrigkeitswegen der Abschluss von Sühneverträgen
(Thädigungen, liebliche Richtungen) begünstigt, um die

Blutrache zurückzudrängen, auf leichterem Unrecht (den sog. Freveln,
welcher Name sich noch im heutigen Wald- und Feldfrevel erhalten
hat) stehen meist Geldbussen, welche teils dem Verletzten, teils
dem Inhaber des Gerichtsbannes zukommen. Das Friedensrecht,
wie wir es in den spätem Quellen so vollkommen ausgebildet
finden und das von Pfenninger an Hand der bernischen Stadtsatzung
von 1539 in klassischer Weise dargestellt worden ist,
bildet die Grundlage und den normalen Zustand des Gemeinwesens,
seine Störung ist der Friedensbruch in mannigfaltigster Form,
den es zu verhüten gilt. Gegen Ende dieser Zeitperiode tritt die
öffentliche Strafe in abschreckender und grausamer Gestalt immer
mehr hervor, sei es als Todesstrafe (Enthaupten, Hängen am
Galgen, Rädern, Verbrennen, Lebendig begraben, Ertränken, Vierteilen
usw.), sei es als verstümmelnde Strafe mit Anlehnung
an die Talionsidee (wie Zungenausreissen, Ohrabschneiden,
Handabhauen, Augenausstechen usw.). Die Freiheitsstrafe kommt
als "Türmen" (Einschliessung im Turm) vor, Verbannung und
Eingrenzung sind auch hiezu zu rechnen; von den schimpflichen
Strafen hat sich die Trülle (Drehhäuschen) bis ins 18. Jahrhundert
erhalten.
Von einer besondern schweizerischen Strafrechtsentwicklung
kann bis 1500 nicht gesprochen werden, wie auch die Eidgenossen
sich stetsfort als Glieder des hl. römischen Reiches deutscher Nation
betrachten. Mit dem Schwabenkrieg (1499) beginnt die Loslösung
vom Reiche, sich äussernd in der Nichtbeachtung der spätem Reichsabschiede,
der selbständigen Bündnispolitik nach Westen und
Süden und der politischen Neutralität im 30jährigen Kriege, als
deren Frucht die völkerrechtliche Anerkennung der Selbständigkeit
der Schweiz im Frieden von Münster (1648) erscheint. Ohne
diese politische Bewegung wäre die Schweiz vielleicht zur Stratrechtseinheit
gekommen, wenn sie die 1532 auf dem Reichstage
zu Regensburg erlassene peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V.
die berühmte Carolina, angenommen hätte. Zwar fand die Carolina
hie und da im Gerichtsgebrauch einiger Stände und zugewandter Orte
Anwendung, so namentlich in Basel und Schaffhausen, in den
Gebieten des Fürstbischofes von Basel und des Fürstabtes von
St. Gallen, im Wallis und im bernischen Waadtlande nach 1750; in
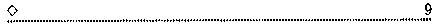
Luzern wurde seit 1606 ein Auszug aus der Carolina als Anweisung
für das peinliche Verfahren vor dem Ratsrichter benutzt;
als direkte Gesetzesquelle wurde sie aber nicht anerkannt, auch
nicht als Muster für die einheimische Gesetzgebung gebraucht;
offenbar erwiesen sich die Abneigung gegen das die Carolina
wesentlich beeinflussende römische Recht und das Festhalten am
Friedensrecht und den einheimischen Satzungen als zu stark.
Dagegen hat die Carolina im 18. Jahrhundert, wohl in Ermangelung
einer auf ständige Truppen zugeschnittenen einheimischen
Kriegsordnung, als Militärstrafrecht der kapitulierten Schweizerregimenter
in fremden, vornehmlich französischen, Diensten Anwendung
gefunden, und zwar bezeichnenderweise hier als Ausdruck
nationalen Rechtsgefühles, da in den Kapitulationen stets
die schweizerischen Stände sich die eigene Gerichtsbarkeit vorbehielten
18) und durch das Offizierskorps der Regimenter ausüben
liessen.
Trotz des Aufgebens der Einheit der Rasse und der Sprache
durch die Aufnahme von Freiburg in den Bund und die Gebietserwerbungen
einzelner Stände im Westen und Süden kann von
einem grundsätzlichen Gegensatz der Rechtsanschauungen auf dem
Gebiete der Strafrechtspflege nicht gesprochen werden. Neben
den alten Coutumes brachten gerade die waadtländischen Gerichte
im 18. Jahrhundert vereinzelt die Carolina zur Anwendung, jedenfalls
nicht auf Veranlassung Berns hin, das in seinen deutschen
Landschaften die Carolina nicht berücksichtigte. Erst das 19. Jahrhundert
mit seinen kantonalen Kodifikationen, die unter dem Einflusse
fremder Gesetzgebung und der Wissenschaft standen, hat
den Unterschied stärker hervortreten lassen.
Bis zum Ende der alten Eidgenossenschaft blieb die Aufzählung
der einzelnen Verbrechen und Frevel in den Gerichtssatzungen
überaus lückenhaft, überall mussten Herkommen und
Gerichtsgebrauch aushelfen. Die Zahl der im öffentlichen Interesse
zu bestrafenden Handlungen nimmt zu, die Strafen selbst werden
gemildert, an Stelle des alten Richtens nach Gnade tritt vielfach
die Ausübung des Begnadigungsrechtes durch die Obrigkeit in
den Vordergrund. Die Todestrafe wird im 18. Jahrhundert nur
noch vereinzelt anders als durch Enthaupten oder Hängen vollstreckt;

Körperstrafen, Ehrenstrafen, Bussen und Verbannung
bleiben in Anwendung und die Freiheitsstrafen erhalten noch im
18. Jahrhundert in den Schallenwerken eine neue Ausgestaltung 19.
Im 18. Jahrhundert wird auch der Mangel vollständiger geschriebener
Rechtsquellen fühlbarer. 1719 beschloss der Grosse Rat
von Bern, durch eine Kommission die Frage prüfen zu lassen,
"ob eine Kriminalsatzung erlassen werden solle". Die Kommission
erstattete ihr Gutachten im Jahre 1728 unter der Ueberschrift: "Ob
in Criminalibus etwas praecises zu statuieren," wobei sie die
Gründe für und wider erörterte. Es wird namentlich die
Schwierigkeit hervorgehoben, "eine solche Criminal Constitution
zum Stand zu bringen, die auf alle verfallende Casus könne
gerichtet seyn, u.s.f. Denn durch eine General Constitution leicht
etwas statuiert werden könnte, dessen man sich hernach gereuwen
möchte". Auch die Furcht vor der Formaljurisprudenz machte
sich geltend: "Was dann die Form der Procedur betrifft, haltet
man vor das sicherste, solches wie bisher der disposition eines
weisen Rathes zu überlassen, aus Beysorg, dass man mit introducierung
vieler formaliteten nicht anderes als grosse weitleuffigkeiten wie
etwan durch die teutschen Juristen geschieht, einführen wurde, zumahlen
schwährlich wird zu erzeigen seyn, dass bey unserer
patriotischen Manier einicher ohnschuldiger weiss hingerichtet worden
seye" Das ist nichts anders als die altschweizerische Abneigung
gegen das fremde Juristenrecht und den Formalprozess. Andererseits
wurde darauf aufmerksam gemacht, "dass nicht nur gute
Gsatz das beste Zeichen einer wohlbestellten Respublic, sondern
noch die allgemeine Sicherheit und die Wohlfahrt eines ganzen
Lands denen weltlichen Regenten nebst dem hochen gewalt, insonderheit
auch dieses beyleget, dass sie ihrer Underthanen bossheit vermitlest
guter Zucht dermassen im zaum und in solcher Leitung
halten, dass wan sie nicht aus guter gewohnheit das böse meiden,
dennoch aus Furcht empfindlicher straaf von den lasteten abgeschreckt,
der beleydigte vor fernerem Schaden geschirmt und dadurch
insgemein der nuzen der menschlichen Societet befürderet
werde" und sodann neben der grossen Notwendigkeit auch die Möglichkeit
Abfassung einer Criminal-Ordnung bejaht. 1732 beschloss
der Rath trotzdem in negativem Sinne mit der Begründung, "wie
dass alle halsgerichtliche Ordnungen über die verfallende Casus
nichts praecises statuieren, sondern den Richter auf die Umbständt
und den Raht der Gelehrten weisen"20). Es fehlte somit an
Wagemut, um diesen karolinischen Standpunkt zu verlassen, vielleicht
auch an einer geeigneten Persönlichkeit, welche die Arbeit
unternommen hätte. Auch in Zürich klagt der Landvogt Johann
Kaspar Escher über "den Mangel eines vollständigen Poenalgesetzes
und das zu weitgehende freie arbitrium judicia" 21). In der
2. Hälfte des Jahrhunderts bleiben jedoch die Einflüsse der Aufklärungsperiode
nicht unbeachtet: 1777 schrieb die bernische ökonomische
Gesellschaft einen Preis von 100 Louis d'or für die beste Abhandlung
über Kriminalgesetzgebung aus; die Ausschreibung erregte europäisches
Aufsehen, 1782 wurde die Arbeit .zweier sächsischer
Juristen, v. Globig und Huster preisgekrönt. Von 1783 datiert
das neue Reglement für das Schallen- und Arbeitshaus der Stadt
Bern, das lange Zeit und über die Grenzen des Landes hinaus als
vorbildlich angesehen wurde 22). 1783 wurde durch Rathsbeschluss
die Anwendung der Folter verboten 23). Zu einer gesetzgeberischen
Leistung kam es jedoch nicht mehr; 1797 wurde
noch ein von Karl Ludwig Haller, dem spätem Restaurator, verfasstes
"Gutachten Mrhghhrn. der Committierten über die Verbesserung
der hiesigen Kriminal-Prozessform" veröffentlicht.
War die eigentliche Strafgesetzgebung sehr lückenhaft und
unvollständig, so hatte dafür der Gesetzgeber, namentlich in den
protestantischen Kantonen, sich sehr eingehend mit der Sittengesetzgebung
befasst. Die Chorgerichtssatzungen enthielten Strafbestimmungen
über Gotteslästerung, Ehebruch, Hurerei, Blutschande,
Kuppelei, Trunkenheit und Völlerei, Schwören und Fluchen, Zauberei,
Schwarzkünste, abergläubische Ceremonien und Schatzgraben,
das Spielen, ferner Kleider- und Tanzordnungen. "Nach dem
Rausche des ausschweifend lebenslustigen Mittelalters, sagt Pfeninger
21), folgte die Reformation mit dem wohltätigen Jammer
peinlicher Selbstzucht". Bern hat z. B. von 1529 bis 1798 nicht
weniger als 9 Chorgerichtssatzungen erlassen, je 3 im Zeitraum
eines Jahrhunderts, und die Satzungen mit rücksichtsloser Schärfe
gegen Gross und Gering zur Anwendung gebracht 25). Die Strenge
der von Calvin beeinflussten Genferischen Gesetzgebung ist bekannt

und über das Strafrecht Zürichs fällt Bluntschli das Urteil:
"Der sittliche Ernst und die Strenge, welche die Reformation den
Gemüthern aufgeprägt hatte, machte geneigter, harte Strafen anzuwenden
u. s. f."26).
Das spezifisch schweizerische an der Strafrechtsentwicklung von
1500 bis 1798 besteht eigentlich mehr in negativen Momenten,
der Ablehnung der Carolina und des römischen Rechtes (vom
Crimen laesae majestatis abgesehen) und der Ausschaltung der
gelehrten Jurisprudenz; als positive Momente sind zu nennen:
Beibehaltung des Friedensrechtes, Weiterbildung der Rechtsquellen
nach dem Vorbild der alten Gerichtssatzungen und teilweise
Beibehaltung der alten Gerichtsgebräuche. Das Ergebniss war nicht
befriedigend; die Abschreckungsidee beherrschte die ganze Strafrechtspflege
und erst die erwähnte Preisauschreibung weckte wieder
in weitern Kreisen das Interesse für die Frage nach Rechtsgrund
und Zweck der Strafe; die Lust am Theoretisieren und Philosophieren
erwachte als Folge der Aufklärungsideen und trug nicht
wenig zum Umsturze bei, der Ende des 18. Jahrhunderts eintrat.
Die neue Zeit rief einer neuen Gesetzgebung, die Vernunft sollte
die Welt regieren an Stelle der Tradition, und die Vernunft sollte
in. Gesetzesparagraphen gefasst jedermann verständlich gemacht,
gedruckt und vervielfältigt werden. Eine der ersten Aufgaben
der einen und unteilbaren helvetischen Republik war daher die
Schaffung eines Strafgesetzbuches, nachdem durch Beschluss vom
12. Mai 1798 die "Tortur in ganz Helvetien abgeschafft" worden
war. Es war aber leichter, Prinzipien zu proklamieren als ernsthafte
Gesetzgebungsarbeit zu leisten; innere und äussere Feinde
gefährdeten die Existenz der jungen Republik, von einer ruhigen
Vorbereitung der gesetzgeberischen Entwürfe konnte keine Rede
sein. Da griff man kurzerhand zu einem fremden Vorbild, dem
französischen Code pénal von 1791, suchte dasselbe rasch für
schweizerische Verhältnisse zurechtzustutzen, wobei man den Urtext
in höchst mangelhafter Weise übersetzte. Eine eigentliche
Beratung in den helvetischen Räten fand kaum statt. Am 1. April
1799 nahm der Grosse Rath das "Peinliche Gesetzbuch" an, der
helvetische Senat folgte am 4. Mai 1799. Das Gesetz enthielt Bestimmungen
über die Verbrechen und deren Bestrafung und sollte
.'.'.' .
später durch ein Gesetz über die korrektionellen Fälle und eine
Strafprozessordnung ergänzt werden. Damit war äusserlich
wenigstens, für den wichtigsten Teil der Strafrechtspflege, die
Strafrechtseinheit geschaffen. Ungefähr die Hälfte der den einzelnen
Verbrechen gewidmeten Artikel wird von den "Verbrechen gegen
das gemeine Wesen" (Staatsverbrechen) eingenommen und die
hier sehr häufig angedrohte Todesstrafe hat dem Gesetz zum
Rufe grosser Härte verholfen. Bedenkt man aber, dass die Todesstrafe
ohne Verschärfung durch Enthaupten vollstreckt werden
sollte, und dass im übrigen die Körperstrafen grundsätzlich durch
längere Freiheitsstrafen (Zuchthaus und Kettenstrafe) ersetzt wurden,
so muss dieser Ruf nicht als zutreffend bezeichnet werden. Wenn
man sich über den Mangel an nationalem Selbstbewusstsein hinwegsetzen
kann, der in der Entstehungsgeschichte des Gesetzes
sich kundgibt, so ist ein sachlicher Fortschritt zu konstatieren, so
schon in der Tatsache, dass die Diebe nicht mehr gehängt werden
sollen. In den 2 folgenden Jahren 1800 und 1801 ist das peinliche
Gesetzbuch mehrfach durch Novellen im Sinne der Milderung
abgeändert worden. Beachtung verdienen namentlich auch
die Grundsätze über die Gleichheit der Strafe ohne Rücksicht auf
Ring und Stand des Verbrechers (§210), sowie das Verbot der
Einziehung (Confiskation) der Güter des Verurteilten (§ 212).
Die Vermittlungsakte vom 19. Februar 1803 stellte die kantonale
Souveränität auf dem Gebiete der Strafgesetzgebung wieder her und
enthielt als einzige die Strafrechtspflege betreffende Bestimmung in
Art. 8 die Vorschrift, dass kein Kanton einem gesetzmässig verurteilten
Verbrecher eine Freistatt gewähren soll. Die Kantone
waren aber meist nicht zu einer sofortigen Gesetzgebung vorbereitet
und behielten daher teilweise das helvetische peinliche
Gesetzbuch als subsidiär geltende Rechtsquelle neben den Gerichtssatzungen
bei, so Bern bis 1866, Solothurn bis 1859, Waadt
bis 1843 und Thurgau bis 1841, Luzern und Basel bis in die
20er Jahre. So gewannen sie Zeit, um Spezialgesetze und Codifikationen
vorzubereiten. Sehr auffallend und nur als politische
Prinziperklärung verständlich ist die Tatsache, dass Freiburg durch
Gesetz vom 28. Juni 1803 die Carolina mit einigen Abänderungen
als geltendes Recht proklamierte, auch Schwyz verwies im organischen
Gesetz über Rechtsverfahren in Kriminalfällen vom 14. März
1835 auf die Carolina, "wobei aber unbenommen bleiben sollte,
sich auf die in verschiedenen Staaten eingeführten Strafgesetze
und besonders den allgemeinen Gerichtsgebrauch zu beziehen
und Rücksicht zu nehmen". Als Curiosum sei ferner erwähnt,
dass im Fürstentum Neuenburg, das 1815 als Kanton der Eidgenossenschaft
beitrat, die Regierung im gleichen Jahr ihre Ansicht
dahin äusserte, die Carolina sei "comme une sorte de raison écrite"
anzuwenden, was in Berlin nicht geringes Erstaunen hervorgerufen
haben soll 27). Nach der Revolution von 1848 wurde am 5. Juli
vom Neuenburgischen Grossen Rathe feierlichst der Beschluss gefasst:
"La loi dite Caroline ne pourra désormais recevoir d'application
dans le Canton de Neuchatel". Mit 1803 begann die bis
heute dauernde Epoche der kantonalen Kodifikationen, die auffallend
konstrastiert mit der Zurückhaltung der Gesetzgebung in den
vergangenen Jahrhunderten. Gegen 50 Strafgesetzbücher. sind in
den 25 Republiken erlassen worden, und es lohnt sich kaum,
die Zahl der Nachtragsgesetze und Novellen festzustellen. Es begannen
Aargau 1805, St. Gallen 1807/1808 und 1819, Tessin 1816,
bezeichnenderweise neue Kantone, die ihre Gesetzgebungshoheit
manifestieren wollten. Dann folgten Basel 1821 und 1824, Luzern
1827. In einigen Kantonen fanden mehrfache Revisionen statt,
so in Basel (1821 und 1824, 1835, 1846, 1872 mit Nachtragsgesetzen),
Solothurn (1859, 1874 und 1885), Luzern (1827, 1837, 1860,
1906). Die ältesten noch in Rechtskraft befindlichen sind die Gesetze
von Waadt 1843, Graubünden 1851 und Aargau 1857, alle durch
Nachtragsgesetze teilweise modernisiert, die neuesten diejenigen
von Neuenburg 1891, Appenzell I. Rh. 1899, Luzern 1906, Glarus
1899. Einzig Uri 28) und Nidwalden schlossen sich dieser Bewegung
nicht an. Es würde den Rahmen meines heutigen Vortrages
weit überschreiten, wenn ich Ihnen die Wandelungen dieser kantonalen
Gesetzgebung schildern sollte und es wird für meine Zwecke
wohl genügen, wenn ich darauf verweise, dass jedes Gesetz als
Produkt seiner Zeit und seiner Generation aufzufassen ist. Nicht
bloss der Stand der Strafrechtswissenschaft der betreffenden Zeit
spiegelt sich darin wieder, sondern oft auch das gesetzgeberische
Vorbild einer fremden Codifikation. Nicht dass sklavisch kopiert

worden wäre wie zur Zeit der Helvetik, man strebte namentlich
nach Kürze und hie und da nicht ganz glücklicher Originalität.
Die Strafrechtstheorien äusserten ihren Einfluss, mussten aber oft
vor den praktischen Rücksichten zurücktreten 29). Man versuchte
im Hegel'schen Sinn eine Proportionalität zwischen Delikt und
Strafe zu schaffen und gleichzeitig die Besserung und Spezialprävention
anzustreben. Gewiss hat der Napoleonische code pénal
von 1810 viele westschweizerische Gesetzgebungen beinflusst,
aber gerade Neuenburg hat in seinem neuesten Gesetz von 1891
eine bemerkenswerte Selbständigkeit gezeigt, und wenn das deutsche
Reichsstrafgesetzbuch von 1870 seinen Einfluss namentlich in
Zürich, Baselstadt und Solothurn äusserte, so ist wieder in neuester
Zeit die Gesetzgebung dieser Kantone durch Aufnahme neuer Rechtsideen
dem deutschen Rechte vorangeeilt.
Im Strafensystem treten die Freiheitsstrafen immer mehr in
den Vordergrund, die Körperstrafen verschwinden, zuletzt in der
Bundesverfassung von 1874 Art. 65 endgültig untersagt, die Todesstrafe
wird immer mehr auf Mord beschränkt; von 1874 bis
1879 bundesrechtlich ausgeschlossen, seit 1879 wieder in 8 Kantonen
und 2 Halbkantonen eingeführt, kommt sie nur selten zur
Anwendung.
Durch Verbesserungen in den Strafanstalten suchte man die
Freiheitsstrafen menschlicher und nutzbringender zu gestalten,
wobei der Grundsatz der gewerblichen Arbeit im geschlossenen
Raum namentlich von den grossen Musteranstalten Regensdorf
(Zürich), Basel und Lenzburg (Aargau), derjenige der landwirtschaftlichen
Arbeit im Freien besonders in Witzwil (Bern) und
Bellechasse (Freiburg), in neuester Zeit auch von einigen Anstalten
der Kantone St. Gallen, Aargau und Waadt befolgt wird. Hieraus
entstand ein edler Wetteifer, der auch auf die Vorarbeiten zu
einem schweizerischen Strafgesetzbuch seinen Einfluss ausübte.
Die Bundesgesetzgebung hat die kantonale bis heute nicht
wesentlich gefördert, indem keiner der beiden eidgenössischen
Poenalcodices, weder das Militärstrafgesetzbuch von 1851 noch
das Bundesgesetz über Bundesstrafrecht von 1853 als vorbildliche
Leistungen betrachtet werden konnten; die Bundesverfassung
äusserte dagegen einen Einfluss durch Aufstellung des Grundsatzes
der Rechtsgleichheit (Art. 4), des Verbotes der Körperstrafe
(Art. 65), vorübergehend auch der Todesstrafe, welch letztere für
politische Delikte ausgeschlossen bleibt, und durch das Verbot
der Ausweisung und Verbannung von Schweizerbürgern (Art. 44
und 60). Auch die Vorarbeiten für ein schweizerisches Strafgesetzbuch
haben die kantonale Gesetzgebung der letzten 20 Jahre
wesentlich beeinflusst, eine Anzahl kantonaler Gesetzesrevisionen,
Novellen und Nachtragsgesetze lassen deutliche Spuren hievon
erkennen, während in andern Kantonen gerade die Tatsache der
Reformarbeit des Bundes auf diesem Gebiete lähmend gewirkt
hat. Man beachte, dass die offiziellen Vorarbeiten auf dem Gebiete
der Strafrechtsvereinheitlichung bis in das Ende der 80er
Jahre zurückgehen, und dass die Abstimmung über die Verfassungsrevision
(Uebertragung der Gesetzgebungshoheit an den Bund)
am 30. Juni 1898, also vor mehr als 20 Jahren stattfand. '
In heutiger Zeit wird niemand den Beruf des Staates zur
Kodifikation des Strafrechtes bestreiten, die Strafrechtsreform stand
nicht bloss bei uns, sondern in fast allen Kulturstaaten vor Ausbruch
des Weltkrieges in erster Linie; über die politische Frage,
wer in unserem Bundesstaate diese Aufgabe durchzuführen habe,
ob Bund oder Kanton, ist heute nicht mehr zu streiten und es
lässt sich nicht leugnen, dass ein grosszügiger, einheitlicher Kampf
gegen das Verbrechen mit Rücksicht auf die Kleinheit der kantonalen
Territorien durch die kantonale Gesetzgebung allein nicht
durchführbar, ist. Dagegen lohnt es sich freilich auch heute noch,
darüber zu sprechen, auf welchen Grundsätzen dieses Gesetzbuch
aufgebaut werden solle. Der bekannte Schulgegensatz der Strafrechtstheoretiker
braucht freilich dabei nicht in gleicher Weise zur
Geltung zu kommen, wie bei der Diskussion einer wissenschaftlichen
Streitfrage, denn ein Strafgesetz .
ist kein Lehrbuch; es
stellt keine wissenschaftlichen Wahrheiten auf, sondern schreibt
den Richtern und andern Behörden ihre Tätigkeit in bestimmten
Fällen (bei Vorliegen dieser oder jener Handlungen) vor. Dabei
lässt sich oft diese Anordnung mit verschiedenen strafrechtlichen
Anschauungen in Einklang bringen, während andererseits die
gleiche strafrechtliche Grundanschauung die verschiedensten Massregeln
im einzelnen praktischen Fall rechtfertigen kann, oder die

Gesetzesvorschrift sieht eine richterliche Freiheit vor, die es dem
Richter ermöglicht, ohne mit dem Wortlaut des Gesetzes in Kollision
zu geraten, andern Anschauungen zu folgen, als diejenigen
waren, welche dem Gesetzgeber vorgeschwebt haben. So weiss
z. B. jeder Strafrichter, dass er auch bei Anwendung eines auf
dem Vergeltungsprinzip aufgebauten Strafparagraphen in der Strafzumessung
die Grundsätze der Sicherung der Gesellschaft vor
dem Uebeltäter berücksichtigen darf, soweit der Strafrahmen des
Gesetzes ihm das gestattet; und umgekehrt wird bei der Anwendung
eines Institutes wie z. B. der bedingten Verurteilung,
wo scheinbar nur eine Zweckidee verfolgt wird, niemand den
Richter verhindern können, aus Gründen anderer Art die ihm
gesetzlich gewährte Möglichkeit nicht zu benützen. Mag der
Praktiker daher auch oft geringschätzig über theoretische Grundregeln
denken, da ihm die seinem Rechtsgefühl entsprechende
Erledigung des Einzelfalles viel wichtiger dünkt, der Gesetzgeber
darf jedenfalls nicht in diesen Fehler verfallen und es bleibt noch
heute wahr, was der berühmte bayerische Kriminalist und Strafgesetzgeber
Anselm von Feuerbach 1804 bei Anlass der Kritik
des Kleinschrodischen Entwurfes zu einem peinlichen Gesetzbuch
für die Kurpfalz-Bayerischen Staaten schrieb: "Das erste Erfordernis
einer Kriminalgesetzgebung ist, dass sie ein Prinzip habe, dass
ihr ein Hauptgedanke zum Grunde liege, den sie planmässig in
dem ganzen Umfang aller einzelnen Bestimmungen verfolgt, Es
soll dieser Gedanke nicht etwa in Worte zusammengefasst, wie
der Grundsatz einer Wissenschaft, so als Grundgesetz aller besonderen
Gesetze, den Eingang in die Gesetzgebung eröffnen;
er soll und muss nur vorhanden gewesen sein in dem Geiste
des Gesetzgebers, muss diesen bestimmt und geleitet haben, muss
daher in der Gesetzgebung selbst durch seine Resultate, durch
die Konsequenz und Einheit der Verordnungen, durch die Möglichkeit
der Zurückführung aller einzelnen Bestimmungen auf ihn
selbst, sein Dasein jedem Aufmerksamen offenbaren."30)
Dabei kann aber immer noch fraglich sein, ob dieser Hauptgedanke
ein durchaus einheitlicher sein soll, ob alle andern Rücksichten
ihm in jeder Hinsicht untergeordnet werden sollen, ob
nicht mehrere Ideen, sei es gleichberechtigt oder doch in ein gewisses

Verhältnis zueinandergestellt nebeneinander bei der Schaffung
des Rechtssatzes mitwirken dürfen. "Die"Gleichberechtigung
zweier Ideen wird von der Theorie zwar dann bekämpft werden
müssen, wenn sich innere Widersprüche daraus ergeben und die
Idee des Rechts dadurch gefährdet erscheint; der zweite Weg
wird' bei den Kompromissen in der Gesetzgebung oft, und nicht
selten mit Erfolg, eingeschlagen. Je mehr der Gesetzgeber mit
der Rechtsüberzeugung der breitesten Volkskreise rechnen muss,
was zur Zeit Feuerbachs nicht im gleichen Masse der Fall war
wie heute, desto schwieriger wird die ausschliessliche Betonung
eines einzigen Grundgedankens oder eines einzigen Strafzweckes
werden, weder können wir heute ein Strafgesetz schaffen, das
die reine Vergeltungsidee im Kantischen Sinn zur Richtschnur
nimmt, noch gestattet es die fortgeschrittene Humanität, die Abschreckung
mit allen ihren Konsequenzen als massgebend zu betrachten,
ebensowenig dürfte es aber richtig sein, etwa im Sinne
der reinen Besserungs- oder Sicherungstheorie unter vollständiger
Aufhebung der Strafmaxima und Verneinung des Sühneprinzipes
gewisse Rechte des Individuums ganz hinter dem Interesse der
Gemeinschaft zurücktreten zu lassen.
Was unser Kollege Eugen Huber in seiner meisterhaften
Abhandlung "Ueber die Realien der Gesetzgebung" über die Bedeutung
des vorhandenen Rechtszustandes oder der Ueberlieferung
bei der Schaffung neuen Rechtes gesagt hat, 31) gilt für das Strafrecht
so gut, wie für das Zivilrecht. "Keine Gesetzgebung lässt
sich denken, die nicht bereits einen gegebenen Zustand der Ordnung
vor sich hat" und ebenso wie die plötzliche und vollständige
Aufhebung des Privateigentums oder der Schuldverpflichtungen
einer Rechtsidee nicht Genüge leisten könnte, so wäre auch die
vollständige Preisgabe der bisherigen Grundlage des staatlichen
Strafrechtes ohne Vergewaltigung der Rechtsüberzeugung weiter
Kreise nicht denkbar. Nun erhält aber das Strafrecht seit Jahrhunderten
seine Vertiefung und Begründung in der, ethischen Idee
der Schuld und der Sühne, der Vergeltung verschuldeten Uebels
durch Uebernahme eines Uebels; die reine Zweckmässigkeit der
Massregel, möge sie noch so anerkennenswerte Resultate, haben,
lässt das Rechtsgefühl kalt und drückt die Strafrechtspflege auf
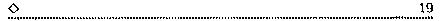
den Standpunkt einer Polizeieinrichtung herunter Freilich die
Handhabung und Vertretung eitler göttlichen Gerechtigkeit wird
der Staat ohne Selbstüberhebung nicht beanspruchen können und
wenn die Strafjustiz von der Talion zum Prinzip der Proportionalität
zwischen schuldhafter Tat und Strafe übergegangen ist,
so tritt uns sofort die Frage entgegen, welcher Masstab dann als
der gerechte anzusehen sei, warum wir einen Diebstahl mit zwei
Monaten Gefängnis, einen andern, weil dabei ein Fenster eingedrückt
wurde, mit zwei Jahren Zuchthaus als gesühnt ansehen?
Fürwahr eine Frage, die heute niemand mehr mit der Aufstellung
einer absoluten Strafskala zu beantworten den Mut oder die
Ueberhebung hätte. Zwei Sätze dürfen jedoch als Niederschlag
der ethischen Anschauungen ohne Bedenken übernommen werden:
"Je schwerer die Schuld, desto schwerer die Strafe"; und. in Bezug
auf das Höchstmass: "Die Strafe soll, kein Rechtsgut vernichten,
das wertvoller wäre, als das durch die schuldhafte Tat
vernichtete." Die Todesstrafe bei Eigentumsdelikten erscheint uns
von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet als unannehmbar; ein
Rückfall in die abschreckenden und inhumanen Strafen der früheren
Zeit ist durch diesen Gedanken ausgeschlossen, andererseits tritt
die gleiche Frage auf in Bezug auf die Verwahrung vielfach
Rückfälliger ohne zeitliches Maximum (Art. 40 Entwurf) und die
Streichung einer Höchstgrenze für die Geldbusse (Art. 45 Entwurf).
Grundsätzlich steht der schweizerische Strafgesetzentwurf auf
diesem soeben geschilderten Standpunkte: "Der Richter misst die
Strafe nach dem Verschulden des Täters zu" (Art. 60), ja er hat
sich bemüht, in einzelnen Partien dieses Prinzip folgerichtiger
durchzuführen als die bisherige Gesetzgebung; wie z. B. bei den
Körperverletzungen (Art. 108 bis 111) in Abweichung von der im
heutigen Recht meist geltenden Kausalhaftung. 32)
Das hat auch Professor Stooss, der Verfasser des 1. Entwurfes
in seinem Bericht an das Justizdepartement 1899 mit aller Deutlichkeit
erklärt: "Der schweizerische Entwurf betrachtet die Strafe
als Vergeltung ,
und bemisst die Strafe nach der Schuld des Täters.
Es ist dies die Auffassung, die allein dem Rechtsbewusstsein des
Volkes und dem Wesen und dem Begriff der Strafe nach ihrer
geschichtlichen Entwicklung entspricht". 33). Und wenn auch

weder die Erläuterungen zum Vorentwurf 1908 noch die Botschaft
des Bundesrates vom 23. Juli 1918 sich in dieser bestimmten
Weise äussern, was auf Zweckmässigkeitserwägungen
politischer Art zurückzuführen sein mag, so hat gewiss das
Wesen der Strafen des Entwurfes seit 1899 keine grundsätzliche
Aenderung erfahren. 34) Ja gerade mit dieser Auffassung
ist die Verschiedenheit zwischen den Strafen und den sichernden
Massnahmen begründet worden, und das System der mildernden
Umstände und ihres Einflusses auf die Strafzumessung (Art. 61)
kann gar nicht anders motiviert werden als mit der geringeren
Schuld und dem geringeren Vergeltungsbedürfnis in den gesetzlich
näher umschriebenen Fällen.
Andererseits sind, wie schon in vielen geltenden Rechten, die
Strafen des schweizerischen Entwurfes keine reinen Vergeltungsstrafen
mehr, sie sind schon ganz wesentlich von Nützlichkeitsideen
beeinflusst, wie sich namentlich aus den ziemlich aufs
einzelne eingehenden Vorschriften über die Vollstreckung der
Freiheitsstrafen (Art. 34, 35, 37) ergibt. Man beachte namentlich
den Arbeitszwang, der nicht mehr Selbstzweck ist; "der Sträfling
soll mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen Fähigkeiten entsprechen
und die ihn in den Stand setzen, in der Freiheit seinen
Unterhalt zu erwerben"; ferner die Bestimmungen über den progressiven
Strafvollzug mit der bedingten Entlassung, der Stellung
unter Schutzaufsicht u. a. m. (Art. 36, 44). Und die Berechtigung, ja
auch die Wünschbarkeit dieses Einflusses ist schlechthin zuzugeben.
Betrachtet der Gesetzgeber die Strafjustiz als weltliche Einrichtung,
was sie auch ist, so ergibt sich hieraus die Berechtigung,
mit dieser Institution unter Beachtung der angegebenen Grundsätze
auch bestimmte Nützlichkeitszwecke zu verfolgen. Und es
steht fernerhin fest, dass die Beachtung dieses Gesichtspunktes
für den Fortschritt der Strafjustiz, namentlich auf dem Gebiete des
Strafvollzuges sehr segensreich gewirkt hat. Die Grundsätze der
Besserungstheorie haben zur Reformierung der Strafanstalten geführt;
die Erziehung zur Arbeit durch Arbeit, die moralische und
intellektuelle Hebung der Sträflinge, die Bestrebungen zur Rehabilitierung
der Entlassenen, die Erleichterung ihrer Rückkehr in
die bürgerliche Gesellschaft, (bedingte Entlassung, Schutzaufsicht,

Stellenvermittlung) sind ebensoviele dem Zweckgedanken entsprungene
Postulate. Die schönsten Gedanken edelster Humanität
dürfen heute auch auf diesem Gebiete sich äussern und verdienen
Beachtung, so lange sie nicht als schwächliche Konzession und
Entschuldigung des Lasters erscheinen. Die Gerechtigkeit als
leitendes Prinzip der Strafrechtspflege und die Auffassung der Strafe
als Sühne des begangenen Uebels leiden doch nicht darunter, dass
die Strafmassregel auch den Zweck verfolgt, in der Zukunft erwünschte
und dem Staate nützliche Resultate hervorzubringen.
Nur darf das Streben nach diesen nicht allein ausschlaggebendes
Moment sein, ebensowenig wie es heute undenkbar wäre, eine
starre Vergeltungstheorie als einzige Richtschnur zu nehmen. Ueber
das Mass des Einflusses, das man diesen Zwecken einräumen
will, lässt sich streiten; das Prinzip einer Vereinigungsmöglichkeit
mit dem Wesen der Strafe wird dadurch nicht verneint.
Nun zeichnet sich der schweizerische Entwurf vor den geltenden
Gesetzen dadurch aus, dass er die Verbrechensbekämpfung
nicht einzig durch das Mittel der Bestrafung verfolgt, sondern den
Gerichten noch anstatt oder neben der Strafe sichernde Massnahmen
an die Hand gibt.
In einem weiteren Sinne gehört dazu auch die Unterbringung
eines Unzurechnungsfähigen oder vermindert Zurechnungsfähigen
in einer Heil- oder Pflegeanstalt, sei es zur Sicherung der öffentlichen
Sicherheit oder Ordnung (Art. 13) oder in seinem Interesse
zur Behandlung oder Versorgung (Art. 14); Massnahmen, zu denen
eine Strafuntersuchung nur den äussern Anlass gegeben hat und
die aus Gründen der Zweckmässigkeit in diesen Fällen durch
den Strafrichter anzuordnen sind, während sie sonst in die Kompetenz
der administrativen Organe, namentlich der Vormundschafts- und
Armenpflege, fallen. Die sichernden Massnahmen des
Entwurfes im eigentlichen und engem Sinn sind richterliche Massnahmen,
die vom Strafrichter als staatliche Reaktion an die Begehung
einer schuldhaften, rechtswidrigen und strafbaren Handlung
geknüpft werden. Solcher kennt der Entwurf drei: die Verwahrung
vielfach Rückfälliger (Art. 40); die Einweisung liederlicher und arbeitsscheuer Täter
in eine Arbeitserziehungsanstalt (Art. 41) und die Einweisung
von Gewohnheitstrinkern in eine Trinkerheilanstalt (Art. 42).

Diese Massnahmen lassen bedeutend stärker als die Freiheitsstrafen
einen Zweckcharakter erkennen:
a) Bei der Verwahrung vielfach Rückfälliger ist es die Sicherung
der Gesellschaft vor diesen von der modernen soziologischen Schule
als "unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher" bezeichneten Individuen
Die Verwahrung datiert mindestens 5 Jahre, ein Maximum
ist nicht vorgesehen. Sie tritt an die Stelle von Zuchthaus und
Gefängnis. Theoretisch dient sie hauptsächlich dem Sicherungszweck,
tatsächlich wird die zwangsweise Einschliessung ebensosehr
als Strafe empfunden; nicht zu billigen sind dagegen der
Wegfall eines Maximums und der Ausschluss der Begnadigung
(Art. 418).
b) Bei der Einweisung in die Arbeitserziehungsanstalt tritt
die Erziehung Liederlicher und Arbeitsscheuer durch Arbeit
zur Arbeit in den Vordergrund. Die Dauer der Einweisung
soll daher nicht von der Schwere des Deliktes abhängig gemacht
werden. Nur Arbeitsfähige sollen hier in Betracht fallen. Die
Einweisung dauert im Minimum 1 Jahr, das in früheren Entwürfen
vorgesehene Maximum von 3 Jahren ist leider aus dem letzten
Entwurf verschwunden. Die Massregel tritt an die Stelle der
Gefängnisstrafe.
c) Die Einweisung in die Trinkerheilanstalt bezweckt die
Heilung der Gewohnheitstrinker, die wegen eines Vergehens mit
Gefängnis verurteilt worden sind, wenn ihr Vergehen mit der
Trunksucht im Zusammenhang steht. Die sichernde Massnahme
wird hier, mit Recht, nicht an Stelle der Strafe, sondern nach
Vollzug der Strafe angeordnet. 35) Die Dauer der Einweisung
ist von der Heilung abhängig, darf jedoch zwei Jahre nicht überschreiten.
Die sichernde Massnahme ist hier zur Strafe in das
grundsätzlich richtige Verhältnis gebracht, dass sie neben die
Strafe tritt und ihre besondern Zwecke ungehindert und ohne
Rückwirkung auf die Strafe verfolgt. Die beiden erstgenannten
Massnahmen dagegen, Einweisung in die Verwahrungs- und die
Arbeitserziehungsanstalt werden fakultativ vom Richter an Stelle
der Freiheitsstrafe angeordnet, letztere fällt vollständig weg, und
es muss angenommen werden, dass nach der Ansicht des Gesetzgebers
diese Massregeln die Straffunktion mit enthalten, 38) da doch

vielfache Rückfälligkeit einerseits, Liederlichkeit und Arbeitsscheu
andererseits nirgends als Strafaufhebungsgründe betrachtet werden.
Es kann auch ohne weiteres angenommen werden, dass der erzwungene
Freiheitsentzug, der mit beiden Massnahmen verbunden
ist, eine strafähnliche Wirkung ausübt, betrüblich bleibt nur, dass,.
der Strafcharakter vollständig unberücksicht bleibt bei der Frage,
wie lange die Massnahme dauern solle, und dass nicht mit Unrecht
gesagt werden kann, dass die sichernde Massnahme zwar
der Wirkung nach, nicht aber in ihrem Wesen eine Strafe darstelle.
Es haben sich daher namentlich in Deutschland. die
Vertreter der klassischen Strafrechtsschule sehr bestimmt gegen
das sogen. "Vikariieren" zwischen Strafe und sichernder Massnahme
ausgesprochen. 37) Es dürfte sich empfehlen, den Charakter
dieser sichernden Massnahmen noch genauer zu bestimmen,
und wenn man ihnen die Straffunktion mit übertragen will, die
Folgerungen in Bezug auf unsere oben aufgestellten Grundsätze
über Berücksichtigung der Schuld und Maximalgrenze der Strafe
zu ziehen. Ihre systematische Stellung ist dann zu suchen mitten
zwischen den Strafen und den sogenannten reinen sichernden
Massnahmen (Einweisungen in Heil-, Pflege- und Trinkerheilanstalten),
ein Kompromisscharakter kommt ihnen zwar zu,
jedenfalls aber nicht in viel höherem Masse als den Strafen,
die auch seit langem nicht mehr reinen Vergeltungscharakter
haben. Eine Notwendigkeit, besondere Bestimmungen über Aufhebungsgründe,
Tod, Verjährung, Begnadigung, bedingten Erlass
und Rehabilitation in Fällen dieser sichernden Massnahmen würde
damit wegfallen und die Einheit des richterlichen Vorgehens wäre
besser gewahrt als nach dem jetzigen Entwurf. 38)
Einen sehr weitgehenden Gebrauch macht der Entwurf von
der Busse, indem er sie, abgesehen von den Fällen, in denen
sie ausdrücklich angedroht ist, überall als Nebenstrafe zulässig
erklärt, wo einem Vergehen Gewinnsucht zu Grunde liegt (Art. 47).
Der Vergeltungscharakter ist unverkennbar. "Der Richter bestimmt
den Betrag der Busse je nach den Verhältnissen des Täters so,
dass er durch die Einbusse die Strafe erleidet, die seinem Verschulden
angemessen ist"(Art. 45). Neu ist hierbei die Betonung
der Berücksichtigung der Verhältnisse (gemeint sind in erster

Linie die Vermögensverhältnisse) des Täters und die an sich
logische Unterdrückung des Maximums, das bei den Privatvermögen
ja auch nicht besteht. Immerhin dürften grosse praktische
Bedenken der letztem Neuerung gegenüber auftreten, namentlich
wenn diese richterliche Allgewalt auch bei der Busse als Nebenstrafe
und als Uebertretungsstrafe eingeführt werden soll. Durchaus
zu loben sind der Wegfall der Busse im Falle des Todes
des Verurteilten und die Ersetzung der Umwandlung nicht erhältlicher
Bussen in Freiheitsstrafen durch die Aufstellung eines
Uebertretungstatbestandes: "Nichtzahlen der Busse aus Böswilligkeit,
Arbeitsscheu, Liederlichkeit oder Nachlässigkeit" (Art. 346).
Reichhaltig ist die Ausstattung Entwurfes an Nebenstrafen,
indem neben den dem bisherigen Rechte bereits bekannten, der
Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit (Art. 48), der Amtsentsetzung
(Art. 49), der Landesverweisung (Art. 52) und dem
Wirtshausverbot (Art. 53) auch die. Entziehung der elterlichen
Gewalt und der Vormundschaft (Art. 50) und das Verbot, einen
Beruf, ein Gewerbe oder ein Handelsgeschäft zu betreiben (Art. 51)
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen vorgesehen sind; endlich
sind noch andere Massnahmen wesentlich präventiver Natur
zu erwähnen, die Friedensbürgschaft (Art. 54), die Einziehung gefährlicher
Gegenstände (Art. 55), der Verfall von Geschenken und
andern Zuwendungen (Art. 56) und die öffentliche Bekanntmachung
verurteilender oder freisprechender Erkenntnisse (Art. 58).
Dass auch der Grundsatz des bedingten Strafaufschubes bei
kürzern Freiheitsstrafen in das neue Recht Aufnahme fand, konnte
nach den Erfahrungen, welche die Mehrzahl der Kantone damit
gemacht haben, nicht zweifelhaft sein, weniger befriedigt das
gewählte System der "bedingten Verurteilung"nach dem französichen
Vorbilde der Loi Bérenger, das in logisch und rechtlich
nicht zu rechtfertigender Weise für den Fall der Bewährung während
der Probezeit die Verurteilung als nicht geschehen betrachtet,
damit eine Rechtsungleichheit schafft für die Behandlung späterer
Rückfälle zwischen den erstmalig bedingt Verurteilten und den
Vorbestraften und den Grundsatz, dass auf eine schuldhafte Tat
eine Strafe folge, dabei ganz verloren gehen lässt. Dagegen begrüsse
ich gerne die weitherzige Ordnung, welche, die Rehabilitation

(Art. 73 ff.) erfahren hat; es ist ein schöner Gedanke,
der an die Besserungsfähigkeit des einzelnen Menschen anknüpft,
wenn die Folgen der Bestrafung nach längerer Zeitdauer
und als Belohnung für Wohlverhalten und sittliche Erneuerung
dahinfallen sollen und die Löschung des Eintrages im Strafregister
vorgenommen wird. 39)
Diese allgemeine Uebersicht wäre nicht vollständig, wenn
dabei nicht wenigstens angedeutet würde, dass im Jugendlichenstrafrecht
das neue Recht auch neue Wege einschlägt; der Gedanke,
dass die Vergeltung hier vor der Erziehung zurückzutreten
habe, lässt sich damit begründen, dass einerseits die Schuld bei
den jugendlichen Tätern bedeutend geringer ist als bei Erwachsenen,
dass der Staat ferner gegenüber Jugendlichen noch andere
Pflichten übernommen hat als die, vergeltende Gerechtigkeit auszuüben,
nämlich die Pflicht der Erziehung und Bildung und dass
er künftiges Unheil in grösserem Masstabe verhüten kann, wenn
er rechtzeitig in Erkennung der Symptome der Verwahrlosung die
geeigneten Mittel zur Anwendung bringt. Auch ist die Erziehbarkeit
und Besserungsfähigkeit des Menschen in jugendlichem Alter
anders einzuschätzen als bei Erwachsenen.
Sie werden mir nach diesem kurzen Ueberblick zugeben, dass
das Unternehmen einer Strafrechtskodifikation eine Reihe von
interessanten Problemen zeitigt, deren Lösung die weitere Entwicklung
des gesellschaftlichen Lebens in unserem Staate ganz
wesentlich im einen oder im andern Sinne beeinflussen wird.
Schätzen wir uns glücklich, dass es uns gestattet ist, in diesen
Zeiten dieser Friedensarbeit nachzugehen: einer Arbeit, die durch
den Schutz der rechtmässigen Lebensinteressen den inneren
Frieden des Landes stärkt, wenn uns gleich die Idee der alten
Friedensordnung nicht mehr so gegenwärtig ist, wie unsern Vorfahren;
einer Arbeit, die auch durch Entfernung und Unterdrückung
gewisser Reibungsflächen den äusseren Frieden und die Neutralität
des Landes sichert. Die Arbeit ist dringlich geworden, möge
sie in Ruhe und Ueberlegung, in Verfolgung hoher Ideale, ohne
Verletzung der heiligsten Ueberzeugungen weiter Volkskreise und
in vorbildlicher Weise durchgeführt werden. Auch auf diesem
Gebiet hat die Schweiz die hohe Pflicht, den Beweis dafür zu

erbringen, dass sie ein starkes Nationalitätsgefühl besitzt, dass die
Verschiedenheit der sie bewohnenden Rassen die Lösung der
Gesetzgebungsfrage nicht hindert, sondern im Gegenteil dem
Interesse der Menschheit dienstbar macht. In letzter Linie sind
die Probleme ja nicht nationaler Art, sondern solche der gesamten
Kulturwelt. Glücklich aber wäre unser gegenwärtiges Geschlecht
zu preisen, wenn spätere Generationen ihm das Lob
spenden sollten, zur richtigen Zeit seine Aufgabe erkannt und
erfüllt zu haben.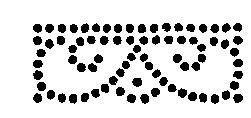

Anmerkungen.