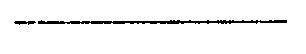Keine Strafe ohne Gesetz.
I.
Wie jede geistige Kultur erzeugt auch das Recht Gedanken, denen eine so ausserordentliche Überzeugungskraft innewohnt, dass sie eine ganze Welt erobern. Zu ihnen gehört das Rechtssprichwort: keine Strafe ohne Gesetz. Es hat die Schranken nationaler Rechtsgestaltung durchbrochen und ist für das heutige Strafrecht eine Art Glaubenssatz geworden. In zahlreichen Staatsverfassungen wird der Satz als der Ausdruck eines allgemeinen Menschenrechts proklamiert, und eine grosse Zahl der heute geltenden Strafgesetzbücher stellt ihn an den Anfang des Gesetzestextes.
Dass man den Satz in die Form einer kurzen, leichtfasslichen Parömie gebracht hat, ist eine weitere Sicherung seines Erfolgs geworden und hat ihn um so schwerer angreifbar gemacht.
Seine soziale und juristische Tragweite ist ungeheuer. Die aus ihm sich ergebenden Konsequenzen für die Gestaltung des Strafrechts sollen nachher einzeln dargelegt werden. Aber es mag nützlich sein, gleich zu Beginn die Auswirkung des Satzes an einem Beispiel zu offenbaren, das zugleich auf die eigenartigen Zustände im heutigen schweizerischen Strafrecht, nul die Rechtszersplitterung, ein grelles Licht wirft:
Ein dunkler Ehrenmann schliesst mit einem jungen, leichtfertigen, in Schulden steckenden Menschen ein Darlehensgeschäft ab. Er verschafft ihm Geld, nützt aber die Notlage seines Schuldners aus und lässt sich ungerechtfertigt hohe Zinsen oder andere unverhältnismässig grosse Vorteile versprechen. Das ist Wucher. Wird diese Vereinbarung in Zürich geschlossen, so steht der Gläubiger unter den scharfen Wucherbestimmungen des zürcherischen Strafgesetzbuches. Kommt dagegen die Übereinkunft z. B. in Genf zustande, so behelligt der Staatsanwalt den Gläubiger nicht, weil die romanischen
Rechte im allgemeinen noch auf dem Standpunkt der sog. Wucherfreiheit stehen und ihr Strafrecht keine Bestimmungen gegen den Wucher enthält. — Straflosigkeit ist die zunächst in die Erscheinung tretende, notwendige Konsequenz des Satzes nulla poena sine lege. Gewiss urteilt der Genfer moralisch über den Wucherer nicht anders als der Zürcher. Aber auf die sittliche Wertung einer menschlichen Handlung kommt es hier nicht an. Mag ein Verhalten noch so unehrenhaft und sittlich minderwertig sein —solange das Strafgesetz schweigt, ist eine richterliche Verurteilung nicht möglich. Sie würde das strafrechtliche Dogma: keine Strafe ohne Gesetz verletzen.
Um ein eigentliches Dogma in all seiner Starrheit handelt es sich. Und die schweizerische Rechtsprechung im besondern hält — von einer einzigen, später zu erörternden Ausnahme abgesehen — mit unverbrüchlicher Treue an ihm fest. Aber gerade weil es sich um ein fast starr gewordenes Prinzip handelt, dem gegenüber der Richter das Nachdenken verlernt hat, ist es die hohe Pflicht der Wissenschaft, den Satz kritischer Nachprüfung und Wertung zu unterziehen. Versucht man das, so wird man mit Notwendigkeit zu der eigenartigen Geschichte des Satzes nulla poena sine lege hingeführt. Aus seiner Entstehung und Entwicklung eröffnet sich sein Sinn. Dabei zeigt die geschichtliche Betrachtung, dass der Satz nicht auf einen einheitlichen Gedankengang zurückgeführt werden kann. Verschiedene, zum Teil nur lose miteinander zusammenhängende Überlegungen haben ihn sich bilden lassen;
Die Formel nulla poena sine lege liesse ein hohes Alter des Satzes vermuten. Das trifft jedoch nicht zu. Der Gedanke, dass keine Strafe ohne Gesetz ausgesprochen werden sollte, war dem alten Strafrecht nicht bekannt, ja er konnte z. B. im römischen und germanischen Recht keinen Raum finden, wenigstens nicht als ein das ganze Strafrecht beherrschendes Prinzip. Solange die magistratische Machtvollkommenheit fast schrankenlos war, solange die Strafgesetzgebung nur sehr unvollkommen ausgebildet war, musste die Rechtsfindung vor allem beim Richter stehen. Seine Strafgewalt war nur für kleine Gebiete gesetzlich gebunden. Überlegungen des Naturrechts
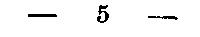 und der Moral leiteten ihn und zu Willkür und richterlicher
Zuchtlosigkeit war nur ein Schritt. Noch weniger als im römischen
konnte im frühen germanischen Recht der Satz: keine
Strafe ohne Gesetz zur Geltung kommen. Die frühe Zeit kannte
überhaupt keine staatliche Strafe und später war die Willkürmacht
des karolingischen Königtums der Rechtssetzung in
unserm heutigen Sinne keineswegs günstig. Erst mit dem Ausbau
des Strafrechts durch die grossen Gesetzbücher aus der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts —die Bambergensis (1507),
die brandenburgische Halsgerichtsordnung (1516) und namentlich
die Peinliche Gerichtsordnung Karis V. (1532) —
konnte sich unser Satz hervorwagen. Aber es war erst ein
schüchterner Versuch, der, es nicht dazu brachte, die notwendigen
Konsequenzen zu ziehen. Die Carolina z. B. weist
den Richter da, wo das Strafgesetz lückenhaft ist, ausdrücklich
auf die Rechtsbildung durch Analogie hin (Art. 105). Der Satz:
keine Strafe ohne Gesetz war damit von allem Anfang an dem
Untergang verfallen, und es ist nachgewiesen, dass die gemeinrechtliche
Praxis ihn bald genug zerstört hat. Recht und
Politik der damaligen Zeit widerstrebten ihm und auch im
Volksbewusstsein fand er wohl keine Stütze. Erst drei Jahrhunderte
später, als der Satz längst in andern Rechtskreisen
seine Geltung sich erobert hatte, fand er auch in Deutschland
und der Schweiz volle Anerkennung.
und der Moral leiteten ihn und zu Willkür und richterlicher
Zuchtlosigkeit war nur ein Schritt. Noch weniger als im römischen
konnte im frühen germanischen Recht der Satz: keine
Strafe ohne Gesetz zur Geltung kommen. Die frühe Zeit kannte
überhaupt keine staatliche Strafe und später war die Willkürmacht
des karolingischen Königtums der Rechtssetzung in
unserm heutigen Sinne keineswegs günstig. Erst mit dem Ausbau
des Strafrechts durch die grossen Gesetzbücher aus der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts —die Bambergensis (1507),
die brandenburgische Halsgerichtsordnung (1516) und namentlich
die Peinliche Gerichtsordnung Karis V. (1532) —
konnte sich unser Satz hervorwagen. Aber es war erst ein
schüchterner Versuch, der, es nicht dazu brachte, die notwendigen
Konsequenzen zu ziehen. Die Carolina z. B. weist
den Richter da, wo das Strafgesetz lückenhaft ist, ausdrücklich
auf die Rechtsbildung durch Analogie hin (Art. 105). Der Satz:
keine Strafe ohne Gesetz war damit von allem Anfang an dem
Untergang verfallen, und es ist nachgewiesen, dass die gemeinrechtliche
Praxis ihn bald genug zerstört hat. Recht und
Politik der damaligen Zeit widerstrebten ihm und auch im
Volksbewusstsein fand er wohl keine Stütze. Erst drei Jahrhunderte
später, als der Satz längst in andern Rechtskreisen
seine Geltung sich erobert hatte, fand er auch in Deutschland
und der Schweiz volle Anerkennung.
England ist die eigentliche Heimat des Satzes, und nichts ist für seinen Sinn aufschlussreicher als die Art, wie er im englischen Recht entstand. "The keystone of English liberty" haben ihn englische Schriftsteller genannt. Die Magna Charta, die König Johann im Jahre 1215 von den Grossen seines Reiches als eine Art Friedensvertrag abgetrotzt wurde, proklamierte ihn. Der König garantierte darin jedem freien Bürger, dass Freiheits- und Vermögensstrafen nur auf Grund eines Gesetzes verhängt und nach Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens vollzogen werden dürfen.1) Damit war die Grundlage
für eine Entwicklung gelegt, die sich nicht auf strafrechtlichem Gebiete, sondern im Staatsrecht vollziehen sollte, eine Entwicklung, die dann allerdings ihre Auswirkung in bestimmten strafrechtlichen Regeln zeigen musste. — Englische Ansiedler brachten den Satz im 17. Jahrhundert nach Nord-Amerika und hier erfolgte seine endgültige staatsrechtliche Gestaltung. Freilich erst allmählich. Im Oktober 1774 erliess der Kongress von Philadelphia eine Erklärung der allgemeinen, unentziehbaren, nur durch Gesetz beschränkbaren Menschenrechte. Zu ihnen gehört das Recht der persönlichen Freiheit, die Möglichkeit der strafrechtlichen Verurteilung lediglich auf Grund des Gesetzes. Die amerikanischen Verfassungen übernahmen den Satz und verpflanzten ihn damit aus dem Gebiet der rechtsphilosophischen Forderungen in den Kreis des positiven Rechts.
Damit war eine Entwicklung zum Abschluss gelangt, die bald genug ihre Wirkungen auch in der europäischen Welt zur Geltung brachte. Vor allem in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte durch die französische Nationalversammlung von 1789. Sie stellte den Satz auf: Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée (Art. 8). Die Verfassung von 1791 gab ihm die endgültige gesetzliche Fixierung, und die später erlassenen Verfassungen und Strafgesetzbücher übernahmen ihn. Dass Frankreich das nordamerikanische Vorbild, insbesondere die Verfassung Virginiens, kannte und benutzte, steht fest, ging doch in der Nationalversammlung die Anregung, eine Erklärung der Menschenrechte zu erlassen, von Lafayette aus, der lange Jahre in Nordamerika für die Freiheit der Kolonien mitgekämpft und die amerikanischen Ideen in sich aufgenommen hatte. — Mit dem Hinweis auf das amerikanische Vorbild wird man aber für Frankreich der Aufstellung des Satzes: keine Strafe ohne Gesetz nicht voll gerecht. Ein anderes Moment wirkte gestaltend mit: Die Lehre Montesquieus. Zu der staatsrechtlich politischen Überlegung gesellte sich eine Begründung, die zwar auch politischen Ursprungs ist. und auf die Garantie der politischen Freiheit abzielt, aber in ihrer Durchführung stark formal juristisch wirkte. Montesquieus Lehre von der Gewaltentrennung
nahm dem Richter die ihm bisher zugestandene oder mindestens von ihm beanspruchte rechtserzeugende Gewalt, "Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi." Der zuchtlos gewordene Richterstand musste dem Gesetz unterworfen werden. Jede selbständige, über das geschriebene Gesetz irgendwie hinausgehende richterliche Tätigkeit — namentlich ausdehnende Auslegung und Rechtserzeugung durch Analogieschluss — waren verpönt. Um das erträglich zu machen, behalf man sich mit der Fiktion, die Gesetze seien klar und vollständig oder man proklamierte wenigstens die Forderung der Gesetzesvollkommenheit. Für das Gebiet des gesamten Rechtes sollte das gelten. Im Strafrecht musste diese Anschauung mit Notwendigkeit zu dem Satz nulla poena sine lege führen. Nur ist bei dieser Begründung von dem hohen Gedanken, dass es um den Schutz eines allgemeinen Menschenrechtes, der Freiheit, geht, wenig mehr zu spüren.
So ergab sich auch aus Montesquieus Lehre im Zusammenhang mit dem Satz von der Vollkommenheit der Gesetze die strafrechtliche Regel nulla poena sine lege. Aber ihre Geschichte zeigt, dass sie noch eine dritte Wurzel hat. Eine rein strafrechtliche, allerdings psychologisch orientierte Lehre hat gleichfalls den Satz verkündet: Anselm Feuerbach in seiner Theorie des psychologischen Zwanges. Feuerbach, der grosse Erneuerer der deutschen Strafrechtswissenschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts, geht davon aus, dass der im Menschen liegende Trieb, Verbrechen zu begehen, dadurch aufgehoben werden kann, "dass Jeder weiss, auf seine Tat werde unausbleiblich ein Übel folgen, welches grösser ist als die Unlust, die aus dem nicht befriedigten Antrieb zur Tat entspringt" (Lehrbuch des Peinlichen Rechts, §13). Diese Abschreckung vor dem Verbrechen geschieht einmal durch die Androhung gesetzlicher Strafen und, wenn eine Missetat verübt worden ist, durch die Zufügung der angedrohten Strafen. Soll aber die Abschreckung durch das Strafgesetz wirksam sein, so muss, erklärt Feuerbach, jedermann gesetzliche Klarheit über die Folgen seiner Handlungen besitzen. "Jede Zufügung einer Strafe setzt ein Strafgesetz
voraus," und Feuerbach war es auch, soweit ich sehe, der als Erster seine Regel in die uns heute geläufige Form: nulla poena sine lege brachte (§ 20 des Lehrbuches).
II.
Heute steht der Satz: keine Strafe ohne Gesetz in der Wissenschaft, der Gesetzgebung und der Praxis fast unbestritten da. Eine lange historische Entwicklung und wissenschaftliche Überzeugung tragen ihn. Über die verschiedenen Wurzeln, die er hat, ist man freilich nicht allgemein im klaren, und die Grunde, die ihn entstehen liessen, haben heute teilweise auch ihre Überzeugungskraft verloren:
Wir anerkennen Feuerbachs Theorie vom psychologischen Zwang wenigstens in ihrer Ausschliesslichkeit nicht mehr. Und die aus Montesquieus Lehre von der Gewaltentrennung abgeleitete Begründung ist uns gänzlich fremd geworden. So bleibt nur mehr die auf England und Amerika zurückgehende Anschauung, dass der Satz für jeden einzelnen Bürger eine Garantie der persönlichen Freiheit und Unverletzlichkeit gegenüber dem Staate bedeutet. Nur wenn ein gesetzlich festgestelltes, genau umschriebenes Delikt verübt wird, sollen Freiheit und Unverletzlichkeit entfallen.
Auf diesen Grundlagen bedürfen jetzt zunächst zwei Fragen der Abklärung:
Man hat auch neuerdings noch behauptet, der Satz nulla poena sine lege fordere, dass ein bestimmtes Verhalten durch ein verfassungsmässig zustande gekommenes eigentliches Gesetz unter Strafe gestellt sein müsse. Nur dann könne eine Bestrafung erfolgen. Sie sei unzulässig auf Grund von Verordnungen, die z. 13. von der Regierung — dem Bundesrat, einer kantonalen Regierung — erlassen seien. Das ist ebenso falsch wie töricht. Eine unübersehbare Menge von im Verordnungsrecht aufgestellten Straftatbeständen würden damit als unanwendbar erklärt, Tausende von Strafentscheiden, die z. B. auf Grund der seit dem Kriege erlassenen Verordnungen ausgesprochen wurden, wären als dem Rechte nicht gemäss erwiesen. Davon kann gar keine Rede sein. In dem Satze: keine
Strafe ohne Gesetz umfasst der Ausdruck "Gesetz" alle geschriebenen strafrechtlichen Normen, die aus einer verfassungsmässig anerkannten Rechtsquelle fliessen und mit verbindlicher Kraft ausgestattet sind. Ob sie in einem konstitutionellen Gesetz oder bloss in einer Regierungsverordnung stehen, ist ganz gleichgültig. Im übrigen gilt dann aber der Satz restlos für das ganze strafrechtliche Gebiet. Ob einer einen Mord, einen Diebstahl verübt, ob er nachts lärmend durch die Strassen zieht oder die nächtliche Ruhe durch musikalische Produktionen stört — Strafe kann ihn nur treffen, wenn sein Verhalten unter eine strafrechtliche Vorschrift fällt, mit einer bestimmten Strafe bedroht ist. Dabei ergibt sich noch ein anderes Problem, das in der Geschichte unseres Rechtssprichwortes eine Entwicklung für sich durchgemacht hat. Es ist die Frage der Rückwirkung neuer Gesetze, die Frage, ob ein Strafgesetz, das heute entsteht und ein bisher nicht strafbares Verhalten für strafbar erklärt, auch auf Handlungen Anwendung finden darf, die früher verübt wurden. Von Wissenschaft und Gesetzgebung wird heute diese Frage fast einheitlich verneint. In den Gesetzen gelangt das z. B. durch die Formel zum Ausdruck: "Eine Handlung kann nur dann mit einer Strafe belegt werden, wenn diese Strafe gesetzlich bestimmt war, bevor diese Handlung begangen wurde" (Deutsches StGB §2; zürcherisches StGB §1). Das ist richtig. Es gehört zum Wesen des Satzes nulla poena sine lege. Solange man ihn als einen Glaubenssatz anerkennt, muss man es in den Kauf nehmen, dass z. B. der Wucherer, der sein unsauberes Geschäft in einem Lande ohne Wuchergesetzgebung treibt, straflos ausgeht und nicht nachträglich noch vor den Strafrichter gestellt wird, wenn inzwischen eine Gesetzesänderung eingetreten ist. Wenn der Grundsatz nulla poena sine lege wirklich ein allgemeines Menschenrecht, ein Freiheitsrecht verbrieft, dann soll er auch nicht in einem Einzelfall durch die Gesetzgebung von einem Tag zum andern zu schanden gemacht werden können. Nur auf zukünftige Handlungen soll ein neues - Strafgesetz zur Anwendung gelangen. Was vor seinem Inkrafttreten begangen wurde, mag es auch sittlich minderwertig sein, muss von Strafe verschont bleiben. Freilich ist dieser Grundsatz
der Nichtrückwirkung neuer strengerer Gesetze erst allmählich zur Geltung gelangt. Die amerikanischen Verfassungen —zuerst diejenige Marylands vom Jahre 1776 — haben ihn proklamiert und auf dem Weg über die französischen Revolutionsverfassungen hat er seinen Einzug in die europäischen Rechte gehalten. Unbestritten ist der Satz von der Nichtrückwirkung allerdings auch .heute nicht (Binding, Traeger u. à.) Aber er muss gelten als Schutz der Bürger gegen mögliche Willkürakte der Regierungen. In der leidenschaftlichen Sprache der Revolution hat die französische Verfassung vom 24. Juni 1793 (Art. 14) den Satz verkündet: "La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât, serait une tyrannie; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime."
III.
Ist man sich über den Umfang des Satzes: keine Strafe ohne Gesetz klar geworden, so ergibt sich die Notwendigkeit, zu untersuchen, wie sich seine Auswirkung in der Rechtsanwendung gestaltet. Dabei muss man davon ausgehen, dass der Satz eine Beschränkung des Richters darstellt, dass der Richter nicht mehr wie früher in magistratischer Machtvollkommenheit frei darüber befinden kann, ob und wie er auf ein menschliches Verhalten mit einer Strafe reagieren will. Der Richter ist, was heute jedem fast selbstverständlich erscheint, an das Strafgesetz gebunden. Allein das ist nur der Ausgangspunkt für eine Reihe von Folgerungen, die durch die Wissenschaft und die Rechtsprechung aus dem Satz nulla poena sine lege abgeleitet worden sind. Erst die Betrachtung dieser Konsequenzen ergibt ein fertiges Bild von der Tragweite unseres Rechtssprichwortes.
Zunächst führt der Satz: keine Strafe ohne Gesetz zu dem Schluss, dass im Strafrecht die Bildung von Gewohnheitsrecht verpönt sein soll, ja im Grunde unmöglich ist. Das Gewohnheitsrecht, das auf andern Rechtsgebieten, namentlich im Zivilrecht, eine immer wieder zu erschliessende Rechtsquelle darstellt, soll im Strafrecht keinen Raum haben. Wenn der Gesetzgeber in möglichst scharfer Umschreibung des Tatbestandes und der
Strafdrohung Strafsatzungen erlassen hat, so soll dagegen nicht eine widersprechende Übung aufkommen dürfen. Auch wenn in weiten Kreisen eines Volkes sich die Überzeugung gebildet hat, dass bestimmte, vielleicht in hohem Masse verwerfliche Handlungen eine Strafe verdienen, so darf der Richter, solange der Gesetzgeber nicht gesprochen hat, auch einer einheitlichen und sachlich berechtigten Volksüberzeugung nicht nachgeben. Aber ebensowenig ist er befugt, einen Angeklagten, auf den der Tatbestand eines Strafgesetzes zutrifft, mit der Begründung freizusprechen, das anzuwendende Gesetz widerspreche der Volksüberzeugung, es sei alt und schlecht geworden oder immer schlecht gewesen. In Frankreich und über Frankreich hinaus hat der Gerichtspräsident Magnaud in Câteau-Thierry dadurch Berühmtheit erlangt, dass er in einer ganz freien und persönlichen Rechtsprechung sich über diese juristischen Glaubenssätze hinwegsetzt und im Einzelfall die gesetzliche Bindung in den Wind schlägt. Er geht, was natürlich niemand bestreiten wird, davon aus, der Richter müsse sich bei seinen Urteilen von der Humanität und der Rücksicht auf die menschliche Solidarität leiten lassen. Das ist ihm der Leitstern seiner richterlichen Tätigkeit geworden und hat ihm den Ehrennamen des ,,bon juge"eingetragen. Bei einer so gestalteten Rechtsprechung, die sich auf eine dem Gesetz entgegenstehende Volksüberzeugung stützen wollte, gelangt man in der Tat dazu, Gewohnheitsrecht und Gerichtsgebrauch auf den Thron zu heben. Das könnte im Einzelfall menschlich überaus sympathisch sein, ganz besonders, wenn hinter einem solchen Urteilsspruch eine kraftvolle und einwandfreie Richterpersönlichkeit steht. Allein die Rechtssicherheit des Einzelnen und der Volksgemeinschaft geht dabei in die Brüche und richterlicher Willkür wird ein breites Tor aufgetan. Um anarchische Zustände zu verhindern, muss man daher an der Ablehnung gewohnheitsrechtlicher Bildung neuer strafrechtlicher Sätze unbedingt festhalten. — Das Verhältnis des Strafrichters zum Gewohnheitsrecht bedarf jedoch noch weiterer Abklärung: Vom Strafrecht führen Verbindungswege zu den andern Rechtsteilen hinüber. Seine Sätze sind vielfach abhängig von privatrechtlichen, verwaltungsrechtlichen
und andern Normen, und wenn in diesen Rechtsgebieten gewohnheitsrechtliche Bildungen ihre Wirkung entfalten, so muss das Strafrecht sie auch für seinen Teil anerkennen. Wenn durch Gewohnheitsrecht die Normen über Eigentum und Besitz umgestaltet würden, so müssten sich auch die strafrechtlichen Tatbestände des Diebstahls, der Eigentumsschädigung usw. darnach richten. Wenn gewohnheitsrechtlich neue Berufsrechte oder neue amtsrechtliche Befugnisse entstehen, so wirken sie unter Umständen auf das Strafrecht hinüber. Sobald z. B. durch sicheres Gewohnheitsrecht anerkannt wäre, dass der Arzt unter bestimmten Umständen zur Vornahme einer Abtreibung berechtigt ist, so müsste auch eine Bestrafung solcher Handlungen entfallen. Dabei hat das Gewohnheitsrecht die Strafnorm über die Abtreibung an sich nicht geändert oder gar aufgehoben, aber die auf einem andern Gebiet gewohnheitsrechtlich ergangene Wandlung wirkt im einzelnen Fall in das Strafrecht hinüber. — Eigenartige Rechtszustände in einzelnen Teilen der Schweiz haben ferner der schweizerischen Rechtsprechung noch ein anderes Problem aufgegeben, dessen Lösung vorläufig nur dadurch möglich scheint, dass man aller Lehre zum Trotz doch wieder zum Gewohnheitsrecht Zuflucht nimmt. Uri und Nidwalden besitzen keine Strafgesetzbücher. Es bestehen in diesen Kantonen nur wenige, aus den alten Landbüchern überkommene Strafbestimmungen und daneben spärliche Sondergesetze strafrechtlichen Inhalts. Wollte man auch hier auf der strengen Durchführung des Satzes: keine Strafe ohne Gesetz beharren, so müssten diese beiden alten schweizerischen Länder zu einem Dorado für das Verbrechertum werden. Bei der Behandlung staatsrechtlicher Rekurse hatte das Bundesgericht mehrfach Gelegenheit, sich zu dieser Frage auszusprechen. Es hat mehrere Lösungen für zulässig erklärt; vor allem anerkannt, dass ungeschriebenes Gewohnheitsstrafrecht Anwendung finden dürfe, wo Gesetzesrecht fehlt. (Entscheidungen des Bundesgerichts Bd. 8, S. 482; Bd. 19, S. 103; Bd. 391, S. 42). Einschränkend hat dann allerdings das Bundesgericht gelegentlich hinzugefügt, eine Bestrafung dürfe in diesen Kantonen ohne Strafgesetzbuch nur eintreten, wenn sie "nicht
 über die vernünftigerweise noch denkbare Ausdehnung der
Grenzen des strafbaren Unrechts hinausgehe"(Bd. 461, S. 206).
Das ist nicht unrichtig. Aber gerade der Hinweis auf die "vernünftige"
Umgrenzung des strafbaren Unrechts zeigt, wie
mangelhaft eine derartige Gestaltung des Strafrechts ist, denn
es ist ein aussichtsloses Bemühen, in jedem Falle allgemein
gültig zu bestimmen, wo die Grenze zwischen Vernunft und
Unvernunft liegt. Hier hilft nur der den Richter bindende
gesetzgeberische Satz. In einem andern Falle hat das Bundesgericht
noch die weitere Lösung für zulässig erklärt, dass der
strafgesetzlose Kanton sich an die Gesetze eines andern Kantons
anlehne, ja sie direkt gewohnheitsrechtlich rezipiere (Entscheidungen
Bd. 7, S. 299). Auch das ist natürlich ein schwacher
und bedenklicher Notbehelf, und es bleibt ein geradezu unerträglicher
Zustand, dass es heute noch in der Schweiz Landesgegenden
gibt, in denen niemand genau weiss, wo die Grenzen
zwischen straffreiem und strafbarem Handeln liegen. Wenn
die Kantone Uri und Nidwalden die Kraft zur Schaffung eines
Strafgesetzes nicht finden, kann auch hier nur das eidgenössische
Strafgesetzbuch die notwendige Hilfe bringen.
über die vernünftigerweise noch denkbare Ausdehnung der
Grenzen des strafbaren Unrechts hinausgehe"(Bd. 461, S. 206).
Das ist nicht unrichtig. Aber gerade der Hinweis auf die "vernünftige"
Umgrenzung des strafbaren Unrechts zeigt, wie
mangelhaft eine derartige Gestaltung des Strafrechts ist, denn
es ist ein aussichtsloses Bemühen, in jedem Falle allgemein
gültig zu bestimmen, wo die Grenze zwischen Vernunft und
Unvernunft liegt. Hier hilft nur der den Richter bindende
gesetzgeberische Satz. In einem andern Falle hat das Bundesgericht
noch die weitere Lösung für zulässig erklärt, dass der
strafgesetzlose Kanton sich an die Gesetze eines andern Kantons
anlehne, ja sie direkt gewohnheitsrechtlich rezipiere (Entscheidungen
Bd. 7, S. 299). Auch das ist natürlich ein schwacher
und bedenklicher Notbehelf, und es bleibt ein geradezu unerträglicher
Zustand, dass es heute noch in der Schweiz Landesgegenden
gibt, in denen niemand genau weiss, wo die Grenzen
zwischen straffreiem und strafbarem Handeln liegen. Wenn
die Kantone Uri und Nidwalden die Kraft zur Schaffung eines
Strafgesetzes nicht finden, kann auch hier nur das eidgenössische
Strafgesetzbuch die notwendige Hilfe bringen.
Trotz Uri und Nidwalden darf also die Forderung, dass im Strafrecht für das Gewohnheitsrecht kein Raum sein soll, nicht aufgegeben werden. Und auf der gleichen Linie liegt ein anderes Verbot: auch der Richter darf, selbst wenn er ein Gesetz als lückenhaft erkannt hat, niemals zur Lückenausfüllung schreiten und in Anmassung eigener Machtvollkommenheit neues Recht setzen. Im Privatrecht ist ihm das, wenn ihn Gesetz und Gewohnheitsrecht im Stiche lassen, durch den Art. 1 des Zivilgesetzbuches ausdrücklich erlaubt. Im Strafrecht, wo es um die höchsten Persönlichkeitsgüter des Menschen geht, ist die Ergänzung eines vielleicht wirklich mangelhaften Gesetzes durch den Richter nicht zu ertragen. Der Richter ist ein Einzelner, ein dem Irrtum unterworfener Mensch und wenn ihm z. B. eine vom Gesetz nicht getroffene Handlung strafwürdig erscheint, so ist das noch lange nicht Grund genug, über einer Mitmenschen Strafe zu verhängen. Andere Stimmen sind auch hier laut geworden. Wiederum erhebt sich die Figur des französischen
Richters Magnaud und in Deutschland hat namentlich die sog. freirechtliche Bewegung die freie Rechtsfindung durch den Richter, das Richterkönigtum, auf den Schild erhoben. Das ist mindestens im Strafrecht, im wesentlichen aus den Gründen, die gegen die Anwendung von Gewohnheitsrecht gelten, unmöglich. Die objektive, im Gesetz zum Ausdruck gelangte Rechtsordnung hat zu gelten, nicht subjektives Ermessen. — Auf eigenartige Verhältnisse, die sich in einem schweizerischen Kanton gezeigt haben, ist auch hier wiederum hinzuweisen. Der Kanton Aargau besitzt ein sog. Zuchtpolizeigesetz aus dem Jahre 1868, das aber nicht in der Manier der modernen Gesetzgebung die einzelnen strafbaren Handlungen vollständig umschreibt, sondern nur Deliktsnamen nennt. Bestraft werden sollen Ehrverletzungen, körperliche Angriffe auf Personen, Verletzungen von öffentlichem und privatem Eigentum, Beschädigungen durch Vertrauensmissbraucb und namentlich Störungen der öffentlichen Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit. Will der Richter diese Bestimmungen anwenden, so wird ihm auf Schritt und Tritt die Lückenhaftigkeit einer solchen Gesetzgebung klar. Mit blossen Auslegungskünsten kommt er in vielen Fällen zu keinem greifbaren Ergebnis, nur richterliche Rechtsetzung, Lückenausfüllung, könnte, wenn sie erlaubt wäre, hier helfen. Leider haben die aargauischen Gerichte diesen Weg beschritten, und üppig wuchernde richterliche Phantasie hat z. B. einen jungen Mann bestraft, der beim Besuche des Gottesdienstes in der Kirche einen ihm nicht zukommenden Platz eingenommen und dadurch die der Kirchenpflege gebührende Achtung verletzt habe. Ein Gericht hat einen Pfarrer wegen "Verletzung der öffentlichen Ordnung"bestraft, der unbefugt Liebesgaben für die durch den Bergsturz von Eim Beschädigten sammelte. Und unter dem gleichen Titel wurde ein Apotheker verurteilt, der sich in allgemeinen Schmähungen und Schimpfereien über den Staat Aargau, seine Einrichtungen und Zustände ergangen hatte. Alle diese und zahlreiche andere Urteile hat das Bundesgericht wegen Verletzung des aargauischen Verfassungssatzes nulla poena sine lege aufgehoben. Es hätte nach meiner Überzeugung in seiner Praxis weiter gehen
und überhaupt den Satz, dass "Vergehen gegen die öffentliche Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit" strafbar seien, in seiner allgemeinen Formulierung als verfassungswidrig bezeichnen sollen. Nur richterliche Lückenausfüllung kann ihm einen Inhalt geben. Sie aber wird durch die strafrechtliche Lehre verpönt.1)
Am schwierigsten ist die Stellungnahme zu einer letzten Folgerung, die man aus dem Satz: keine Strafe ohne Gesetz abgeleitet hat. Eine oberflächliche Lehre behauptet nämlich, der Satz führe dazu, jede Analogie und darüber hinaus jede ausdehnende Auslegung bei der Anwendung der Strafgesetze auszuschliessen. Man muss freilich davon ausgehen, dass das moderne Strafgesetz den Anspruch erhebt, ein vollständiges Gesetz zu sein, das eine Bestrafung nur auf Grund bestimmter Vorschriften will. Deshalb sollen gewohnheitsrechtliche Bildungen und die richterliche Schaffung ganz neuer Rechtssätze ausgeschlossen sein. Für die Fragen nach der Analogie und nach der ausdehnenden Auslegung ist aber damit noch nichts gewonnen. Die Stellungnahme zu ihnen macht vorab eine möglichst scharfe Scheidung zwischen beiden notwendig. Man kann sie dahin vornehmen: Die sog. analoge Rechtsanwendung, die Rechtsbildung auf dem Wege der Analogie stützt sich stets auf einen bestehenden Gesetzessatz. Zeigt sich bei der Rechtsanwendung seine Ergänzungsbedürftigkeit, so versucht der Richter das allgemeinere Rechtsprinzip festzustellen, dem der Gesetzessatz seine Entstehung verdankt und leitet daraus die das mangelhafte Gesetz ergänzende Rechtsnorm ab. Das ist eine Gedankenarbeit, die der Zivilrichter sehr häufig leisten muss. Er deckt damit gewissermassen einen latenten Rechtssatz auf. Er geht zwar über das bestehende Gesetz, nicht aber über das Recht hinaus. Darf auch der Strafrichter in dieser Weise vorgehen? Immer wieder kann in der Praxis diese Frage an ihn herantreten. Ein besonders lehrreiches Beispiel ist hier die Bestrafung der
unrechtmässigen Entziehung elektrischer Kraft aus einer, fremden Anlage als Diebstahl. Die neuere Gesetzgebung hat daraus einen neuen, dem Diebstahl ähnlichen Tatbestand geformt. Wo er aber noch fehlt, muss der Richter entscheiden, ob er den Elektrizitätsdieb strafen kann oder nicht. Hält er sich an das Gesetz, so muss er den Täter freisprechen, denn nach der gesetzlichen Umschreibung kann nur eine körperliche Sache gestohlen werden und diese Eigenschaft kommt der Elektrizität nicht zu. Trotzdem haben Gerichte, unter Zuhilfenahme eines Analogieschlusses, gestraft, während z. B. das deutsche Reichsgericht eine solche Lösung abgelehnt habe. Von der Stellung aus, die ich zu dem Satz nulla poena sine lege einnehme, muss ich der Ablehnung beipflichten. Nicht Billigkeits- und Zweckmässigkeitsrücksichten auf den einzelnen Fall dürfen den Ausschlag geben. Wenn der Elektrizitätsdieb ohne gesetzliche Grundlage bestraft wird, so hat der Richter aus eigener Machtvollkommenheit einen neuen Straftatbestand errichtet und gerade das soll ihm um der Rechtssicherheit willen versagt sein. Der Richter darf keine neuen Deliktstatbestände bilden, er darf auch keine Verschärfung bestehender Tatbestände vornehmen. Insoweit ist ihm der Analogieschluss im Strafrecht versagt, während er in anderer Richtung, z. B. bei den Strafmilderungsgründen, auch in der Anwendung des Strafgesetzes als erlaubt gilt. — Anders liegen die Dinge bei der Gesetzesinterpretation, insbesondere bei der ausdehnenden Auslegung, die man dem Strafrichter gelegentlich verbieten zu müssen glaubte. Im Gegensatz zur sog. analogen Rechtsanwendung bleibt alle Auslegung im Rahmen eines bestehenden Gesetzessatzes. Sie holt mit allen Mitteln der juristischen Kunst aus ihm heraus, was nach Wortlaut und Sinn in ihm liegt. Was der Gesetzgeber sich seinerzeit über die Tragweite des von ihm aufgestellten Satzes gedacht hat, ist nicht ausschlaggebend, in den meisten Fällen auch gar nicht einwandfrei feststellbar. Massgebend ist nur, ob es grammatikalisch und logisch überhaupt möglich ist, ein bestimmtes menschliches Verhalten einem bestimmten strafrechtlichen Gesetzessatz zu unterstellen. So verhält sich denn auch die Rechtsprechung, obschon dem Richter gelegentlich
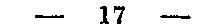 aus seiner Studienzeit im Ohr die unzutreffende Regel nachklingt,
im Strafrecht sei die ausdehnende Auslegung verpönt.
Richtiger juristischer Takt hat z. B. die Bestimmung des
zürcherischen Rechtes (Strafgesetzbuch §148), dass Eltern und
Pflegeeltern, die ihre Pflichten "in bezug auf die Besorgung
oder Verpflegung" ihrer Kinder gröblich verletzen, bestraft
werden sollen, immer weiter ausgedehnt. Man bestraft nicht
nur die Eltern, die ihr Kind schlecht behandeln, es in Kleidung,
Unterkunft und Nahrung vernachlässigen, es im Schmutz verkommen
lassen. Man hat auch den geschiedenen Ehemann und
den unehelichen Vater bestraft, wenn sie böswillig die ihnen
auferlegten Unterhaltsbeiträge für ihre Kinder nicht bezahlten.
Nur mit einer ausdehnenden Auslegung des Gesetzestextes
kann man zu diesem Resultat gelangen.
aus seiner Studienzeit im Ohr die unzutreffende Regel nachklingt,
im Strafrecht sei die ausdehnende Auslegung verpönt.
Richtiger juristischer Takt hat z. B. die Bestimmung des
zürcherischen Rechtes (Strafgesetzbuch §148), dass Eltern und
Pflegeeltern, die ihre Pflichten "in bezug auf die Besorgung
oder Verpflegung" ihrer Kinder gröblich verletzen, bestraft
werden sollen, immer weiter ausgedehnt. Man bestraft nicht
nur die Eltern, die ihr Kind schlecht behandeln, es in Kleidung,
Unterkunft und Nahrung vernachlässigen, es im Schmutz verkommen
lassen. Man hat auch den geschiedenen Ehemann und
den unehelichen Vater bestraft, wenn sie böswillig die ihnen
auferlegten Unterhaltsbeiträge für ihre Kinder nicht bezahlten.
Nur mit einer ausdehnenden Auslegung des Gesetzestextes
kann man zu diesem Resultat gelangen.
IV.
Überblickt man die geschichtliche Entwicklung und die dogmatische Ausgestaltung des Satzes: keine Strafe ohne Gesetz, so ergibt sich mit zwingender Kraft das Resultat: er gehört zu den Grundlehren des heutigen Strafrechts, er muss auch von den Strafgesetzbüchern der Zukunft übernommen werden. Das ist auch die fast allgemein geteilte Meinung. Immerhin hat, wie fast überall in der Jurisprudenz, auch gegenüber diesem Satz der Widerspruch sich geregt. Zwei Stimmen will ich erwähnen. Das geltende dänische Strafgesetzbuch und ebenso zwei neuere dänische Gesetzesentwürfe aus den Jahren 1912 und 1917 anerkennen ausdrücklich die Gesetzesanalogie. Der Richter soll Handlungen bestrafen, die "gesetzlich mit Strafe bedroht oder solchen Handlungen gänzlich gleichzustellen sind." Man hat diese Ordnung mit dem hohen Mass von Vertrauen, das der dänische Gesetzgeber seinem Richter entgegenbringt, begründet. — In der Literatur ist dann vor allem Karl Binding temperamentvoll und geistreich gegen den Satz nulla poena sine lege aufgetreten. Er wendet sich gegen die Auffassungen, die das Dogma entstehen liessen, gegen Feuerbachs Loure vom psychologischen Zwang, gegen Montesquieus Fessel, die den Richter zum Sklaven macht, er verneint auch, dass es
 sich um den notwendigen Schutz eines Menschen- und Freiheitsrechtes
handelt. "Wer Verständnis für das Verbrecherleben,"
sagt Binding, "und dafür besitzt, dass die Gesetzgebung demselben
nicht in alle Schlupfwinkel zu folgen vermag, wer empfindet,
was es heisst, schwere Missetaten bloss in Ermangelung
des Gesetzesbuchstabens straflos zu lassen, der muss dem
Richter die Verurteilung auf Grund der Analogie nicht nur
freigeben, sondern sie von ihm fordern. Denn der Richter ist
nicht blindes Werkzeug, sondern lebendiger Vertreter dès
Gesetzgebers für Aufgaben, welche diesem im einzelnen Falle
unlösbar (?) sind — — —" (Handbuch, S. 28).
sich um den notwendigen Schutz eines Menschen- und Freiheitsrechtes
handelt. "Wer Verständnis für das Verbrecherleben,"
sagt Binding, "und dafür besitzt, dass die Gesetzgebung demselben
nicht in alle Schlupfwinkel zu folgen vermag, wer empfindet,
was es heisst, schwere Missetaten bloss in Ermangelung
des Gesetzesbuchstabens straflos zu lassen, der muss dem
Richter die Verurteilung auf Grund der Analogie nicht nur
freigeben, sondern sie von ihm fordern. Denn der Richter ist
nicht blindes Werkzeug, sondern lebendiger Vertreter dès
Gesetzgebers für Aufgaben, welche diesem im einzelnen Falle
unlösbar (?) sind — — —" (Handbuch, S. 28).
Aber diese Worte sind Blendwerk. Die staatliche Notwendigkeit, die Sicherheit der Rechtsprechung widerstreiten einer solchen Auffassung, und ich will noch einmal die Anschauung, von der das heutige Strafrecht geleitet sein muss, zusammenfassen:
Es ist kaum mehr Feuerbachs Theorie vom psychologischen Zwang der Strafgesetze, es ist nicht mehr Montesquieus Lehre von der Gewaltentrennung, die den Satz: keine Strafe ohne Gesetz als notwendige Forderung erscheinen lassen. Es ist das Menschenrecht der Freiheit des Einzelnen gegenüber Willkürakten des Staates und insbesondere der Strafgerichtsbarkeit. Öffnet man dem Strafrichter die Tore des Gewohnheitsrechtes, der freien Rechtsbildung mit und ohne Verwendung von Analogieschlüssen, überlässt man es dem einzelnen Richter, ob er nach seinem subjektiven Ermessen ohne Rücksicht auf das Gesetz einen Missetäter strafen will, dann führt das zur Willkür, zur Anarchie. In ruhigen Zeiten und bei einem hochkultivierten Richterstand, der sich von allen politischen Kämpfen frei zu halten vermöchte, würde schrankenlose richterliche Machtvollkommenheit vielleicht nicht allzu grossen Schaden stiften. Wenn aber politische und soziale Kämpfe toben, dann muss die Rechtsprechung der Strafgerichte nach Menschenmöglichkeit vor der Willkür bewahrt bleiben, dann muss das Gesetz und der Satz nulla poena sine lege dem Richter erst recht zur unübersteigbaren Schranke werden.
Hinweise auf die besondere Literatur über den Satz: keine Strafe ohne
Gesetz: Binding, Handbuch des Strafrechts I (1885), S. 17 ff., 204 ff. Elvers,
Die Bedeutung des Satzes nulla poena sine lege in seiner historischen Entwicklung
(1009). Julliot de la Morandière, De la règle n. p. s 1. (1910).
Schottlaender, Die geschichtliche Entwicklung des Satzes n. p. s. 1. (1911).
Tien Guang-Tsu, Über das Prinzip n. p. s. 1. im modernen Recht (Berner
Dissertation ohne Jahreszahl, wohl 1921). v. Cleric, Der Grundsatz n. p. s. I.
im schweizerischen Strafrecht, Schweiz. Juristen-Zeitung, Bd. 9, S. 329 ff.
Guggenheim, Der Grundsatz n. p. s. 1. im aargauischen Strafrecht, Zeitschrift
für Schweizer Strafrecht, Bd. 1, S. 306 ff.