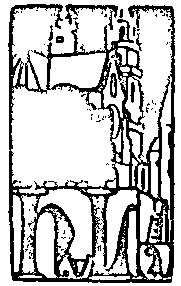WERDEN, SEIN UND VERGEHEN DER SEUCHEN
REKTORATSREDE VON
BASEL 1932 VERLAG HELBING & LICHTENHAHN
Im Wechsel der Zeiten und der Zustandsformen menschlicher Kultur hat das Problem der Infektionskrankheiten seine Bedeutung gewahrt und wird sie in aller Zukunft behaupten. Die gewaltigen Fortschritte der Seuchenbekämpfung, die mit den Namen von Jenner, Semmelweiß, Pasteur, Lister, R. Koch und E. v. Behring unzertrennlich verknüpft sind, vermochten zwar die Verhältnisse räumlich, zeitlich und qualitativ zu verschieben, an der Gesamtlage haben sie nichts geändert, nichts an der Erkenntnis, daß die Menschheit zu einer kontinuierlichen Verteidigung verurteilt ist, die nie erlahmen darf, ohne die mühsam errungenen Teilerfolge wieder preiszugeben. Gerade die Epoche der Entdeckung und Erforschung der pathogenen Mikroben zeitigte als erstes Ergebnis das Gesetz der ätiologischen Spezifität, welches besagt, daß jeder Infektionskrankheit ein besonderer Erreger zugeordnet ist und daß daher auch unsere Maßnahmen mit der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, gegen die sie sich kehren, zu rechnen haben. Ja diese Mannigfaltigkeit hat seit Koch und Pasteur noch erheblich zugenommen; mit der Vervollkommnung der Untersuchungsmethoden traten neuartige, als nosologische Entitäten bisher unbekannte Infektionsprozesse auf den Plan, in ständig wachsender Zahl und sicher noch nicht abgeschlossener Folge, und zwangen zu weiterer Zersplitterung des Arbeitsaufwandes, in der Wissenschaft nicht minder wie in der praktischen Bewirtschaftung der Volksgesundheit.
Wie hat sich diese vielgestaltige Verseuchung des Menschengeschlechtes entwickelt? Auf welche Weise fristet sie ihren Bestand? Dürfen wir hoffen, daß uns
die Natur zu Hilfe kommt, daß sie das, was sie gezeugt, auch wieder vernichtet, daß herrschende Infektionskrankheiten ohne unser Zutun erlöschen werden? Über diese Fragen, die sich in den Titel "Werden, Sein und Vergehen der Seuchen"zusammenfassen lassen, will ich hier sprechen. Sie fanden in den ersten Dezennien der ätiologischen Aera wenig Beachtung. Nicht daß man zu irgendeiner Zeit ihre Tragweite verkannt hätte; aber ihre mehr als rein spekulative Beantwortung setzte die Erreichung eines anderen, näherliegenden und wichtigeren Zieles voraus: die Ergründung des Wesens der vorhandenen Infektionen. Zudem winkte hier positiver Gewinn. Am realen Objekt angreifend, mußten solche Forschungen zu tatsächlichen Resultaten von bleibendem theoretischem und praktischem Wert führen, eine Erwartung, die sich in reichstem Maße erfüllte. So ist diese ganze Richtung wohl zu verstehen; daß sie zunächst die Form eines extremen und einseitigen Ätiologismus, einer bloßen "Ursachenforschung" annahm, war durch den ungeheuren Umfang der zu bewältigenden Aufgaben bedingt. Erst als der Ausbau des plötzlich erschlossenen Gebietes genügend weit gediehen war, konnten andere, zeitweilig verdrängte Ideen wieder zur Herrschaft gelangen: den Dispositionsbegriff, den man über dem Erreger vernachlässigt hatte und auf dessen Bedeutung zuerst C. Rosenbach 1), ein Schüler Koch's, 1891 hinwies, und die Erfassung der Seuchen als natürliche Massenereignisse, die ganz in den Hintergrund getreten war, weil man sich ausschließlich mit dem Zustandekommen der einzelnen Infektion, mit der Untersuchung des Übertragungsmodus
befaßte. Dieser Umschwung hat auch das Problem des "Kommens und Gehens der Epidemien", oder wie es Ch. Nicolle 2) nennt "der Geburt, des Lebens und des Todes der Infektionskrankheiten" an die Oberfläche gebracht und bessere Voraussetzungen für seine rationale Lösung geschaffen.
Die Naturwissenschaft sieht in dem Vorgang, den wir als Infektion bezeichnen, nicht mehr und nichts anderes als das im Tier- und Pflanzenreich weit verbreitete biologische Phänomen des Parasitismus, der Erscheinung, daß gewisse Organismen, die Parasiten, im Körper anderer, ihrer Wirte, zu leben, zu wachsen und sich zu vermehren vermögen. Die Schädigung des Wirtes, seine Erkrankung, ist also sekundär, akzidentell, im Wesen der Infektion nicht begründet, und diese Aussage stützt sich nicht allein auf eine Begriffsbestimmung, die ja unzulänglich sein könnte, sie wird durch eine Tatsache bewiesen, durch die Existenz von latenten Infektionen, von Infektionen ohne Infektionskrankheit. Heute sind diese latenten Infektionen banale, selbst dem Laien als "Bazillenträger" bekannte Prozesse; es ist aber bezeichnend, mit welcher Befremdung ihre erste Feststellung beim Menschen anläßlich der Choleraepidemie in Hamburg i. J. 1891 aufgenommen wurde 3), bezeichnend, weil uns hier die spezifisch medizinische Auffassung vom "Krankheitserreger" entgegentritt, eine Auffassung, die das Gesichtsfeld auf einen einzigen, für den Menschen wichtigen Fall derartiger Wechselbeziehungen einengt.
Aus der biologischen Definition des Infektionsbegriffes
folgt unmittelbar, daß sich die Frage nach dem ersten Ursprung der Infektionen mit der Entstehungsgeschichte des Parasitismus deckt. Die Annahme, daß jeder Parasit letzten Endes von unabhängigen Lebewesen abstammen muß, daß die Anpassung an die Existenzbedingungen in einem fremden Organismus erst später erfolgt sein kann, läßt sich nicht abweisen. Nicht nur weil sie uns a priori als notwendig erscheint. Die Anpassung oder richtiger das Angepaßtsein, der Endeffekt des Anpassungsprozesses, ist bei den Parasiten in hohem Grade ausgeprägt, und zwar gerade im Sinne einer Rückbildung der für eine unabhängige Existenz erforderlichen morphologischen und funktionellen Einrichtungen. Zahlreiche Parasiten besitzen ferner gewissermaßen als phylogenetisches Relikt noch die ursprüngliche Autonomie, die Lebensfähigkeit außerhalb eines Wirtes, zum Teil als ganze Arten, zum Teil als bestimmte Entwicklungsphasen einer Art. Und schließlich gibt es noch ein drittes, entscheidendes Argument: die experimentelle Verwandlung freilebender Organismen in obligate oder wenigstens in fakultative Schmarotzer. Die medizinisch orientierte Mikrobiologie hat allerdings auf diesem Gebiete keine eindeutig positiven Resultate zu verzeichnen, sofern man an der Forderung festhält, daß der als Ausgangspunkt gewählte Organismus nicht schon in früheren Generationen ein Parasit war und daß somit ein bloßer atavistischer Rückschlag mit Sicherheit ausgeschlossen werden durfte. Dagegen ist die künstliche Synthese der Algensymbiose geglückt, in einzelnen, wenn auch seltenen Fällen unter Voraussetzungen, welche das eben formulierte Postulat zu befriedigen scheinen; es gelang Öhler, die freilebende Chlorella vulgaris zum
Symbionten gewisser Infusorien, der Paramaecien, umzuzüchten. Dem Ausbau dieser Versuche, die ich nur bis 1930, bis zum Erscheinen des großen Werkes von Paul Buchner 4) verfolgen konnte, darf man mit Spannung entgegensehen; ihre Bedeutung für das Infektionsproblem wird man kaum überschätzen. Daß das Gast-Wirt-Verhältnis hier die Tendenz zeigt, der Symbiose, einem terminalen Gleichgewicht, zuzustreben, ist kein prinzipieller Einwand. Denn es fehlt nicht an Beispielen, daß die gastlich beherbergte grüne Alge schrankenlos zu wuchern beginnt und den Untergang ihres Wirtes herbeiführt; und auf der andern Seite können ja auch gefürchtete Krankheitskeime des Menschen als harmlose, in gewisser Hinsicht sogar nützliche Kommensalen auftreten. Wesentlich ist nur die willkürliche Herstellung der engeren Beziehung zwischen zwei heterologen Organismen; sie lehrt, wo der Hebel anzusetzen ist, um die Geheimnisse der Parasitogenese zu entschleiern und entkräftet die Hypothese von P. Portier 5) aufs neue, wonach das Leben schon in der einfachsten Form der Zelle ein symbiotischer Verband ist, eine Vorstellung, die das Suchen nach einem "ersten Anfang" zum zwecklosen Bemühen stempeln würde.
Im Modell der Algensymbiose stehen die Wirte auf den niedrigsten Stufen tierischer Organisation. Von den Amöben und anderen Protisten an bis hinauf zum Menschen zeigen aber alle die Erde gegenwärtig bevölkernden Arten die Disposition, die Bereitschaft zur Aufnahme von Schmarotzern; nur die Parasiten wechseln im allgemeinen je nach der Spezieszugehörigkeit der Wirte. Mit zunehmender Organisation der Wirte wächst die Zahl und Verschiedenheit
der Parasiten, von denen sie befallen werden können; exakte Vergleiche wurden meines Wissens noch nicht angestellt, doch unterliegt es keinem Zweifel, daß der Mensch in dieser Beziehung ein Maximum darstellt. Endlich kennen wir eine ganze Reihe von Fällen, in welchen ein und derselbe Schmarotzer Tiere und Pflanzen bewohnt, die zueinander in enger Verwandtschaft stehen. Die ungeschlechtlichen Stadien der Malariaplasmodien besiedeln nur das Blut von Menschen und anthropoiden Affen, die geschlechtlichen den Magen von Anophelen, das Virus der Mosaikkrankheit das Tabaks läßt sich auf andere Solanaceen übertragen usf. In groben Umrissen und vielfach verschwommener oder fragmentarischer Form tritt uns somit auf dem letzten Blatt der Geschichte des Parasitismus ein Werdegang entgegen, den ich als die Phylogenese der Disposition bezeichnen möchte. Die Infektionsphänomene müssen schon in den ersten Phasen der Entwicklung organischen Lebens eingesetzt und Spuren hinterlassen haben, phylogenetische Engramme, welche die aufsteigende Integration der Wirte zu höher stehenden Arten zu überdauern vermochten, sei es als allgemeine oder gar als spezifische, das heißt auf einen bestimmten Parasiten eingestellte Empfangsbereitschaft. Das Zustandekommen eines solchen Gedächtnisses an durchgemachte Infektionen läßt sich übrigens experimentell demonstrieren, natürlich nur während der individuellen Existenz eines Wirtes oder in der Generationsfolge einer bereits vorhandenen Wirtsart. Die künstliche Synthese der Algensymbiose kennt mehrere Beispiele 6). Auch in der menschlichen Infektionspathologie findet man analoge Erscheinungen wie die Dispositionssteigerungen für die croupöse Pneumonie
und das Erisypel; sie wurden stets nur registriert, aber nie zu erklären versucht, sondern durch die negative Aussage abgefertigt, daß das Überstehen dieser Infekte keine spezifische Immunität erzeugt.
Die phylogenetische Betrachtung ist der Lehre von der Disposition keineswegs fremd geblieben. Elias Metschnikoff 7), ursprünglich Zoologe und erst in späteren Schaffensperioden medizinischen Problemen zugewandt, stellte sein Genie und seine Arbeitskraft in den Dienst der Aufgabe, die Differenzierung und Integration der Abwehrfunktionen durch die aufsteigende Reihe der tierischen Wirte zu verfolgen. Soll "Integration" erhöhte Leistungsfähigkeit, größere Vollkommenheit bedeuten, so läßt sich die polyspezifische Empfangsbereitschaft des Menschen und höherstehender Tiere aus diesem Prinzip heraus nicht begreifen, auch nicht unter Zuhilfenahme der Anpassungsfähigkeit der Schmarotzer. Es muß ein dritter Faktor mitgewirkt haben, der in der hier vorgetragenen Auffassung zur Geltung kommt: der Übergang der Dispositionen von den Vorfahren auf die Deszendenz; von Dispositionen, die nicht schlechthin durch die somatische Verfassung der Wirte gegeben waren, sondern die sich unter dem Einfluß des Parasitismus zu dem entwickelt haben, was sie heute sind.
Nur diese Annahme eröffnet uns ein Verständnis für die höchst eigenartigen Erfahrungen über gelegentliche natürliche und rein künstliche (experimentelle) Wirte. Es gibt Seuchen, welche unter bestimmten Tieren herrschen und sich in diesen in ununterbrochener Kette erhalten (Rotz, Milzbrand, Lyssa, Papageienpest, Abortus enzooticus, Maul- und Klauenseuche usw.); ab
und zu werden Menschen infiziert, aber diese Abzweigungen enden so gut wie immer blind, der Mensch gibt den Parasiten nicht an seine Artgenossen weiter. Eine Anpassung der Erreger an den Menschen kann somit nicht erfolgt sein; sie stoßen vielmehr auf eine bereits präformierte Empfänglichkeit, die dem Menschen als immanentes Speziesmerkmal anhaftet. Was sich hier im Naturgeschehen offenbart, wurde im Tierexperiment durch willkürliche Übertragungen der verschiedensten Infektionsprozesse von natürlichen auf heterologe, im System oft weit abstehende, künstliche Wirte erweitert. Namentlich in den letzten Jahren konnten durch Untersuchungen, an denen auch das Basler Hygienische Institut tätigen Anteil nahm, die überraschendsten Kombinationen, die man früher für unmöglich gehalten hätte, zustandegebracht werden 8) und zwar wieder auf den ersten Schlag d. h. unter Ausschluß einer vorgängigen Anpassung der Mikroben an die ihnen aufgezwungenen neuen Lebensräume. Noch ist das angesammelte Material nicht in dem erörterten Sinne gesichtet; aber aus der Fülle verwirrender und widerspruchsvoller Tatsachen heben sich doch schon einzelne Gesetzmäßigkeiten ab, wie z. B. das außerordentlich breite Dispositionsspektrum der Nager, das auf eine gemeinsame historische Wurzel hindeutet. Die Aussage, daß ein und derselbe Parasit rein zufällig in verschiedenen Wirten gleichartige Existenzbedingungen finden kann, läßt sich angesichts der ungeheuren Zahl der willkürlichen Paarungen und des
beträchtlichen Abstandes der möglichen Wirte voneinander nicht aufrechterhalten; sie würde nur den Verzicht auf eine wissenschaftliche Erklärung bedeuten.
Die wahre Geschichte der parasitären Erkrankungen des Menschen repräsentiert somit einen Ausschnitt aus einem größeren Geschehen. Manche Formen mögen den Menschen durch alle Zeitalter begleitet haben, sie können sogar älter sein als das Menschengeschlecht, Erbschaften seiner Aszendenz. Andere entwickelten sich wahrscheinlich erst während des Bestehens der Menschenrassen, sei es durch Anpassung frei lebender Wesen an den menschlichen Organismus, sei es durch Übernahme vorhandener Parasiten von anderen, tierischen Wirten, also durch einen Wirtswechsel. Welcher dieser drei Vorgänge bei den einzelnen Infektionen anzunehmen ist, läßt sich nur vermuten, und selbst der Spekulation bieten sich nur in wenigen Fällen genügende Anhaltspunkte. An eine primäre Entstehung beim Menschen würde man am ehesten denken, wenn die betreffende Infektion auf keine der lebenden Tierspezies übertragen werden kann; aber schließlich gleichen die lebenden nicht den ausgestorbenen Arten, und die monospezifische Einstellung auf den Menschen kann ja auch sekundär erfolgt sein durch Rückbildung ursprünglicher Eigenschaften des Erregers 9). Mit der Integration der Wirtsdispositionen erscheint eben ein zweites genetisches Moment unentwirrbar verwoben: die biologische Plastizität der Parasiten. Sie ist bei den niedrig
organisierten Schmarotzern, den Bakterien, Spirochaeten, den submikroskopischen Infektionsstoffen in solchem Grade vorhanden, daß sie sogar im kurzfristigen Laboratoriumsexperiment nachweisbar wird. Die Umwandlung des gefährlichen Blatternerregers in den relativ harmlosen Vaccinekeim (die theoretische Basis der Jennerschen Schutzpockenimpfung), die Steigerungen und Abschwächungen der Infektiosität pathogener Bakterien, die Degradation infektiöser Mikroben zu nichtinfektiösen Saprophyten, die (durch wenige, aber einwandfreie Versuche belegte) Möglichkeit, diesen Degradationsprozeß, wenn er einmal abgelaufen ist, auch wieder rückgängig zu machen, zeigen, in welch weiten Grenzen sich diese Variabilität auswirkt. Für wichtig halte ich ferner eine andere Beobachtung der jüngsten Variabilitätsforschung, die sich auf folgendes Schema reduzieren läßt: Ein bestimmtes Agens ist für eine Wirtsspezies A nicht infektiös; wird es aber durch den Organismus eines anderen künstlichen Wirtes B geschickt, so vermag es nunmehr auch A zu besiedeln. Und das alles sind nur Laboratoriumsversuche, die keine neuen Arten erzeugen, sondern nur gewisse Eigenschaften existierender Arten modifizieren. Sie gewähren jedoch einen Einblick in die unermeßliche Mannigfaltigkeit des natürlichen Geschehens, dem sich der mächtige Faktor der Zeit zugesellt.
Die geschriebene Geschichte der parasitären Erkrankungen des Menschen umspannt eine verschwindend kleine Epoche. Je weiter man zurückgreift, desto lückenhafter und unzuverlässiger werden die überlieferten Daten, und schließlich verschwimmt alles zum Einheitsbegriff der Seuche. Immer wieder wurde und wird versucht, aus den Dokumenten die Entstehung
neuer Infektionskrankheiten in historischer Zeit herauszulesen; manche Autoren 10) glauben, einen so rezenten Ursprung für die asiatische Cholera, die Genickstarre, das Mittelmeerfieber, den viel zitierten Sudor anglicus, die Encephalitis epidemica annehmen zu dürfen. Mit bloßer Wahrscheinlichkeit wird sich indes niemand zufrieden geben, wenn die Gewißheit, darüber zu entscheiden hat, wie häufig derartige Ereignisse eintreten und welche Zeiträume notwendig sind, um sie zu realisieren, Entscheidungen, deren Tragweite keines Kommentars bedarf. Eine Tatsache ist aber durch die Litera scripta sicher beglaubigt: die Einschleppung von Seuchen in Gegenden, in denen sie bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt waren. Und hier werden die Nachrichten so zahlreich, sie erstrecken sich auf so viele Infektionsformen, auf die Lues, die Tuberkulose, die Pocken, die Masern, den Aussatz, die Diphtherie u. a. m., daß es nichts zu besagen hat, wenn ein oder das andere Beispiel einer strengen Kritik nicht standhält. In der Epidemiologie werden solche Verschleppungen meist als selbstverständliche Phänomene hingenommen und nur auf ihre katastrophalen Folgen untersucht; sie besitzen jedoch noch eine andere theoretische Bedeutung. Wir wissen, daß sich einige der in Betracht kommenden Krankheiten dort, wo sie herrschen, hartnäckig behaupten, daß sie weder spontan noch unter dem Einfluß unserer Gegenmaßnahmen verschwinden. Wenn es also kleinere und größere, oft sogar sehr ausgedehnte Gebiete gab und noch gibt, in welchen die betreffenden Infektionen nicht existieren, kann es sich nicht um alte, in der Vorzeit erloschene Herde handeln. Diese
Aussparungen — die zweifellos einmal weit umfangreicher waren und erst durch den steigenden Verkehr auf ihr gegenwärtiges Ausmaß eingeengt wurden — nötigen vielmehr zu der Annahme, daß viele, wenn auch nicht alle übertragbaren Krankheiten des Menschen monozentrisch entstanden sind, d. h. in bestimmten Bevölkerungsgruppen, und daß ihre Ausbreitung sekundär erfolgte. Das "Wann" und das "Wie" bleiben freilich in Schwebe. Die Erkenntnis der monozentrischen Genese ist aber schon an sich wertvoll; daß sie nur auf dem Umweg über die Ergebnisse der historisch-geographischen Pathologie gewonnen werden kann, beweist die Wichtigkeit dieser lange vernachlässigten und erst in der letzten Zeit wieder aufgenommenen Forschungsrichtung.
Die rapide Ausbreitung eingeschleppter Seuchen in neuem Milieu mag als eine natürliche Folge der Gleichartigkeit des Wirtes, des Menschen, imponieren. Ganz abgesehen davon, daß der Austausch nachweislich oft, wie bei der Lues, der Lepra, den Pocken, zwischen verschiedenen, farbigen und weißen Rassen stattfand, erheischt jedoch eben diese identische, von der Bekanntschaft mit einem speziellen Parasiten unabhängige Empfänglichkeit eine Erklärung, die wohl nur in phyletischen, die Rassendifferenzierung und die Folge der Generationen überbrückenden Ursachen zu suchen ist.
Seit der Begründung der Pathologia animata, der Lehre von den belebten Krankheitserregern, hat die Vorstellung, daß die Infektion ein Kampf zwischen Wirt und Parasit ist, das medizinische Denken beherrscht. Sie schöpfte ihre Berechtigung aus der Beobachtung, daß der Wirt dem Parasiten erliegen und daß umgekehrt der Parasit im Organismus des Wirtes vernichtet
werden kann; erkenntnistheoretisch erwies sie sich als fruchtbar, da sie den Impuls gab, den Mechanismus der Verteidigung des infizierten Körpers gegen die Eindringlinge zu untersuchen. Diese Auffassung führt jedoch zu der unvermeidlichen Konsequenz, die Parasiten als Antagonisten zu betrachten, ein Schluß, den man tatsächlich gezogen und in abwegigen Hypothesen verwertet hat. Daß darin ein prinzipieller Fehler steckt, ein Mangel an primitivster Logik, erkannte schon van Beneden im Jahre 1876. In seinem für weitere Kreise bestimmten, geistvollen Werk "Animal parasites and his messmates" setzt er klar auseinander, daß der Parasit nur einen Kampf kämpft, den Kampf um seine Existenz, um die dauernde Erhaltung seiner Art. Der Kampf wird ihm durch seine Lebensweise erschwert. Er muß in ununterbrochener Folge neue Wirte finden, er fristet sein Bestehen in Wirtsketten oder, wie das die moderne Epidemiologie nicht ganz zutreffend nennt, in Infektketten. Die rasche und regelmäßige Vernichtung der Wirte kann kein taugliches Mittel sein, die Ketten zu verlängern, sie würde seinen eigenen Untergang besiegeln. Man darf sich nicht dadurch beirren lassen, daß die Sterblichkeit in manchen Epidemien 80-90 %und mehr erreicht; das sind seltene Ausnahmen, und in jedem Falle kennen wir Einrichtungen, welche das definitive Abreißen der Ketten in sämtlichen Verzweigungen verhindern.
Die Mechanismen, welche die Kontinuität sichern, sind bei verschiedenen Infektionen verschieden. Manche erscheinen uns zweckmäßig, wie die Verteilung der Aufgabe auf zwei oder mehrere Wirte, die Ansiedelung der Parasiten in Organen, welche ihnen den Weg in die Außenwelt und damit die Auffindung einer neuen Zufluchtsstätte
ermöglichen, die vielfach erkennbare Tendenz, den Wirt zu schonen, bis er seine Bestimmung erfüllt hat. Wenn man sich jedoch Rechenschaft ablegt, in welch eigenartiger Weise die physiologischen Funktionen des Wirtes, Atmung, Ernährung und Zeugung, ausgenutzt werden, wenn man konstatiert, daß die Hauptrolle bei der Erhaltung des Parasiten oft einem reinen Zufallsfaktor, einer bloßen Berührung, ja einer willkürlichen Handlung des Wirtes zugeschoben wird, muß man mit Ch. Nicolle zugeben, daß die teleologische Interpretation völlig versagt. Vom Standpunkt der menschlichen Intelligenz beurteilt, sind die Mittel, deren sich hier die Natur bedient, zweifellos unvollkommen, unvernünftig, zum Teil sogar absurd. Die Grenzen, welche dem biologischen Denken, der Erfassung des Lebensproblems gezogen sind, treten — vielleicht schärfer als auf anderen Gebieten —zutage. Der angestrebte Erfolg aber, die Erhaltung der Parasiten und damit der parasitären Krankheiten, wird von der Natur trotz der scheinbaren Unzulänglichkeit der Mittel erreicht. Kennen wir doch Infektionen, welche seit mehr als drei Jahrtausenden bestehen, und das Verschwinden auch nur einer einzigen Infektionskrankheit konnte in historischer Zeit nicht beobachtet werden, weder beim Menschen noch bei den Tieren, speziell bei den Haustieren, von denen wir in dieser Hinsicht genauere und zuverlässigere Kunde haben. Allerdings sind die in Betracht kommenden Zeiträume kurz. Wenn man aber bedenkt, daß das Aussterben frei lebender Tiere und Pflanzen tatsächlich historisch, also nicht nur durch paläontologische Dokumente, sichergestellt ist, wird man sich sagen müssen, daß das Aussterben der Parasitenarten nicht so leicht erfolgt, daß alle Zufälligkeiten der Übertragung, alle
die ungeheuren Vernichtungsprozesse, denen die Schmarotzer ausgesetzt sind, überkompensiert werden, solange natürliche Wirte in genügender Zahl vorhanden sind und solange die Intimität ihrer gegenseitigen Beziehungen die unausgesetzte Verlängerung der Ketten ermöglicht.
In manchen Fällen erscheint diese hartnäckige Einnistung der Seuchen auf den ersten Blick völlig rätselhaft. Von den Masern z. B. wird der Mensch nur einmal während seiner Lebensdauer befallen, sie hinterlassen eine bis zum Tode anhaltende Immunität, was in der Sprache der Parasitologie nichts anderes bedeutet, als daß jede Erkrankung einen tauglichen in einen untauglichen Wirt verwandelt. Und doch gehören die Masern zu den ältesten Infektionskrankheiten des Menschengeschlechtes; die ausgedehnte Durchseuchung, die kontinuierliche Reduktion der möglichen Wirte hat bisher nur den Effekt gezeitigt, daß sie in unseren Gegenden zu einer Krankheit des Kindesalters geworden sind. Die Lösung des Widerspruches gibt die Vererbungslehre. Der individuell erworbene Dispositionsverlust ist eben nicht vererbbar, auch dann nicht, wenn er in Hunderten von Generationen stetig erneuert wird; vererbt wird nur die intakte Empfänglichkeit, welche jede Generation der folgenden als verhängnisvolles Speziesmerkmal überliefert.
Seit dem Aufblühen der Konstitutionsforschung in der Medizin hat man sich um den Nachweis bemüht, daß sich gewisse Dispositionen nicht als Artmerkmale, sondern als idiotypische oder Sippencharaktere, d. h. nur in bestimmten Familien fortpflanzen. Es war zuerst der Schweizer Nägeli, der 1900 zeigen konnte, daß zwar die meisten Menschen tuberkulös infiziert werden, daß aber
nur ein relativ geringer Prozentsatz an Tuberkulose erkrankt. Die Anlage zur Erkrankung, zur pathologischen Auswirkung der Infektion ist somit individuell variabel, und es liegt gewiß nahe, hier wie in analogen Fällen hereditäre, und zwar idiotypische Einflüsse anzunehmen. Trifft dies zu, so handelt es sich jedoch nicht um einfache Erbfaktoren, sondern um Genekomplexe, um Genekomplexe, die sich nicht in reinen Linien erhalten können; Mixovariation und Peristase müssen vielmehr beständig Spuren und Folgen eines solchen Erbganges verwischen. Die Hoffnung, daß die Stammbäume der anfälligen Menschen innerhalb langer Zeiträume allmählich aussterben, daß infolge dieser Selektion die widerstandsfähigeren Individuen übrig bleiben und ihre Resistenz auf die Nachkommen übertragen, ruht also nicht auf sicherer vererbungstheoretischer Grundlage. Wohl wissen wir, daß einige der in diese Kategorie gehörenden Krankheiten unmittelbar nach ihrer Einschleppung in bisher verschonte Länder besonders bösartig auftreten und daß sie nach jahrhundertelangem Bestehen ein gutartigeres Gepräge angenommen haben. Solche Erscheinungen lassen sich aber auch auf andere Weise interpretieren, sie können nicht als Beweis für die selektive Ausmerzung idiotypischer Erbanlagen gelten. Vor allem darf man eines nicht vergessen, worauf ich wiederholt aufmerksam gemacht habe 11): die Disposition für die Erkrankung und die Disposition für die Infektion sind zwei total verschiedene Dinge. Ist die selektive Verminderung der Krankheitsdisposition mehr als eine bloße Hypothese, so läßt sie doch die Disposition für
die Infektion ganz unberührt. Wenn auch nicht so viele Menschen erkranken, wird doch der gleiche Prozentsatz latent infiziert, der Erreger fristet, oft in ungeheurem Ausmaß, die Erhaltung seiner Art als Kommensale, bereit, bei jedem in die Kette eingeschalteten empfänglichen Individuum seine verderbliche Wirkung zu entfalten, so bei der Diphtherie, der Genickstarre, der spinalen Kinderlähmung, beim Scharlach, beim Bauchtyphus und anderen Infektionen mit individuell variabler Empfänglichkeit.
So ist die ganze Tragik des Geschehens im Erbgang des Menschen und im Erbgang der Parasiten beschlossen, in ihrem Zusammenwirken zu jener Relativität, die wir eine Infektion nennen. In zunehmendem Maße bricht sich diese Erkenntnis Bahn; es werden an beiden Bezugskomponenten vererbungswissenschaftliche Untersuchungen angestellt. Die Resultate sind vorläufig bescheiden, kaum über erste, vereinzelte Ansätze hinaus gediehen. Es fehlen wichtige Voraussetzungen. Über den Mechanismus der Disposition für die Infektionen wissen wir so gut wie nichts, über das Wesen der Erkrankungsbereitschaft wenig, und die Trennung der beiden Begriffe konnte sich bisher nicht restlos durchsetzen. Trotz Rosenbach, Hüppe, Martius, Nägeli und ihren Nachfolgern taucht immer wieder die Tendenz auf, die Seuchenprobleme vom Erreger aus einseitig zu lösen und ihm zu diesem Zwecke die mystischen Eigenschaften der Aggressivität, der Virulenz usw. beizulegen, Eigenschaften, die im Vorstellungskreis des Parasitologen keinen Platz finden. Nur eine medizinische Disziplin hat seit jeher eine — zunächst allerdings nicht beabsichtigte — Ausnahme gemacht: die Epidemiologie. Denn sie erfaßt die Relativität als Ganzes, und
zwar in ihren Endeffekten, in der Erkrankung und im Tod, in der jüngsten Zeit auch in den latenten, symptomlosen Infektionen der Wirte, speziell des Menschen. Das ist ihr prinzipieller Vorzug; ihr Nachteil liegt in ihrer Methode. Neuere Autoren definieren die Epidemiologie als die Lehre von den Wirts- oder Infektketten; das ist sie aber ebensowenig wie sich etwa die Bevölkerungsstatistik mit der Genealogie identifizieren läßt. Von praktischer Detailarbeit abgesehen, werden die Infektketten gar nicht festgestellt; die ausschließliche Basis auch der modernen Epidemiologie bildet vielmehr die Registrierung der Zahl der Fälle innerhalb konventioneller Zeitabschnitte, die Ermittlung des Verseuchungszustandes bestimmter Bevölkerungsgruppen, d. h. also eine reine Querschnittsuntersuchung. Erst die lückenlose chronologische Aneinanderreihung der Querschnittsziffern ergibt einen Längsschnitt, sie charakterisiert nicht mehr einen Zustand, sondern einen in der Zeit ablaufenden Vorgang, die Fluktuation der Wirtszahlen für jede einzelne Infektion. Auch in dieser Form verraten indes die epidemiologischen Daten ihren Aufbau aus summarischen Querschnitten; sie zeichnen immer nur den äußeren Kontur, den Umfang der Wirtsfolgen, bieten aber keinen Aufschluß über ihre innere Struktur und ihre realen Ursachen. Es handelt sich also, mathematisch ausgedrückt, um die Betrachtung einer Querschnittsänderung als Funktion der Zeit, und erst wenn man sich dies klar gemacht hat, gewinnt man ein Verständnis für die der induktiven oder analytischen Epidemiologie zugänglichen Fragestellungen. Nur dort, wo ein bestimmtes Zeitgesetz in Erscheinung tritt, wo die Fluktuationen der Wirtszahlen einen regelmäßigen Rhythmus, eine deutliche Periodizität erkennen lassen,
besteht die Aussicht, in den Mechanismus der Massenphänomene tiefer einzudringen und auf diesem Wege einmal zum wichtigen Endziel, zur epidemiologischen Prognose, zur Voraussage der Ereignisse zu gelangen. Das sind jedoch Ausnahmen, und selbst in solchen exzeptionellen Fällen wird die Wirtsfolge in solchem Maße von zufälligen Faktoren beherrscht, daß die Macht der großen Zahlen zum Teile versagt. Die Aufgaben, welche die rechnende Epidemiologie zu bewältigen hat, sind weit komplizierter und schwieriger als jene der Bevölkerungsstatistik, die ich zum Vergleiche heranzog, und diese Schwierigkeiten lassen sich nicht beseitigen, wenn man deduktiv vorgeht, d. h. wenn man aus den Bedingungen der Einzelinfektion das Massengeschehen zu erschließen trachtet. Induktive und deduktive Betrachtung gestatten zwar gegenseitige Annäherungen; im Brennpunkt sicherer, die Tatsachen befriedigender Erklärungen des Kommens und Gehens der Epidemien können sie einstweilen nicht zur Vereinigung gebracht werden.
Es erscheint daher rational, sich an die Tatsachen als solche, an die epidemiologischen Phänomene zu halten. Sie lehren, daß der Mensch mit Erfolg hemmend in das Getriebe der Wirtsfolgen eingreifen kann, gewollt und ungewollt, palliativ und radikal. An erster Stelle steht hier meines Erachtens die ungewollte und radikale Auswirkung des fortschreitenden Kulturzustandes, das vollständige Erlöschen bestimmter parasitärer Erkrankungen in ausgedehnten, von Hunderten von Millionen bevölkerten Gebieten ohne jede unmittelbare, aktive Bekämpfung, lediglich durch eine soziologisch bedingte Umformung der Lebensweise, welche den besonderen Übertragungsmodus erschwert oder unmöglich
macht. So sind Fleck- und Rückfallfieber, Pest und Cholera aus West- und Zentraleuropa verschwunden; die wirksamen Umformungen der Lebensführung betreffen hier oft scheinbar nebensächliche Umstände, stets waren sie aber automatische Konsequenzen der wirtschaftlichen Prosperität breiter Bevölkerungsschichten und des wachsenden Übergewichtes städtischer über ländliche Kultur. Es offenbart sich hier ein Gegensatz zu der Auffassung, welche zwar nicht die Entstehung, wohl aber die Ausbreitung der Seuchen als Folge der Zivilisation, der gesellschaftlichen Verfassung hinstellt und in der Häufung der Menschen in großen Siedelungszentren einen eminent ungünstigen Faktor sieht. Das mag in einzelnen Fällen, z. B. bei der Grippe, zutreffen; im allgemeinen bedeutet Massenhäufung nur dort einen Nachteil, wo sie mit Massenelend einhergeht. Wird diese Phase überwunden, so konstatieren wir den gegenteiligen Effekt, einen Effekt, der nicht bloß in der vollständigen regionären Ausrottung bestimmter Seuchen zum Ausdruck kommt, sondern in der allgemeinen Abnahme der Morbidität und Mortalität aus infektiösen Ursachen. Dieser Prozeß vollzieht sich in allen hochkultivierten Ländern seit vielen Jahrzehnten unter unseren Augen und wurde vom Weltkrieg nur zeitweilig unterbrochen; der Anteil, den die Abwehrmaßnahmen daran nahmen, ist sicher groß und schwer auszuscheiden, es bleibt aber zweifellos noch eine ansehnliche Quote übrig, die sich nur auf den Wegfall wirtschaftlicher und soziologischer Mißstände zurückführen läßt; für das kontinuierliche Sinken der Tuberkulosesterblichkeit 12) wird diese Erklärung von niemand bestritten.
Ad. Gottstein 13), dessen Weitblick wir unsere Bewunderung nicht versagen können, hält es für denkbar, daß die fortschreitende soziologische Entwicklung der weißen Rassen in Zukunft noch andere Mängel eliminieren könnte, über deren Bedeutung wir uns gegenwärtig noch keine Rechenschaft abzulegen vermögen. Ich teile diesen Optimismus. Die Seuchenkatastrophen, welche Rußland in den letzten Kriegsjahren und in der Nachkriegszeit heimsuchten, bekunden jedoch die Möglichkeit von Rückschlägen; sie sind das imponierendste, aber nicht das einzige Beispiel dieser Art, und wer schärfer zusieht, erkennt, daß sich nicht so brutal, mehr unauffällig, gewisse Änderungen der Lebenshaltung der Massen vollziehen, deren ungünstiger Einfluß früher oder später in Erscheinung treten muß.
Ist es unter solchen Umständen utopisch, eine völlige Ausrottung einzelner Infektionen aus allen bewohnten Gebieten der Erde zu erhoffen? Ich glaube nicht. Was regionär geschehen ist, muß auch in größerem Maßstab realisierbar sein. Die Angleichung der Kulturzustände anderer Völker an jenen der weißen Rassen könnte sehr wohl in ferner Zukunft derartige, nicht direkt beabsichtigte Ergebnisse zeitigen.
Und die aktive, zielbewußte Abwehr der Seuchen, wie sie heute dank der Fortschritte der Mikrobiologie geübt wird? Sie steht zur Gänze im Zeichen der Eindämmung, das heißt der Verhütung der Ausbreitung und der Verschleppung, und hier sind ihr außerordentlich große Erfolge beschieden gewesen. Die höhere Zielsetzung, die Ausrottung bestimmter übertragbarer Krankheiten, hat sie jedoch nach meiner Meinung aus den
Augen verloren, sie setzt den Kampf fort, trachtet aber nicht, ihn in möglichen Fällen zu finalisieren. Das Verschwinden der Lepra aus Europa infolge der Isolierung der Aussätzigen und die Reduktion der Pocken durch die Anwendung der Jennerschen Schutzimpfung beweisen, daß es solche mögliche Fälle tatsächlich gibt, und die partielle Ausmerzung der Pocken ist besonders lehrreich, weil sie zeigt, daß hier eine Leistung verwirklicht werden konnte, welche auf dem Wege der natürlichen Blatterndurchseuchung nicht zustande kam und nie zustande gekommen wäre. Es ist an der Zeit, daß internationale und staatliche Organisationen an die Bewältigung solcher wahrhaft großzügiger Aufgaben herantreten und über den Forderungen des Augenblicks und des nationalen Selbstschutzes nicht die Sorge für die kommenden Generationen vergessen.
Es ist aber auch an der Zeit, Forschung und Lehre auf dem Gebiete der parasitären Erkrankungen zu reformieren. Beide sind heute zwischen Klinikern, Pathologen, Mikrobiologen, Parasitologen und Hygienikern aufgeteilt, das ganze große und wichtige einheitliche Gebiet erscheint in seiner wissenschaftlichen Bearbeitung wie im Unterricht zerrissen, zu einer Reihe von Nebenfächern degradiert; jeder, der sich ihm widmen will, wird sofort durch die bestehenden Einrichtungen in ein enges Spezialistentum gedrängt, mit allen seinen Konsequenzen für fundamentale Auffassungen, tatsächliches Wissen und technisches Können. Hier muß einmal eine Zentralisation erfolgen, natürlich nur bis zu den zweckmäßigen und als fruchtbar erkannten Grenzen. Wo diese Grenzen zu ziehen sind und wie innerhalb des so abgesteckten Rahmens die angestrebte Wiedervereinigung zu erzielen wäre, das beinhaltet ein umfangreiches Programm, das
ich an dieser Stelle nicht einmal in seinen Hauptlinien skizzieren kann.
Drittens muß in breiten Schichten der Bevölkerung das Verständnis für das schon Erreichte und für die noch zu bewältigenden Aufgaben wach erhalten und gefördert werden. Wäre dieses Verständnis allgemeines Bildungsgut, so könnte man die sich ständig mehrenden Angriffe auf die medizinische Wissenschaft und auf die unentbehrlichen Mittel zur Erforschung und Bekämpfung der Infektionskrankheiten, in erster Linie auf Impfung und Tierversuche, kaum begreifen.
Um was die Forschung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gerungen und was sie erobert hat, ist nicht nur die Befreiung von einer die soziologische und wirtschaftliche Entwicklung hemmenden Gefahr. Es sind auch wissenschaftliche und erkenntnistheoretische Einsichten gewonnen worden, Einsichten von großer Tragweite und nachhaltiger Auswirkung. Schon die Entdeckung der sichtbaren pathogenen Mikroben hat fast keine Spezialdisziplin der Heilkunde unberührt gelassen und die Untersuchungen der unsichtbaren Erreger sind berufen, unsere Vorstellungen von den einfachsten Lebensformen und von dem, was Leben überhaupt ist, von Grund auf zu ändern. In beiden Richtungen muß Kontinuität und Fortschritt gesichert bleiben, damit unsere Epigonen sagen können: Opus factum est, quod non potest mori.