VOM WESEN, VON DEN AUFGABEN UND VON DEN GRENZEN DER MORPHOLOGIE
REKTORATSREDE GEHALTEN AN DER JAHRESFEIER DER UNIVERSITÄT BASEL
VON
REKTOR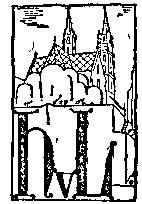
BASEL 1941 VERLAG HELBING & LICHTENHAHNHochansehnliche Versammlung!
Anatomie ist in den Augen vieler Biologen und Aerzte eine Fülle von Einzeltatsachen beschränkten praktischen Wertes oder bestenfalls ein längst abgeschlossenes und dazu noch ausschließlich Sachverhalte beschreibendes Wissensgebiet, aber keine Wissenschaft. In der Tat kann der Anatomie des Menschen der Charakter einer selbständigen Wissenschaft nicht zugesprochen werden. Albrecht von Haller hat noch heute recht, daß er jeden Selbstzweck der Anatomie bestritt. Die Anatomie war als Zergliederungskunst und Zergliederungskunde von Anfang an unzertrennlich mit der Medizin verbunden, insbesondere mit der Physiologie und der Pathologie, viel später erst mit der Chirurgie. Aber nicht etwa als gleichberechtigtes Glied einer Gemeinschaft, sondern als Dienerin. Für den Physiologen ist die Zergliederung, die Beobachtung freigelegter Organe, die mikroskopische Untersuchung eine Methode der Forschung. Sie besaß ursprünglich eine fast zentrale Bedeutung. Dem Chirurgen zeigt die Anatomie die für seine Eingriffe günstigsten Wege, dem Pathologen vermittelt sie die Anschauung des Normalen, von dem sich ja erst das Pathologische als solches abhebt. Als Hilfswissenschaft der Medizin, was sie von jeher war und bis auf den heutigen Tag geblieben ist, soll die Anatomie auch gelehrt werden. Der Arzt war ja früher und ist zum Teil jetzt noch gleichzeitig
Anatom. Mit dem Auftreten des Spezialistentums verteilte sich auch die anatomische Forschung, wenn schon etwas ungleich, auf die nach und nach sich abgliedernden Sonderfächer. Vor allem Chirurgen, aber auch Augen- und Ohrenärzte, Geburtshelfer, Radiologen, Internisten und Psychiater haben an ihrem Ausbau hervorragenden Anteil genommen, einen wesentlich größeren sogar als die Fachanatomen selbst, sofern es sich um die analytische Arbeit, um die Erforschung der Einzelheiten im Bau des menschlichen Körpers handelt. Denn mit dem Ausbau der Spezialfächer ging das Bedürfnis vertiefter anatomischer Anschauung parallel. Die praktische Heilkunde stellte die Fragen und sie gab größtenteils die Antworten selbst. Dagegen blieb die Synthese den Anatomen vorbehalten und zwar nicht nur die systematische lehrbuchmäßige Darstellung der Zergliederungskunde, sondern namentlich die Schaffung und der Ausbau einer allgemeinen Anatomie, die Ableitung und die Anwendung der allgemeinen Begriffe, deren sich die Anatomie bedient, und die Einordnung der Einzeltatsachen in das System derselben. Ueberdies gingen nach und nach gewisse Gebiete der Physiologie ganz an die Anatomie über, so die Lehre von der Statik und Mechanik des Organismus und die gesamte Entwicklungsphysiologie.
In eigenartige, neue und von der Medizin zunächst unabhängige Bahnen wurde die Anatomie gelenkt, als die vergleichende Anatomie die Form als solche zum Gegenstande wissenschaftlicher Untersuchung machte, indem sie sich unter dem Einflusse von Geoffroy St. Hilaire, Vicq d'Azyr und Goethe zur Morphologie entwickelte. Es sei mir gestattet, vom Wesen, von den Zielsetzungen und von den Grenzen der Morphologie zu sprechen. Dabei wird sich zeigen, wie diese Wissenschaft, die in ihren Anfängen nichts mit der Medizin zu tun hatte, nach und
nach den Anschluß an die Lehre von den lebenden Wesen und damit auch an die Heilkunde gewann, in erster Linie an die Physiologie, und daß sie dazu berufen zu sein scheint, die immer mehr abhanden gekommene Einheit und Physiologie und Anatomie wieder herzustellen.
Morphologie ist die Lehre von den Formverhältnissen der Organismen, also von der Anordnung ihres materiellen Substrates im Raum. Sie ist keine einheitliche Wissenschaft insofern, als die Gesichtspunkte, von denen aus die Form ins Auge gefaßt und beurteilt werden kann, verschieden sind und auch im Laufe der Zeiten verschieden bewertet wurden. Die Morphologie kann sich auf die Betrachtung der äußeren Form und der inneren Struktur des fertigen Organismus beschränken und dadurch zu Erkenntnissen gelangen, daß sie vergleicht, was sie durch Anschauung gewonnen hat. So kommt sie dazu, einerseits die Formen nach Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten zu ordnen, andererseits das in der Mannigfaltigkeit der Gestalten Wiederkehrende zu ermitteln. Aus dieser engsten — man kann auch sagen reinsten —Zielsetzung heraus sind die Systematik und die Typenlehre entstanden, statische Betrachtungsweisen ohne kinetischen, dynamischen oder gar ätiologischen Inhalt. Die Systematik und die Lehre vom Typus und seiner Metamorphose werden heutzutage von vielen als unfruchtbar bezeichnet und mehr oder weniger scharf abgelehnt. Dabei wird geltend gemacht, daß organismische Formen Bestandteile der realen Welt sind im Gegensatz zu geometrischen, daß sie nicht einfach da sind und bestenfalls entstanden gedacht werden können, sondern daß sie tatsächlich entstehen. Und daraus wird gefolgert, daß eine Morphologie, die nichts als Sachverhalte darstellt und diese ordnet, nur einen Aspekt der Form erfaßt, nämlich das Sein, während sie vom Werden und vom Vergehen keine Notiz nimmt.
Stellt aber die vergleichende Morphologie auf Grund von beobachteten Formenreihen die Hypothese auf, ein Organismus könne sich in einen andern umbilden und entwickelt sie auf Grund dieser Hypothese die Abstammungslehre, so fügt sie ein neues und zwar ein kinetisches Element in ihre Gedankengänge ein. Sie leitet von einer Hypothese her Vorstellungen ab über die Entstehung und die Wandlung der Form auf Grund von Beziehungen der Organismen unter sich im Sinne einer genealogischen Verknüpfung. Damit äußert sich die Morphologie über frühere Ereignisse, die ohne übrig gebliebene Zeugen abgelaufen sind und die infolge ihrer Einmaligkeit nicht wiederkehren. Immerhin hat die Forschung der letzten hundert Jahre für die Metazoën nicht nur den gemeinsamen Zug des zellulären Aufbaues, sondern auch die gemeinsamen Entwicklungsgesetze festgestellt. Das sind übereinstimmende Merkmale, die bis heute allein durch die Annahme einer nahen Verwandtschaft der Organismen und der historischen Evolution der Formen verständlich gemacht werden können. Damit ist freilich noch nichts über die Gestalt des tierischen Stammbaumes oder über die Ahnentafel irgend eines Organismus festgelegt und noch viel weniger ist eine Aussage ätiologischen Inhaltes über die Stammesentwicklung gemacht. Die Genealogie der Organismen und die Aetiologie ihrer Metamorphosen sind Fragenkomplexe, die zur Zeit eher die Neigung zur Komplikation als zur Vereinfachung zeigen. Denn neben der vergleichenden Anatomie und Physiologie, der Paläontologie und etwa noch der Tiergeographie, die sich ursprünglich allein zum Thema äußerten, sprechen heute auch die Entwicklungsgeschichte mit Einschluß der Entwicklungsmechanik, die Genetik und die Vererbungslehre mit.
Eine Ausweitung der Morphologie bedingt die Einbeziehung
der embryonalen Formen in den Kreis der Betrachtung insofern als dabei das Werden der Form, die Gestaltung ins Auge gefaßt wird, die sich nicht im Verlaufe der Stammesentwicklung außerhalb unserer Wahrnehmung ereignete, sondern die sich während der individuellen Entwicklung vor unseren Augen abspielt. Das Studium der Entwicklungsgeschichte ist keine statische Morphologie mehr, sondern eine kinetisch-dynamische, denn es führt zu den Begriffen des Wachstums, der Differenzierung und der Gestaltungsbewegungen. Entwicklungsgeschichte bringt verschiedene Formen nicht mehr bloß gedanklich oder auf Grund von Hypothesen zueinander in Beziehung, sondern auf Grund gegenwärtig ablaufender Veränderungen der Form eines und desselben Objektes. An Stelle der Betrachtung in einem willkürlich gewählten oder durch Zufall bestimmten Augenblick tritt die Untersuchung nahe aufeinander folgender Entwicklungsstadien, wenn immer möglich sogar die dauernde Beobachtung des lebenden Organismus während längerer Zeitabschnitte, gegebenenfalls mit Hilfe der Kinematographie. Zur klassischen Präparation der Leiche mit Messer, Schere und Nadel und zur mikroskopischen Untersuchung gesellen sich weitere Methoden: Markierungen aller Art, die mit Hilfe feinster Nadeln, durch Elektrolyse, durch Auftragen von Farbstoffen auf dem Keim angebracht werden, planmäßige partielle Zerstörungen, Aufzucht isolierter Keimteile. Die meisten von diesen Methoden wenden sich an das lebende Objekt und haben den Sinn, die Sukzession seiner Wandlungen in der Zeit zu verfolgen. Die Forschung am lebenden Keim erfreut sich zunehmender Wertschätzung, und die experimentelle Embryologie, die sich ihrer bedient, gefällt sich darin, sich von der deskriptiven zu distanzieren. Zweifellos hat sie mit Hilfe ihrer subtilen Arbeitsmethoden die rein
beschreibenden Feststellungen über den Ablauf morphogenetischer Prozesse in ungeahnter Weise erweitert. Sie hat manche ältere Anschauung korrigiert und präzisiert und sie ist dazu berufen, die Entwicklungslehre noch weiterhin mächtig zu fördern. Aber mehr als deskriptive Resultate zeitigt ein großer Teil der Experimente nicht. Trotzdem Wilhelm Roux von jeher auf diese Tatsache hinwies, wird sie immer wieder einmal vergessen und die Termini "experimentelle Morphologie" und "kausale Morphologie" werden einander gleichgesetzt.
Die Morphologie begnügt sich allerdings längst nicht mehr damit, die Stellung eines Organismus im genealogischen System zu fixieren und seine Geschichte im Laufe weiter Zeiträume zu rekonstruieren. Sie beschränkt sich auch nicht mehr darauf, die individuelle Entwicklung als erblich bedingtes Phänomen hinzunehmen und einfach zu beschreiben. Sondern sie betrachtet die individuelle Entwicklung als die Funktion des Keimes und sie ist bestrebt, die Organisationen seiner aufeinander folgenden Entwicklungsstufen aus einander zu verstehen und den "Mechanismus" des Wachstums, der Differenzierung und der Gestaltungsbewegungen zu erfassen. Dabei wird unter Mechanik die Lehre vom mechanistischen, d. h. der Kausalität unterstehenden Geschehen verstanden. Es wird also von der Annahme ausgegangen, daß jede Gestalt und Struktur und jede Aenderung derselben durch ein zeitlich vorangehendes Ereignis innerhalb oder außerhalb der lebenden Substanz, also ursächlich veranlaßt ist. Dementsprechend gehen die Bestrebungen dahin, nicht nur Formen festzustellen und nach bestimmten Gesichtspunkten zu ordnen oder die Entstehung der Formen beschreibend zu verfolgen, sondern auch dahin, die Ursachen und die Bedingungen aller Gestaltung und Gestaltsveränderung zu bestimmen. Der Weg gegen diese Ziele führt wiederum
vielfach über das Experiment, aber diesmal auf Grund bewußter kausaler Fragestellung. Damit sucht die moderne Morphologie im Gegensatz zur historisch-phylogenetischen Betrachtung einen aktuellen ätiologischen Inhalt zu gewinnen durch kausale Analyse des Entwicklungsprozesses, wie er sich an den heutigen Organismen abspielt. Der Sinn dieser Bestrebungen ist der, die Morphologie von einer deskriptiven zu einer kausalen Wissenschaft zu erheben. Als solche würde sie die gesamte Lehre von der Form, also auch von den Ursachen (Faktoren) der Formbildung und von den Wirkungsweisen und Wirkungsgrößen dieser Faktoren umfassen. Da das Wirken als solches unsichtbar ist, hat man nach Roux die Entwicklungsmechanik im Gegensatz zur deskriptiven Entwicklungslehre auch als die Wissenschaft von dem unsichtbaren, nur zu erschließenden Entwicklungsgeschehen zu bezeichnen.
So und ähnlich lauten die Formeln, mit welchen Vertreter der kausalen Morphologie das Wesen und die Ziele ihrer Wissenschaft umschreiben. Inwiefern von kausaler Morphologie heute schon die Rede sein kann und was in der Zukunft von ihr zu erwarten ist, wird allerdings erst dann eindeutig auszusagen sein, wenn einerseits die weit klaffenden Lücken unserer deskriptiven Kenntnisse einigermaßen ausgefüllt sein werden und wenn uns andererseits die Philosophie allseitig anerkannte Aussagen über Kausalität und Determination beschert haben wird. Wir wissen zwar um viele "Ursachen" von Entwicklungsprozessen. Man denke nur an die Befruchtung und an den Vorgang der Induktion. Aber wir verstehen diese Erscheinungen in ihrem Wesen nicht. Wir können vorderhand noch nicht einmal eine erschöpfende Beschreibung von ihnen geben. Wir stehen den Phänomenen gegenüber wie ein Mensch, der einen Knall hört und ein Tier fallen
sieht, aber weder vom Schützen noch von der Feuerwaffe etwas weiß.
Unsere Mittel zum Erkennen reichen zur Zeit noch bei weitem nicht hin, eine organismische Form, ihre Entstehung und Veränderung bis in alle Einzelheiten hinein auch nur zu beschreiben. Ein Hauptgrund der Beschränktheit und Lückenhaftigkeit aller Morphologie ist der, daß der optischen Wahrnehmbarkeit mit Hilfe des klassischen Mikroskops eine untere Grenze gesetzt ist und zwar dort, wo die Entfernung zweier Punkte unter den fünftausendsten Teil des Millimeters sinkt. Diese Grenze ist nicht in der Morphologie selbst oder in ihren Objekten begründet, sondern in der Einrichtung des menschlichen Auges einerseits, andererseits in den Wellenlängen des sichtbaren Lichts, an die das Auflösungsvermögen der gewöhnlichen Objektive gebunden ist. Daß unterhalb der genannten Größenordnung die Gegenstände der Morphologie nicht fehlen, ist ohne weiteres klar. In der Tat bringt die Chemie in ihren Strukturformeln die räumliche Anordnung der Atome in den Molekülen zum Ausdruck. Sie sucht auch die Architektonik supramolekulärer Komplexe zu ergründen. Und jenseits der Chemie liegt das Arbeitsfeld der Atomphysik, die ihre räumlichen Atommodelle aufbaut. Insofern sind, auch die Chemie und die Physik morphologische Wissenschaften. Zwischen ihnen und der Morphologie im gewöhnlichen Sinne klafft aber eine weite Lücke. Denn von der quantitativen Verteilung der chemischen Körper auf die Bestandteile der sichtbaren Struktur wissen wir noch sehr wenig und von den gegenseitigen topographischen und dynamischen Beziehungen der Moleküle und Molekülkomplexe innerhalb der morphologischen Strukturelemente noch viel weniger. Was wir sehen und was wir durch die Gestaltungsvorgänge hindurch verfolgen können, sind Zellen, Zellgruppen
und Zellschwärme, bestenfalls gewisse immer noch als grob zu bezeichnende Bestandteile von Zellen und Interzellularsubstanzen. Eine Lehre von den gegenseitigen Lagebeziehungen und -veränderungen der metamikroskopischen Teilchen bis hinunter zu den Molekülschwärmen und den Molekülen ist eine noch zu vollziehende Ausweitung der Morphologie, deren diese Wissenschaft dringend bedarf. Die chemische Mikroanalyse eingeäscherter Gewebsschnitte, der mikrochemische Nachweis gewisser anorganischer und organischer Substanzen wie des Fettes, des Glykogens, der Askorbinsäure durch spezifische Reaktionen im Schnittpräparat, die Spektralanalyse der Gewebe sind höchstens Anläufe in dieser Richtung. Zur erschöpfenden Beschreibung einer Struktur oder eines morphogenetischen Vorganges gehört streng genommen eine lückenlose Darstellung der chemischen und physikalischen Aspekte mit Einschluß alles dessen, was in der Größenordnung zwischen der jetzigen Morphologie und der Chemie zu sehen wäre. Wie verwickelt diese Vorgänge sein müssen, können wir ahnen, wenn wir etwa wahrnehmen, in wie umständlicher Weise relativ einfache biochemische Prozesse vor sich gehen, beispielsweise die Spaltung von Zucker in Alkohol und Kohlensäure unter der Einwirkung des Hefepilzes. Eine gewisse Anschauung vermittelt auch das Hofmeister'sche Zellmodell, das einen Würfel von 20 Mikren Seitenlänge, also ein Volumen von 8000 Kubikmikren mit einem Inhalt von mehr als zwei Billionen Molekülen der Vorstellung nahe zu bringen versucht. "Das Protoplasma einer Zelle von mittlerer Größe" sagt Hofmeister, "gestattet somit die Unterbringung einer Struktur, deren Kompliziertheit weit über das hinausgeht, was man auf Grund der anatomischen Tatsachen auch nur entfernt erwarten durfte."Trotz all dem: erst nach der restlosen Aufklärung im Sinne der räumlichen
Anordnung und Bewegung aller Teilchen in allen Größenordnungen kann eine Struktur oder die Wandlung einer solchen als wirklich beschrieben gelten. Nachher erst wird die experimentelle Forschung die Frage nach den kausalen Beziehungen der einzelnen Komponenten einer Formbildung oder Formänderung angehen können. Zu diesen Anschauungen und Forderungen, die wir seit mehr als zehn Jahren vertreten, bekennt sich in jüngster Zeit Ruska. Er schreibt: "Es dürfte aber die Bedeutung der Morphologie eine andere sein, wenn es gelänge, in der Zelle jedes Molekül nach seiner Lage oder in seinem Verhalten zu erkennen und eine lückenlose Brücke zwischen Morphologie und Chemie des Organismus zu schlagen." Und weiter: "Gerade die vielfältige Entwicklung der Struktur gibt dem Belebten gegenüber dem Unbelebten sein besonderes Gepräge, und je besser wir das morphologische Gefüge erkennen, um so besser werden wir auch die physiologischen und chemischen Vorgänge verstehen und zur Struktur in Beziehung setzen können." Ruska gibt der Arbeit, der die soeben gehörten Zitate entnommen sind, eine Tabelle bei, betitelt "Das Reich der Morphologie." Darin stellt er eine kontinuierliche Reihe der Größenordnungen zusammen bis hinunter zum Millionstel Mikron und eine "morphologische Hierarchie" von den Organen bis zu den Atomen und Elektronen.
Eine Möglichkeit, in das Gebiet der unerforschten Dimensionen mit den Methoden der Morphologie vorzustoßen, beginnt sich abzuzeichnen. Sie bietet sich der Forschung dar in der Gestalt des Siemens'schen Uebermikroskops, an dessen Entwicklung und praktischer Verwertung wiederum Ruska einen hervorragenden Anteil nimmt. Das Instrument beruht auf der Tatsache, daß sich Kathodenstrahlen in einem elektrischen Felde so verhalten wie Lichtstrahlen in einer Linse. Weil aber die Kathodenstrahlen
sehr viel kurzwelliger sind als die Lichtstrahlen, besitzt das Uebermikroskop ein gegenüber dem Lichtmikroskop fast um das hundertfache gesteigertes Auflösungsvermögen. Von seinen Leistungen hat die Morphologie noch Großes zu erwarten, namentlich dann, wenn es einmal gelingen sollte, von den abgebildeten Gegenständen mehr als bloße Schattenrisse, nämlich Einblicke in die feinste Struktur zu erhalten, soweit sie das Instrument überhaupt auflöst.
Nicht nur die Zielsetzungen und die Methoden sind für das Wesen einer Wissenschaft bestimmend, sondern in erster Linie ihr Objekt. Im Falle der Morphologie ist dieses Objekt das lebende Wesen. Von ihm sind zahlreiche immer wiederkehrende Eigenschaften bekannt, durch die es sich gegenüber der unbelebten Natur auszeichnet. Es wird im Rahmen der heutigen Ausführungen nicht möglich sein, sie alle zu betrachten; sie sind die Summe dessen, was sich irgendwie unter den Begriff der allgemeinen Biologie einordnen läßt. Wir müssen uns darauf beschränken, nur zwei näher ins Auge zu fassen und wir wählen solche, die für die Morphologie von besonders grundsätzlicher Bedeutung sind.
Wer den Mechanismus der Lebenserscheinungen studieren will, sei es deskriptiv, sei es im Hinblick auf seine Kausalität, hat seiner Betrachtung zugrunde zu legen, daß sich das Leben in organismischen Individuen äußert und daß diese Individuen sterblich sind. Die beschränkte Lebensdauer der Individuen bedingt nicht nur ihre Fähigkeit, sondern versetzt sie in die Zwangslage, Nachkommen hervorzubringen. Denn nur auf diesem Wege kann das organismische Leben erhalten bleiben. Die Nachkommen gehen aus Keimen hervor, die den Eltern zunächst unähnlich sind. Durch den Prozeß der Entwicklung erst werden sie diesen weitgehend ähnlich und ihrerseits fähig,
Nachkommen zu erzeugen, bevor sie selbst altern und absterben.
Die Entwicklung ist ein unaufhaltsam fortschreitender Vorgang. Die ihr eigentümlichen Wachstums-, Gestaltungs- und Differenzierungsprozesse sind in den Frühstadien am lebhaftesten, mit der Zeit werden sie langsamer und unauffälliger. Nach und nach kommt das Wachstum wenigstens insofern zum Stillstand, als der Zuwachs den Abgang nicht mehr übersteigt, und die Differenzierung der Gewebe erreicht den Grad, welcher der höchsten Leistungsfähigkeit entspricht. Auf diesem Gipfel der Lebenskurve bleibt jedoch der Organismus nicht stehen. Die Veränderungen der Organ- und Gewebsstrukturen schreiten fort, aber nicht mehr im Sinne einer höheren Ausgestaltung, sondern im Sinne der Altersinvolution, der eine entsprechende Abnahme der Leistungsfähigkeit parallel läuft. Eine scharfe Grenze zwischen dem aufsteigenden und dem absteigenden Aste der Lebenskurve läßt sich nicht ziehen, denn gewisse mit Sicherheit als Altersveränderungen anzusprechende Erscheinungen setzen beim Menschen schon zu Beginn des dritten Lebensjahrzehntes ein. Auch die Altersveränderungen gehen unaufhaltsam ihren Weg. Sie finden theoretisch, vielleicht in ganz seltenen Fällen auch tatsächlich, ihren Abschluß im physiologischen Tode, dann nämlich, wenn sie ungestört und harmonisch fortschreiten, d. h. dergestalt, daß und bis sie in ihrer Gesamtheit und gleichzeitig mit dem Fortbestehen des Lebens nicht mehr vereinbar sind. Der physiologische Tod ist indessen nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Tieren ungemein selten, wenn überhaupt je, festgestellt worden. Die Regel ist eben nicht das harmonische, sondern das disharmonische Altern, bei welchem Teile des Organismus im Altersprozeß vorauseilen und früher insuffizient werden als andere.
Man kann sich fragen, ob das disharmonische Altern als krankhaft und der daran anschließende Tod als unphysiologisch zu bezeichnen sei. Wir empfinden ein gewisses Widerstreben dagegen, den unendlich seltenen Fall allein als physiologisch, die Regel aber als krankhaft anzusprechen. Eine ätiologische Untersuchung, von der man allenfalls die Entscheidung erwarten könnte, führt diese nicht eindeutig herbei. Wenn nämlich äußere Faktoren die Synchronie des Altwerdens stören, so ist das grundsätzlich dasselbe, wie wenn sie auf das Wachstum, die Differenzierung oder auf die Gestaltungsbewegungen modifizierend Einfluß nehmen, denn Altwerden ist Entwicklung. Es erfolgt eine Reaktion von Seiten des alternden Organismus auf eine exogene Wirkung. Das ist natürlich kein reines Altern mehr, sondern eine Krankheit, die mit dem Altern in wechselseitiger Beziehung steht, eine exogen bedingte Mißbildung, wenn man will. Dasselbe gilt für den Fall, daß der äußere Faktor nur bedingt pathogen ist, insofern nämlich, als der Organismus nur auf Grund einer besonderen Disposition, in unserem Falle der durch das Altern gegebenen, auf seine Einwirkung mit einer Veränderung antwortet. Es bleiben also als wirklich disharmonisches Altern nur die Fälle übrig, die ausschließlich durch im Organismus selbst ohne äußere Veranlassung auftretende und ablaufende Zustände und Vorgänge bedingt sind. Wir kennen diese nicht und wissen daher erst recht nicht, ob sie ätiologisch einheitlich sind, Aber aus den Beobachtungen an eineiigen Zwillingen geht hervor, daß das Altern eines gegebenen Individuums recht streng determiniert abläuft. Die nächstliegende Annahme ist also die, daß der individuelle Modus des Alterns im Augenblick der Entstehung des Individuums festgelegt wird. Damit wäre er als im weitesten Sinne ererbt zu betrachten. Wenn das zutreffen sollte, so wäre
wenigstens stark ausgesprochen disharmonisches Altern als Mißbildung aus inneren Ursachen anzusprechen, als ein krankhaftes Geschehen, das im Augenblick der Befruchtung determiniert, aber erst im hohen Alter manifest wird. Mit dem wichtigen Zusatze allerdings, daß das individuell so vielgestaltig ablaufende Altern fließende Uebergänge vom physiologischen zum pathologischen Geschehen erkennen läßt. Damit ist freilich nichts anderes ausgesagt als was die Pathologen längst wissen: daß es keine scharfe Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit gibt.
Der Umstand, daß die Entwicklung die ganze Spanne des individuellen Lebens umfaßt, hat zur Folge, daß sich der morphologische Aspekt des Organismus als Ganzes und in allen seinen Teilen fortwährend ändert. Damit ist die Forderung begründet, daß alle Morphologie nicht Morphostatik, sondern Morphokinetik sein muß. Daß eine Bewegung bestenfalls dann zu verstehen ist, wenn ihr Anfang bekannt ist, setzt die Bedeutung aller Forschung am Keim mit Einschluß der Vererbungslehre in das Licht, in das sie hineingehört.
Aus der Erkenntnis, daß die Entwicklung des Individuums erst mit dem Tode beendet ist folgt weiterhin, daß Entwicklungsstörungen, also Mißbildungen, nicht auf frühe embryonale Stadien beschränkt zu sein brauchen, sondern sich während des ganzen Lebens ereignen können. Albrecht hat vor langer Zeit schon sogar gewisse Tumoren mit guter Begründung als Fehlbildungen, als Hamartome bezeichnet. Die teratogenetische Determinationsperiode derselben ins embryonale Leben zu verlegen, ist sicher nicht in allen Fällen gerechtfertigt.
Die bisher berücksichtigten Gestaltsveränderungen sind der Ausdruck der Entwicklungsfunktion des Organismus. Sie sind vornehmlich das Objekt der anatomischen, der entwicklungsgeschichtlichen und der entwicklungsphysiologischen
Forschung. Zu ihnen gesellen sich nun aber die morphologischen Aspekte derjenigen Funktionen, die das Objekt der Physiologie im engem Sinne bilden. Das sind die Betriebs- und Erhaltungsfunktionen. Ihre Substrate bauen das "Laboratorium" und den "Aktionsapparat" im Sinne von Driesch auf. Auch ihnen hat die Wissenschaft von der Form Rechnung zu tragen. Ihre morphologische Erforschung hat die Aufgabe, die Materie, an der sich die genannten Funktionen abspielen, zu beschreiben, und zwar durch alle zeitlichen Phasen und durch alle Dimensionen hindurch, bis der Anschluß an die Chemie erreicht ist. Denn bei der Kontraktion der Muskelfaser, während der Resorption der Nahrungsstoffe, bei der Tätigkeit der Drüsenzellen, bei der Einwirkung der Hormone, bei der Erregung von Sinnesorganen sind nicht nur chemische Umsetzungen und energetische Vorgänge festzustellen und zu messen, sondern auch in der Zeit ablaufende mikroskopische und makroskopische Phänomene. Auch die Elimination des als Energiequelle oder sonstwie verbrauchten, des "abgenützten" Materials und der Ersatz desselben durch von außen aufgenommene und im Körper assimilierte Nahrungsstoffe bedingen morphologische Erscheinungen. Der restlosen Aufklärung aller dieser Phänomene, der Verfolgung der Materie Schritt für Schritt durch den Organismus hindurch ohne sie aus den Augen zu verlieren, stehen allerdings zur Zeit noch die ganzen Schwierigkeiten entgegen, mit denen das Vordringen in den Bereich der metamikroskopischen Dimensionen verbunden ist.
Entwicklungsfunktionen auf der einen Seite, Betriebs- und Erhaltungsfunktionen auf der anderen spielen sich, soweit wir das zu beurteilen imstande sind, an demselben Substrate ab. Sie lassen sich also nur ihrem Wesen, nicht aber dem Substrate nach von einander trennen.
Eine Sinneszelle, eine Drüsenzelle, eine Muskelfaser, ein nervöses Element entsteht im Verlaufe der Entwicklung auf Grund von Leistungen beider Funktionsgruppen, übernimmt zu einer gegebenen Zeit seine physiologische Aufgabe, und zwar vielfach vor dem Abschluß seiner Ausgestaltung, und genügt ihr dann, bis das Leben des Organismus erlischt. Die Zellen der Oberhaut, die meisten Deckepithelien und die zelligen Elemente des Blutes dagegen entwickeln sich fortwährend aus undifferenziertem Keimmaterial solange der Organismus lebt. Vor Abschluß der Differenzierung beginnen sie schon, ihre zum Teil recht verwickelten Funktionen zu übernehmen. Nach einer Existenz von wenigen Wochen oder Monaten altern sie, sterben ab, werden eliminiert und durch neue Elemente ersetzt. Auch an dem scheinbar so dauerhaften Skelett wird das gesamte Material bis zum Abschluß des Körperwachstums mehr als einmal vollständig erneuert, allerdings nicht auf Grund eines Alters- und Absterbeprozesses, sondern nach Abbau, nach eigentlicher Zerstörung durch ein Gewebe, dessen Elemente gleichzeitig für den Ersatz besorgt sind. Jede Zelle ist ein kleiner, jedes Gewebe und jedes Organ ein größerer Teil des gesamten organismischen Betriebes, der gebaut und ausgerüstet und der betrieben wird, der seine Produkte fabriziert und zur weiteren Verwendung abgibt, der aber auch verbrauchtes Material und Gerät als Schlacken und Abfälle ausscheidet und der infolge dieser Tätigkeiten fortwährend einer Ergänzung und Erneuerung seines Inventars und seiner Rohstoffe bedarf. Der Stoffwechsel ist dermaßen intensiv, daß wohl kein einziges Atom zeitlebens im Körper verbleibt. Und die gegenseitige Verstrickung der Entwicklungsfunktionen auf der einen, der Betriebs- und Erhaltungsfunktionen auf der anderen Seite geht wohl so weit, daß ein gegebenes Molekül nacheinander
oder sogar gleichzeitig beiden dient. Gewisse Hormone wirken ja auf das Wachstum und auf den Kreislauf ein. Als Ganzes ist der Organismus mit einer Stadt zu vergleichen, die gegründet wird, zur Blüte gelangt und untergeht. Am Ende ihres Bestehens ist keine der ursprünglichen Straßen mehr da, kein Haus, das am Anfang gebaut wurde, und die Einrichtungsgegenstände und die Bewohner sind fortwährend andere geworden. Aber die Betriebs- und Erhaltungsfunktionen der Stadt bleiben in ihren Grundzügen vom Anfang bis ans Ende dieselben.
Die bisherigen Ausführungen, so summarisch sie auch sein mußten, heben die Lücken in unserer Erkenntnis und die Beschränktheit unseres Erkennungsvermögens absichtlich besonders hervor. Trotz dieser Lücken liegt kein Grund vor, den gegenwärtigen und den von der Zukunft zu erwartenden Wahrheitsgehalt der Morphologie gering einzuschätzen. Denn die Annahme einer realen, räumlich disponierten Welt, mit der die Morphologie notwendigerweise arbeiten muß, wird von der Mathematik und der Physik geteilt und von der Philosophie zum mindesten nicht eindeutig widerlegt. Diese Welt weist, wie Straßer sich ausdrückt, eine je nach der Oertlichkeit verschiedene Raumfüllung auf und von dieser machen die Körper der Organismen einen Teil aus. Morphologie ist aber nicht nur auf Grund erkenntnistheoretischer Ueberlegungen zulässig, sondern sie hat sich auch auf Grund der Erfahrung immer wieder als praktisch fruchtbar erwiesen. Rudolf Virchow erinnert im ersten Kapitel seiner Zellularpathologie daran, daß zu allen Zeiten die bleibenden Fortschritte der Medizin bezeichnet worden sind durch anatomische Neuerungen, daß jede größere Epoche zunächst eingeleitet wurde durch eine Reihe bedeutender Entdeckungen über den Bau und die Einrichtung des Körpers. Er erwähnt die Alexandriner, Vesal, Bichat und
Schwann. Seither hat sich diese Reihe durch die Bakteriologen, die Anatomen Golgi und Ramon Cajal, die Entwicklungsmechaniker Roux und Spemann und in neuester Zeit durch die Virusforscher verlängert. Mehr als einmal schien es zwar, die Morphologie werde durch Physik, Chemie oder durch eine Physiologie, die ihrer glaubte entraten zu können, mehr oder weniger weitgehend entwertet. Besonders eindrücklich, weil wir sie miterlebt haben, trat diese Tendenz nach dem ersten Weltkriege hervor. Aber kaum zehn Jahre später richteten die führenden Firmen der pharmazeutischen Industrie, eine nach der anderen, reich ausgestattete Laboratorien für morphologische Untersuchungen ein. Dieses Ereignis darf gewiß als eine untrügliche Legitimation der Morphologie betrachtet werden.
Freilich steht der Morphologie, auch wenn sie auf ihrem ganzen Gebiete die heute zur Verfügung stehenden Mittel zum Erkennen, soweit sie theoretisch reichen, restlos ausgeschöpft hätte, keine andere Möglichkeit offen als die, den Organismus als Materie und Energie zu betrachten. Denn was sie über das lebende Wesen auszusagen hat, betrifft unmittelbar nur das materielle Substrat, an welches die Lebensäußerungen gebunden erscheinen. Je eingehender sich die Morphologie im weitesten Sinne damit beschäftigt, umso deutlicher offenbart sich, daß Materie und Energie im Organismus unter der Herrschaft einer besonderen Gesetzlichkeit stehen (Driesch), die wir schlechthin als Leben bezeichnen. Das Leben als solches kann seinem Wesen nach nicht Gegenstand morphologischer Forschung sein, denn es ist immateriell. Nur Aeusserungen des Lebens, die sich an einem materiellen Substrate abspielen, sind auf Grund von Zustandsänderungen am Substrat der Feststellung zugänglich. Der Organismus ist zwar ein materielles System, wie Driesch sich ausdrückt,
und dieses untersteht den im Unbelebten wirksamen Kausalfaktoren, außer ihnen aber noch grundsätzlich andersartigen, eben den vitalen. Wenn also vom "Mechanismus" der Lebenserscheinungen die Rede ist, so braucht diese Namengebung keineswegs auf der Voraussetzung zu beruhen, daß sich das organismische Leben in Geschehnisse anorganischer Art, etwa in Chemie und Physik, restlos auflösen lasse. Nicht ob, sondern wie weit das möglich sei, müßte die Frage lauten. Um sich der Antwort mehr und mehr zu nähern, arbeitet die Morphologie als ob ihr Erkennungsvermögen unbeschränkt wäre, trotzdem sie vielfachen Grund zur Vermutung hat, daß das nicht der Fall sei. Sie geht dabei nicht nach einem bestimmten Plane vor. Sie hat als mikroskopische und makroskopische Morphologie nicht erst die moderne Entwicklung der physiologischen Chemie abgewartet, bevor sie sich selbst an die Arbeit begab. Ebensowenig wartet sie den Abschluß ihrer eigenen deskriptiven Forschung einschließlich ihres Anschlusses an die Chemie ab, bevor sie ätiologische Fragen angeht. In eine streng gebundene Marschroute läßt sich eben der menschliche Geist nicht hineinzwängen. Von allen Seiten her und nach allen Richtungen hin stößt er vor, zunächst unwissend und später unbekümmert darum, welche Vorfragen erst zu beantworten wären und ob er von richtigen Voraussetzungen ausgeht; oft genug daher mit dem Ergebnis, daß die Voraussetzungen geändert werden müssen und daß längst gewonnene Resultate durch Entdeckungen auf anderen Gebieten in ein ganz neues Licht gestellt werden. Niemand wird diese Situation beklagen. Denn nur so wird die Fülle von Fragen offenbar, welche die Forschung zu beantworten hat. Es ist kein Nachteil, sondern ein Gewinn, daß es eine kausale Morphologie gibt, trotzdem ihre Voraussetzungen noch unvollständig ausgebaut sind.
Durch ihr Objekt und ihr Erkennungsvermögen in ihrer Zielsetzung bestimmt, kann die Morphologie nur einen bescheidenen Anteil an der Wissenschaft von den Organismen und vom Menschen haben. Denn über alles, was immateriell ist, über das Leben als solches, über Geist und Seele hat sie nichts auszusagen. Sie hat sich als eine Naturwissenschaft zu ihrer heutigen Gestalt entwickelt. Sie ist also den gleichen Weg wie die Medizin gegangen, aber vielfach unabhängig von ihr. Aber sie hat den Anschluß an die Medizin wiedergefunden, in erster Linie an die Physiologie. Und die Medizin glaubte zu keiner Zeit ungestraft, sie entbehren zu können, wenn sie schon als Heilkunde nicht nur der materiellen Seite des Daseins, sondern auch der immateriellen ihre Aufmerksamkeit zuwendet. Krankheit ergreift ja auch die Seele und den Geist. Wenn wir ihren Begriff so weit fassen, wie wir es getan haben, so ist die Morphologie eine Grundlage der Biologie und damit auch der Heilkunde. Sie ist die Lehre vom materiellen Substrat der Lebensvorgänge.






