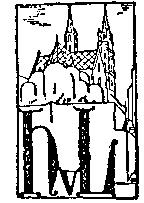ÜBER DAS NATURGEMÄSSE LEBEN DER ALTEN ATHENER
Rektoratsrede gehalten an der Jahresfeier der Universität Basel
von
Verlag Helbing & Lichtenhahn — Basel 1943
Druck von Friedrich Reinhardt AG., BaselHochansehnliche Versammlung!
Zum vierten Male in dieser Zeit der Not und Gefahr begehen wir die Feier der Gründung unserer Universität, in tiefer Dankbarkeit dafür, daß wir sie begehen dürfen, daß mit der Freiheit des Landes die Freiheit der Wissenschaft uns erhalten geblieben ist. Ihrer bedarf in besonderem Maße die Kunde vom klassischen Altertum; sind es doch die Griechen gewesen, die der Menschheit die Freiheit des Geistes und der Persönlichkeit gebracht haben. Unsere Stadt trägt einen griechischen Namen, Basilea, «Kaiserstadt»; man darf sich ausmalen, die ältere Siedlung habe ihn und nicht einen lateinischen zur Zeit jenes Kaisers erhalten, der in unseren Gegenden weilte, ehe er auszog, das Reich in Besitz zu nehmen und, freilich vergeblich und zu spät, nochmals den hellenischen Göttern und dem hellenischen Geiste zu unterstellen. Unsere Stadt hat dann als erste unseres Landes die neu erweckten Studien des Griechischen gepflegt und sie stets lebendig erhalten. Dem gegenwärtigen Rektor, der die Ehre hat, das Fach der griechischen Philologie an der Universität zu vertreten, sollte es darum nicht schwer fallen, den Gegenstand für die heutige Ansprache zu finden.
Ein vor nicht langer Zeit verstorbener Lehrer
unserer Universität pflegte gelegentlich sich zu äußern, er glaube nicht, daß die Schätzung des klassischen Altertums noch lange anhalten werde. in früheren Zeiten, und so noch in der Epoche Goethes, hätten die klassischen Völker auch darum einen besonderen Nimbus gehabt, weil das von ihnen Hinterlassene dem Neuem auch in technischen und materiellen Dingen überlegen war; ein Kolosseum habe schon als technische Leistung imponiert. Solches könne heute nicht mehr gelten.
Unser geistreicher Kollege, dem persönlich nichts ferner lag, als das Altertum herabzusetzen, hatte doch wohl nicht recht. Mag man sogar den einzelnen künstlerischen Werken des Altertums aus den neueren Zeiten einzelnes Ueberlegens entgegenhalten können —das Dauernde und immerzu Lehrreiche an den Alten sind weniger die einzelnen Produktionen, es ist vielmehr ihre Art, sich zum Leben zu stellen und es zu gestalten; sie hat sie auch zu jenen Schöpfungen geführt. Die Griechen scheinen nun einmal für die Aufgaben des Lebens die entsprechendsten, die vorurteilslosesten, die natürlichsten Lösungen gefunden zu haben. Primitive Aengste und Bindungen, metaphysische Wunsch- und Furchtvorstellungen hielten sie verhältnismäßig wenig nieder, und sie, denen das Göttliche in der äußeren Natur und der des menschlichen Geistes und Gemütes erschien, hatten keinen Anlaß, sich frivol zur Natur zu verhalten.
Auch theoretisch ist den Griechen bewußt geworden, daß sich im naturgemäßen Leben die Bestimmung des Menschen, sein Ziel, sein Glück erfülle. In der Zeit der Sophisten ertönte laut der Ruf vom
Gegensatz des in der Natur liegenden wahren Guten und Richtigen zum nur durch Brauch und Gesetz Geltenden. Dieses an sich bloß formale Schlagwort konnte freilich verschiedenen Inhalt bekommen.
Folgewichtiger war es, daß im vierten Jahrhundert ein großer Naturforscher es unternahm, die Bestimmung des Lebenszieles biologisch zu erfassen. Dieser, Eudoxos von Knidos, trug seine Lehre zur Zeit Platos und in dessen Akademie vor. Es gehört ja mit zu den beispielhaften Tatsachen der griechischen Geistesgeschichte, daß oft gleichzeitig und in größter Nähe die entgegengesetzten oder, wenn man will, komplementären Weisen der Einstellung, der Wertung, der Formung in Erscheinung getreten sind. Wie etwa Homer neben Hesiod, Sappho neben Alkaios, Tragödie neben Komödie. schlichter Stil neben geschmücktem, Epikur neben Stoa steht, so treffen wir nicht zufällig neben Platos Begründung des guten Lebens auf die Erkenntnis der ewigen Idee diese naturalistische Ethik. Wahrhaft großzügig hat Plato, um der Wahrheit und der Bedeutung des Mannes willen, dem Eudoxos den Zutritt nicht versagt, einem Wolf im Schafstall. Denn nun ist es so gekommen: Zwar ist Platos schriftstellerische Kunst allzeit bewundert worden, aber seine Lehre hat sogar in seiner Schule nicht über die Generation der Enkel hinaus Wirkung gehabt. Sie blieb dem griechischen Fühlen lange fremd, bis sie schließlich von den Außenposten der neuhellenisierten Oikumene her wieder ins innere Griechenland getragen wurde. Die führenden älteren Hellenisten, deren Weltansicht wir kennen, sind alles eher als Platoniker gewesen. Und unter den bedeutenden
attischen Politikern ist von Plato beeinflußt nur jener mit moralistischem Fanatismus über das geschriebene Recht sich hinwegsetzende Restaurator eines streng-religiösen und streng-sittlichen Alt-Athens, der Poseidon-Erechtheuspriester Lykurgos, der nach der Niederlage bei Chaironeia mehrere Jahre den Staat leitete. Hingegen des Eudoxos Problemstellung hatte Erfolg. Hatte zwar er die Lust als das naturgemäße Ziel des Lebens erklärt, weil aller Lebewesen unmittelbarer Trieb darauf sich richte, so hatte die weitere Diskussion bald die gestellte Frage auch anders beantwortet. Andere Denker hatten in der Selbsterhaltung das Ziel des Urverlangens erkennen wollen; und da der Mensch ein vernünftiges Wesen ist im Gegensatz zu den Tieren — da er ein nur in Gemeinschaft existierendes ist, mußte sein natürliches Streben eine andere natürliche Ergänzung erhalten als das der Tiere, und auch sein soziales Verhalten konnte die biologische Begründung bekommen. Aber das Bezeichnende ist nun eben, daß sich hinfort jede Ethik diese biologische Begründung schuf: das entsprach, das lag dem griechischen Denken, weil es dem griechischen naturgemäßen Leben selber entsprach. In welchem Maße, dies möchte ich in den folgenden Sätzen, die dem Altertumskenner meist geläufige Dinge bringen werden, ausführen, und über das naturgemäße Leben der alten Athener sprechen. In Athen hatte ja das Griechentum sein Wesen gefunden; von den Athenern konnte Plato das schöne Wort sagen, daß sie allein, ohne Zwang, aus eigener Natur dank göttlichem Geschick wahrhaft und ungekünstelt tüchtig sind (Leg. 642).
Es sei mir gestattet, mehr das Ideal des attischen Lebens als die ihm wie allem Menschlichen anhaftenden Unvollkommenheiten des wirklichen Lebens hervortreten zu lassen. Wir sind heute dazu berechtigt; denn im Rückblick von unseren Tagen her, anders als in manchen Zeiten des neunzehnten Jahrhunderts, erscheint uns jene attische demokratische Welt wieder wünschenswert; jedenfalls war sie die menschenwürdigste und menschlichste Organisation, zu der das gesamte Altertum überhaupt gelangt ist, und eine, von der wir noch lernen können. Die dunkeln Farben, die im Widerspruch zu herkömmlicher Schönrednerei der Schöpfer des großartigen Griechenbilds zur Zeit unserer Väter und Großväter aufgetragen hat, sind am Urbild gewiß vorhanden, aber unsere Augen sehen nun wieder die lichten Züge. Freilich, tiefer und treffender vermöchte nie mehr ein Nachgeborener von der attischen Demokratie Herrlichkeit zu reden, als es der Staatsmann tut, der sie selber zur Höhe geführt hat, Perikles, in den Worten, die ihm nach ihrem Fall Thukydides in den Mund legt.
Gleich der älteste als Persönlichkeit bekannte Athener lehrt uns, daß das Gesetz attischer Lebensgestaltung nichts anderes sein will als das Unternehmen, das Streben und Wollen der natürlichen Anlage zur geklärten Verwirklichung zu bringen. Darum konnte Solons Gesetzgebung immer in Geltung bleiben, sein Ansehen hat nie Minderung erfahren; er war zwar nicht der Schöpfer der demokratischen Gleichheit, aber sie lag in der Konsequenz seiner Tat. An der Spitze der geistigen Geschichte Athens ist er die reinste Verkörperung des Athenertums. Vor einigen
Jahren ist dargelegt worden, wie die in den Resten seiner Gedichte uns entgegentretende Erkenntnis, daß Zerstörung der sozialen und politischen Ordnung und alles damit verbundene Unheil notwendige Folge der Verletzungen des Rechts sei, wie diese Erkenntnis eines Gesetzes in den menschlichen Verhältnissen nicht zufällig dem Aufkommen der ionischen Naturphilosophie beinahe gleichzeitig ist, die in der äußeren Natur dasselbe Gesetz notwendiger Folge feststellte. Die Grundgedanken ionischer Physiké wendet Solon auf das menschliche Leben an.
Es sind nun aber nicht nur die in den Gedichten ausgesprochenen Betrachtungen, die Solons Denkform uns zeigen, mehr lehrt uns darüber die Gesetzgebung selber, die wir ja im wesentlichen kennen. Zum guten Staat, den Solon den Athenern schaffen will, führt kein Zwang und kein Gebot, nur von innen her, aus der menschlichen Natur heraus, kann er zustande kommen, und zwar so und dann, wenn er in jedes Bürgers Interesse liegt und jeder Bürger auf seine Rechnung kommt. Das ganze Volk richtet als letzte Instanz: darum die Gründung der Heliaia. Jeder Bürger kann Klage erheben, wenn er ein Recht verletzt glaubt, das die bürgerliche Ordnung und die Ehre der Bürger, die die Gemeinde bilden, garantiert: darum das Institut der öffentlichen Klage. Ebenso kann der zum Reden nicht Fähige jeden Bürger als Helfer im Prozeß beiziehen: darum die Synégoroi, Syndikoi. Jeder kann die Beamten zur Rechenschaft ziehen: die Euthyna. Wie jeder an der Erhaltung des Rechtszustands interessiert ist, so hat demnach auch jeder die Möglichkeit erhalten, aktiv
dafür einzutreten. Er muß dies auch in Notzeit: ein zwar später nicht mehr zur Anwendung gekommenes Gesetz bestimmte, daß im Bürgerzwist jeder Partei ergreifen müsse. Auf diese Weise erstrebte Solon, daß durch persönliches Eintreten des einzelnen Bürgers der Staat zu einer natürlichen und tatsächlichen Eintracht und Einheit geführt wird. Kommt sie nicht zustande, wird die Folge auch der Einzelne notwendig verspüren. So sind im Körper die einzelnen Glieder auf das natürliche Zusammenwirken aller angewiesen; wenn eines leidet, leiden alle; und die staatliche Gemeinschaft und Einheit ist dann am besten gewahrt, wenn die nicht durch ein Unrecht Betroffenen gleich wie die Betroffenen ahnden und züchtigen. Wir dürfen den Vergleich des Staats mit dem menschlichen Organismus wohl schon Solon vindizieren, von dem ihn der spätere Darsteller genommen hat.
Solon sah den Menschen wie später Aristoteles als Zoon politikon; er setzte voraus, daß das Wissen ums Recht und das Wollendes Rechts jedem Athener angeboren ist, wie es der Mythos des platonischen Protagoras für die Menschen überhaupt tut. Es ist die Auffassung des athenischen Volkes selber. Darum ist ja in Athen ein besonderer Stand der Juristen nie aufgekommen, Staatsanwalt und Berufsrichter kannte Athen nicht, weil jeder diese Funktionen übernimmt und erhält. Das Volk selber hat sich in der Rechtskenntnis erzogen. Die in der Folgezeit so außerordentlich weiterentwickelte und differenzierte Gesetzgebung, die jede bisherige übertraf und dem Hellenismus als Muster diente, ist durch Anträge beliebiger Athener, durch die Kraft ihrer überzeugenden
Rede und die Zustimmung schließlich des versammelten Volkes zustande gekommen, auch die großartige Weiterbildung des athenischen Staatsrechts, wenn wir auch oft den Namen des Staatsmannes kennen, der den Antrag stellte.
Wir haben hier nicht zu klagen über die unleugbaren und ungeheuren Mißbräuche, zu denen das solonische Prinzip im Lauf der Geschichte dem leidenschaftlichen Charakter des Volkes Hand bot. Niemand hat die Athener stärker angeklagt als sie selber, ihre Komiker, ihre Redner, ihre Philosophen. Aber politische Gegnerschaft, Spott und Scherz, sittliche Aufrüttelung pflegen nicht die Zustände mit gelassener Billigkeit so zu sehen und darzustellen, wie sie wirklich sind, und wenn die Modernen daraus ein Bild des Grauens hergestellt haben, um so einseitiger, je ferner sie den Quellen standen, so war das ein verzerrtes Bild. Derselbe Redner etwa, der seinen Mitbürgern ihre Schande ins Gewissen sagt, kann bei anderer Gelegenheit wieder Athen den größten Gesetzesstaat nennen.
Voll verwirklichen konnte sich Solons Ordnung erst in der dritten Generation, als nach erneuten Standeskämpfen und nach der Tyrannis der Peisistratiden, die den wirtschaftlichen Ausgleich begünstigte, die Zeit der eigentlichen Demokratie gekommen war. Die Zerreißung der alten Blutsverbände durch Kleisthenes bei der Organisation des Staats war zwar ein gewaltsamer Akt. Aber die Athener haben ihm zugestimmt, und dahinter zurückzugehen ist auch den späteren Reaktionären nicht mehr eingefallen, während die solonische Berechtigungsabstufung nach dem
Besitz, die durch den Ausbau der Demokratie eingeschränkt wurde oder von selbst bedeutungslos geworden war, dem Wunsch mancher nach einer relativen, nicht absoluten Gleichheit doch so sehr entsprach, daß sie sich bei Revolutionen als Prinzip immer wieder einstellte.
Grundlegend ist nun aber in der neuen Demokratie geworden, daß einem tiefsten Wunsche der attischen Seele, den schon Solon formuliert hat, Rechnung getragen ist: Jeder Athener kann hinfort einmal im Leben der erste Mann des Staates sein, als Vorsitzender der Volksversammlung, des Rates und seines Ausschusses. Im ständigen Wechsel des Befehlens und Sichbefehlenlassens trifft ihn einmal der große Tag seines Lebens. Es gilt eben, daß die Anlage jeden Athener dazu befähigt, und Sokrates hat, als der Zufall ihm den Tag in die Hände spielte, gegen die Verhetzung aller übrigen diese Befähigung bewiesen, indem er allein die ungesetzliche Abstimmung über die unglücklichen Feldherrn der Arginusenschlacht nicht zulassen wollte. Im Turnus fällt das Jahresamt dem Bürger, der sich gemeldet hat, zu durch das Los. Nicht mehr bedeutet das Los, wie in alten Zeiten, ein Gottesurteil; es besagt nun, daß jeder den anderen gleichwertig ist. Kein Amt hat mehr charismatischen Charakter. Auch sind die eigentlichen Aemter nicht durch eine Hierarchie organisiert, und sie stehen unter der beständigen Aufsicht aller, vor dem Antritt, während der Amtsführung und ganz besonders beim Abgang vom Amt. Bei der Rechenschaftsablegung geht der Beamte nochmals durch das Feuer der öffentlichen Kontrolle. All das hat den Zweck,
durch das Zusammenwirken der Gesamtheit den Uebergriff des Einzelnen zu verhüten.
Die Folge ist natürlich, daß den Beamten, soweit sie nicht gewählt sind, keine große Bedeutung zukam. Vermieden wird aber im Ganzen jene erniedrigende Form der Ambitio, die uns aus Rom und nicht nur aus Rom geläufig ist. Es wird nicht darüber geklagt, daß etwa die vornehmsten Beamten, die Archonten, ihrer Funktion nicht genügten. Die Anlage der Athener hat auch dieser natürlichen Konsequenz einer wahren Volksherrschaft in der Polis entsprochen.
So hat denn auch dieser so durchorganisierte Staat offiziell nie den abstrakten Titel einer unpersönlichen Gewalt geführt; nicht der Kanton Basel, nicht la République française, sondern das Volk der Athener haben sie sich genannt. Und Athen ist alles andere als eine Bürokratie gewesen.
Das Ideal vom guten Staat, in dem alle Bürger zusammen einmütig das Recht aufrechterhalten, ist schon bei Solon verbunden mit dem andern Ideal der privaten freien Lebensgestaltung. Was die klassische Demokratie proklamiert: ein Leben nach eigenem Gefallen, das entspringt dem Wünschen des beliebigen Atheners, aber es entspricht der bewußten Absicht des alten Gesetzgebers. Solon selber hat sich die natürlichen Genüsse des Lebens gegönnt und das Streben nach Reichtum nicht verpönt, wenn nur gilt, daß dabei keine Ungerechtigkeit gegen andere geschieht. Die Wahl des Handwerks steht jedem frei, auch die der Vereinigung, es gibt hier keine vererbten Berufe.
Solon hat, seine persönliche Autonomie mit einer
Unverhülltheit ausgesprochen, die unserer Befangenheit beinah anstößig ist. Auch damit geht er seinen Athenern voran, deren Parrhesia zu den Distinktiven gehört. In keiner griechischen Stadt herrschte eine Redefreiheit wie in Athen, wo sich sogar die Sklaven dies gleiche Recht anmaßten wie ihre Herren. Die Offenheit der Sprache ist eine Offenheit des Geistes. Sie führte zu jener unvergleichlichen Selbstdarstellung im Spott der Komödie über die eigenen Eigenschaften, in der Analyse der politischen Motive und des Volkscharakters durch Thukydides, in der Aufdeckung der menschlichen Verborgenheiten durch die Redner, in der Bloßstellung des üblichen Handelns angesichts der sittlichen Forderung durch Plato, jene Selbstobjektivierung, die gerade daran schuld ist, daß Athen sich uns so viel schlimmer darzustellen scheint, als es wirklich war. Denkbar war sie in einer Gesellschaft, die sich auch von der Tyrannis der öffentlichen Meinung nicht unterjochen ließ.
Solon, indem er den Weg zur wahren staatlichen Gemeinschaft wies, hat dem einzelnen Freien seine Würde gegeben. Er hat den realen Staat ohne Zwang unter die Idee des Rechts und der Freiheit gestellt und damit Größeres getan als alle Theoretiker eines Idealstaats.
Werfen wir nun einen Blick auf die Bevölkerung im Athen der beiden klassischen Jahrhunderte, wie weit ihre Gruppierung eine naturgemäße war. Jedenfalls ihre Zahl hat das Uebersichtliche, das auch die Theoretiker von der richtigen Polis verlangen, wenn diese auch mit viel kleineren Zahlen rechnen, doch besessen. Nur der Kleinstaat, nicht der Massenstaat
schien den auf den natürlichen Anlagen der Menschen beruhenden Volksstaat garantieren zu können. Dabei müssen wir freilich bedenken, daß seine für uns erstaunliche Kleinheit bedingt war durch die mangelnden Kommunikationsmittel. Aber der verfassungmäßige Großstaat lag außerhalb der Erfahrung; Vorwürfe, daß etwa Aristoteles in der Makedonenzeit ihn außer acht gelassen hätte, erübrigen sich. Der delische Seebund konnte sich nicht zü einem attischen Reich, wie man unrichtig sich ausdrückt, sondern nur zu einer attischen Herrschaft, der des Monarchen Athen über die andern, auswachsen.
Die Höchstzahl im Altertum erreichte das perikleische Athen, das in den peloponnesischen Krieg zog. Damals mag die freie Bevölkerung Attikas — nach keineswegs sicherer Berechnung — 200000 Menschen betragen haben und ebensoviel die Zahl der Sklaven. Von den Freien hätten die Bürger annähernd 140000 gezählt. Nach dem Krieg sank die Bevölkerungszahl sicher beträchtlich infolge der großen Kriegsverluste und des wirtschaftlichen Rückgangs; auch nach ihrem Wiederaufstieg im vierten Jahrhundert hat sie nie mehr die Menge des fünften Jahrhunderts erreicht. Umgekehrt ist die Stadt Athen gerade im peloponnesischen Krieg durch das Hineinströmen der Landleute volkreicher geworden; so groß aber wie unser heutiges Basel wurde sie trotzdem kaum. Wenn man nun bedenkt, daß nur die Bürger voll zählen, so versteht man, daß man sich in Athen im allgemeinen kannte, zumal da das Bürgertum stabil blieb. Beides kann man aus den Inschriften ablesen:
die bei den Schriftstellern genannten Persönlichkeiten lassen sich mit in den Inschriften Eingegrabenen immer wieder identifizieren. Stammbäume lassen sich dank ihnen über Generationen feststellen. Dieser Eindruck von den Leuten in Athen, den die berühmte attische Prosopographie aus der Zeit um 1900 vermittelte, wird durch die Massen der von den Amerikanern auf dem Markt neu ausgegrabenen Inschriften nur bestätigt und verstärkt. Zum Gefühl der Einheitlichkeit trug auch wesentlich bei, daß man dieselbe Sprache sprach, nicht nur, was besonders erstaunlich ist, auf dem ganzen attischen Gebiet, das immerhin etwa so groß ist wie der Kanton Tessin, sondern auch in den einzelnen Gruppen der Bewohner. Die sprachliche Unterschicht hat nach den Vasenaufschriften und den Fluchtafeln in Athen nicht gefehlt; aber das fiel nicht so auf, daß der Dialekt wirklich nach Ständen sich gesondert hätte; wir wüßten das sonst aus der Komödie, die ja gerne mit außerattischen Dialekten oder griechischem Radebrechen von Barbaren scherzt.
Nichts pflegt die Modernen an der antiken und so auch an der attischen Gesellschaft mehr zu schockieren als die Tatsache, daß sie nur dank dem Vorhandensein der Sklaverei existiert. Dabei vergessen wir einmal, daß jede Hochkultur des Altertums die Sklaverei kennt, vornehmlich aber, daß unsere Einstellung neben dem Christentum gerade auf das griechische Naturrecht zurückgeht. Nicht daß sie die Sklaverei beibehielten, sondern daß sie auch ihre Berechtigung bestritten, ist für die Athener der Sophistenzeit charakteristisch. «Die Natur hat uns
alle, Griechen und Barbaren, gleich geschaffen», diesen Satz konnte man damals, als die Leidenschaft das Leben kata physin, nach der Natur, einzurichten en vogue war, hören als Widerspruch zum andern, daß die Natur den Griechen zum Freien, den Barbaren aber zum Sklaven geschaffen habe. Der Einfall, die Sklaverei aufzuheben und den Gedanken in die Praxis umzusetzen, konnte einem einzelnen griechischen Staat, auch dem griechischen Volk inmitten seiner Umwelt, nicht in den Sinn kommen. So haben denn auch die großen attischen Denker mit Barbaren als Sklaven gerechnet, und endlich die Stoa in der Theorie und im Beispiel gelehrt, daß auch der Sklave das Lebensziel, das Glück und die innere Freiheit erreichen kann. Und daß es die Eigenschaften des Sklavischen und des Freiheitlichen gibt, drückt das Attische durch doch wohl zutreffend an der menschlichen Natur beobachtete Bezeichnungen aus. Weil der attische Charakter nicht sklavenhaft war, haben die auf ihre Freiheit stolzen Athener die ihnen unwürdig scheinenden, aber eben doch notwendigen Beamtungen Sklaven, die dem Staat gehörten, zugewiesen: der mit Brachialgewalt operierenden, zur Verfügung der Behörden stehenden Polizei, den 300 gekauften sog. Skythen, dem Henker, den Folterknechten; auch manche Bürodienste sind dem Athener so minderwertig erschienen, daß er sich dazu nicht hergeben wollte. Im Leben haben dann freilich die Athener ihre Sklaven, zum Aerger der konservativ Eingestellten, meist wie jeden andern Menschen mit großer Humanität behandelt, und die Gesetzgebung hat sie nicht ohne Rechtsschutz gelassen. Gewiß spielte da
auch der Eigennutz hinein; denn die Gefahr, daß einem die Sklaven davonliefen, war groß. Aber deswegen kennt nun die Zeit der Demokratie nicht die Drohung von Sklavenrevolten, häufig vielmehr die Freilassung für dem Staat geleistete Dienste, neben den unzähligen privaten Freilassungen durch den Herrn aus persönlicher Dankbarkeit. Der treue, auf den jungen Herrn achthabende Pädagoge, die zur Familie gehörende alte Amme sind aus dem athenischen Haus nicht wegzudenken, und das in Tracht und Redefreiheit es mit dem Bürger aufnehmende Gehaben der Sklaven, über das der Aristokrat des fünften Jahrhunderts sich aufregt, hat in der Komödie des vierten seine Wiederholung, wo der gerissene Sklave oft genug seinem Herrn zum Guten oder Schlechten dank seiner Ueberlegenheit hilft. Trotzdem, das Vorbild aller Demokratien, Athen, hat nur mit Sklaverei existieren können.
Anders als im fremdenfeindlichen Sparta ließen die Athener unter sich zahlreiche fremde Niedergelassene leben, die Metöken; auch sie haben sie mit untrüglichem Instinkt behandelt. Es ist uralte griechische Auffassung, daß die Fremden unter Zeus' Schutz stehen; man kennt in Athen ihren Wert für das Ganze, weil Handwerk, Industrie, zumal aber der Handel ohne ihre Tätigkeit nicht zu denken sind. Aber jeder Metök, der nicht wegen Verdiensten dem Bürger in Dienst- und Steuerpflicht durch Volksbeschluß expreß gleichgestellt worden ist, hat jährlich eine Sondersteuer zu entrichten; er kann nicht Landeigner sein, er braucht zum Prozeßführen einen bürgerlichen Patron, und seit dem Bürgerrechtsgesetz
von 451, das die demokratische Restauration nach 403 bestätigte, bestand keine normale Ehe zwischen Bürgern und Metöken. Kinder solcher Verbindungen werden nicht Bürger, sind Bastarde; auch der von Perikles und Aspasia gezeugte Sohn mußte durch Volksbeschluß ins Bürgerrecht aufgenommen werden. Es war bezeichnenderweise gerade die zur vollen Entwicklung gekommene perikleische Demokratie, die jenes Gesetz erließ. Im Gegensatz zu den Staatsleitern der vorhergegangen Generation, die sich mit Töchtern auswärtiger Adeliger verheirateten, ja mit Tyrannen und barbarischen Fürsten verschwägerten, denen sie sich ebenbürtig fühlten und die ihren politischen Zielen nützen konnten, hält die Demokratie auf Reinheit des Blutes. Ebensosehr hat sie das Interesse geleitet, man wollte die Vorteile der attischen Herrschaft mit möglichst wenig Konkurrenten teilen. Natürlich kennt Athen die Bürgerrechtserteilung im besonderen Fall, freilich nur durch das Gesamtvolk und nach Gesetz nur als Gegenleistung für eine Leistung des Bevorzugten zum Nutzen des attischen Volkes. Bürgerrechtserschleichungen, wie sie bei der im Vergleich zu heutigen Verhältnissen mangelhaften statistischen Kontrolle sich dauernd einstellten, so daß von Zeit zu Zeit Revisionen der Listen nötig wurden, widerlegen nicht, daß Athen als Demokratie sich am allerwenigsten wegschenkte, und einer der zügigsten Vorwürfe an den Gegner war, er sei eigentlich kein echter Bürger. Sodann, das passive Wahlrecht des Eingebürgerten kam dem des Altbürgers nicht sofort gleich. Dasselbe Athen, das im Munde des Isokrates
von sich behauptet, attische Kultur mache erst den Griechen zum Griechen, hat manchem Träger dieser Kultur nie die Ehre des Bürgerrechts zuteil werden lassen. Ein Lysias, der einer hochangesehenen Familie angehörte, hat es trotz seiner großzügigen Unterstützung der populären Partei vor der Restauration von 403 nur zum bevorrechteten Metöken, nie zum Bürger und einem nicht hinten herum wirkenden Sachwalter bringen können; und doch gilt mit Recht sein Stil im späteren Altertum als der Inbegriff des guten Attisch. Hier war eingetreten, wofür wir ja auch anderwärts Analogien wissen: gerade der Syrakusaner hatte sich in die Sprache seiner Adoptivheimat besonders intensiv eingelebt. Und wie die Redekunst, so ist die attische Tragödie, die Philosophie, die Malerei auch in der Hand von Metöken attisch geblieben.
Wer wird sich nicht daran stoßen, wenn die Behandlung der Frau im klassischen Athen eine naturgemäße genannt wird? Ist uns doch bekannt, daß gerade in der klassischen bürgerlichen Zeit Athens, anders als in Sparta, anders als in der Welt, deren Bild Homer fingiert, die Frau in enger Beschränkung hat leben müssen. Zeitlebens ist sie unter Vormundschaft: erst des Vaters, dann des Gatten, und als Witwe des Sohnes. Und auch die in ihren Rechten durch den vornehmsten Beamten, den Archon, geschützte Erbtochter ist nur darum geschützt, um das Erbe und die Kontinuität der Familie von ihrem Vater auf ihre Söhne zu übertragen. Sofern nicht zwingende Verhältnisse es erfordern, bewegt sich das Leben der Frau im Innern des Hauses: das Ausgehen, zumal das
der Unverheirateten, ist von Vorsichtsmaßregeln umgeben; die Frau verkehrt über die Familie hinaus nur mit Frauen; an Gesellschaften nimmt sie nur teil, wenn es sich um ein Familienfest handelt. Für ihre Bildung wird kaum gesorgt. Werden diese Grenzen überschritten, so fällt sie in den Verdacht, keine ehrbare Frau zu sein. So erklärt sich der unberechtigte Vorwurf, der eine bedeutende und selbständige Frau traf, Aspasia, die als Fremde mit Perikles nicht die legitime attische Ehe eingehen konnte. All das sind nicht nur Vorschriften gewesen — wir müssen annehmen, daß sich das Leben der Athenerin tatsächlich meist in dieser Enge abgespielt hat. Weiblicher Ehebruch —der eindrucksvolle Fall eines solchen ist in einer Rede des Lysias erzählt war sicher eine Seltenheit, und die Scherze der Komödie über die Frauen übertreiben grotesk. So ist auch nicht die friedenstiftende Lysistrate und die den Staat revolutionierende Praxagora des Aristophanes, wie man sagt, aus dem Leben gegriffen; die Phädra des Euripides, so wahr in ihr Tiefen weiblicher Seele ans Licht gebracht sind, ist ein Kind der Poesie, und dies muß auch für die Antigone des Sophokles gelten.
Daß aber trotzdem die attische Weise den Bedürfnissen attischer Weiblichkeit gerecht geworden ist, möchte ich verdeutlichen, indem ich Ihnen eine Novelle von einer modernen Griechin hier kurz nacherzähle, die mir ausgezeichnet das Wesen der griechischen Frau zu erfassen scheint. Der Graf Gobineau hat 1867 nach seinem Aufenthalt in Griechenland aus Erfahrungen und Erinnerungen in seinen «Souvenirs de voyage» folgende Geschichte erzählt:
Der Kommandant einer englischen Kriegskorvette in der Aegaeis ist einer kleinen Havarie wegen genötigt, auf der Insel Naxos Station zu machen. Im Haus eines vornehmen Naxioten lernt er die wunderschöne junge Tochter kennen, das Patenkind des englischen Konsuls. Sie hat keine Bildung, zeigt in der Konversation keine Kenntnis der Außenwelt, ist aber von gesunder Natürlichkeit; für den Engländer ist es der vollständige Gegensatz zu allem, was ihm bisher gefiel, aber er verliebt sich in das Mädchen. Der mehrmalige Besuch des Fremden macht das Mädchen zutraulich. Als das Schiff wieder seetüchtig ist, lädt der Offizier den Konsul und dessen Freund mit der Tochter zu einer kleinen Seefahrt ein, das Wunder des Vulkans von Santorin zu sehen. Akrivia freut sich an der Schönheit des Marmors von Antiparos; statt der naturwissenschaftlichen Erklärung vom Vulkan, die Norton gibt, dächte sie sich freilich das Naturwunder lieber durch Riesen unter dem Berge oder durch einen Heiligen hervorgerufen. Auf der Rückfahrt ist Norton entschlossen, sein künftiges Leben in Naxos mit Akrivia zu verbringen. Er geht zu ihr und fragt, ob sie ihn liebe. Sie sagt: Gewiß; aber als er seine Anfrage klärt und sie fragt, ob sie ihn heiraten wolle, antwortet sie: Nein, und bricht in Tränen aus und geht sofort in die Kabine. Norton richtet nun die gleiche Bitte an den Paten und den Vater; der antwortet, daß er sich zwar geehrt fühle, daß aber seine Tochter, obwohl ohne Mitgift, nur einen Adeligen desselben Rangs heiraten könne. Als Norton seine vornehme englische Abkunft nachweist, geben die beiden Herren ihr Einverständnis und
reden mit Akrivia. Norton findet sie weinend. Lieben Sie mich denn nicht? Nein, sagt sie, das ist es nicht, aber daß Sie kein Hellene sind. Nach der Heirat ist sie stolz, Engländerin zu sein; bei einem Aufenthalt in England fühlt sie sich unbehaglich; nun lebt sie in Naxos, überzeugt, den vortrefflichsten Mann zu besitzen.
Diese naxische Akrivia macht uns die antike Frau und wohl nicht nur diese prächtig verständlich, wo die natürlichen Lebensgrundlagen unverrückt dieselben geblieben sind. In der Familie ist ihr Kreis beschlossen. Vom Vater einem rechtschaffenen Gatten, der ihre Sphäre nicht verläßt, in Ehe gegeben, findet sie, ein Sinnenmensch ohne Sinnlichkeit, ihre Bestimmung und damit ihr Glück. Da gibt es nicht jenen die organischen Verhältnisse verwirrenden, nun Jahrhunderte alten Minnegesang; Athen kennt nicht den Salon, die Dame, nicht das unbefriedigte Mädchen, nicht die lustige Witwe. Die Lebensgestaltung war auch hierin unendlich wesensrichtiger. Das attische Mädchen wird, wie man etwa sagt, geheiratet zum Zweck der Erzeugung echtbürtiger Kinder, die attische Frau erfüllt ihre Aufgabe als Walterin über das Hauswesen und die Kinderpflege —aber die attische Kunst, die Vasen, die Grabreliefs, beweisen eindrücklicher als jede literarische Aeußerung, daß sie an menschlicher Ehre und Würde, wenn sie so ihr Leben erfüllt, nicht hinter dem Manne zurücksteht. Und in die großen Frauengestalten der attischen Tragödie, deren Taten und Schicksale aus der älteren Zeit der epischen Dichtung und der heroischen Gesellschaft stammen, haben die Dichter in wundervoller
Mischung doch auch die Seele der attischen Frau und ihre Möglichkeiten einströmen lassen.
Es gehört wieder zu den Gedanken, mit denen Plato sich zu seiner attischen Umwelt in Gegensatz setzt und womit er auch keinen Erfolg hatte, wenn er aus der Frau des Idealstaats einen schwächeren Mann macht, um sie gleichzustellen. Dies schrieb er zudem als der Unverheiratete, der er war; obwohl er nach Maßnahmen gegen die Ehelosigkeit ruft, hat er für sein persönliches Leben die ionisch-attische Freiheit des individuellen Entscheids beansprucht und sich keinem moralischen Zwang zur Ehe wie ein Spartaner unterzogen. Wenn in Athen der freiwillige Verzicht auf Nachkommenschaft üblich geworden ist, so hängt das damit zusammen, daß im freiheitlichen Staat die Familie ihre religiösen Grundlagen so ziemlich verloren hatte; man braucht keinen Ahnenkult, der Glaube an das Fortleben nach dem Tod ist eben nicht stark.
Durch Eintragung in die Liste des Demos wird der junge Athener in der Zeit der Demokratie Vollbürger; damit entgeht er sinngemäß der väterlichen Gewalt. Den Römern war bewußt, wie ihre harte, erst durch den Tod gelöste patria potestas sie von den Griechen abhebt. Athen hat seit Solons Zeiten eine unendlich gesündere und natürlichere Lösung für die Beziehung der erwachsenen Söhne zu den Eltern gefunden. Der Archon nimmt eine öffentliche Klage, wie sie von jedem Bürger erhoben werden kann, entgegen, wenn die Söhne den sich nicht mehr selber erhalten könnenden Eltern den Lebensunterhalt nicht gewähren, sie nicht bestatten oder ihnen nicht die
Totenriten erweisen, und die Folge ist für den Verurteilten, daß er der bürgerlichen Ehre verlustig geht. Aber nur dann kann der Sohn dazu verpflichtet werden, wenn der Vater seinerseits nichts unterlassen hat, was den Sohn zum bürgerlicher Ehrung werten Manne macht, und nur dann muß er ihn unterhalten, wenn der Vater den Sohn hat eine nährende Kunst lernen lassen. So werden gleichzeitig auch die Eltern, ohne Zwang, auf den Weg gewiesen, ihre Kinder richtig aufzuziehen. Das war einmal attisches Gesetz, praktisch und weise zugleich, es stammte eben von Solon.
Einst in der Zeit des Hochliberalismus konnte Jacob Burckhardt jenes Bild eines Athens entwerfen, in dem der Einzelne dem Staat verknechtet erscheint. Wie anders urteilen wir in der Zeit immer größerer Staatsallmacht, und wie anders haben die attischen Beurteiler selbst, der Perikles der thukydideischen Leichenrede, Plato in der so wundervoll Schmerz und Humor mischenden Darstellung des demokratischen Menschen und Staates in der Politeia ihr Athen gesehen! Allerdings, der Bürger ist, wie die häufige Formel lautet, verpflichtet, dem Staat mit Leib und Gut zu dienen; er ist ja nur im Staat und durch den Staat. Aber privatim gilt ja das Ideal des Leben «wie einer will». Der Sokrates im platonischen Kriton nimmt das ungerechte Todesurteil auf sich, weil er den Gesetzen folgt, die er freiwillig so lange anerkannt hat.
Gewiß, vollkommener ist der Tod fürs Vaterland nie gepriesen worden als im öffentlichen Grabgedicht auf die Gefallenen vor Poteidaia von 432: dafür, daß
sie ihr Leben in die Waagschale warfen, haben sie menschliche Vollwertigkeit, Areté, eingetauscht. Gewiß, gerade die attische Demokratie hat für die um ihretwillen Gestorbenen jene Ehrungen gefunden, die bis auf uns beispielhaft geworden sind: das öffentliche Begräbnis, das öffentliche Denkmal, die Aufzählung der einzelnen Gefallenen, das Grabgedicht und jene Leichenrede durch den gewählten Sprecher, die für die Entwicklung der Kunstrede entscheidend wurde; trotz alledem ist für den attischen Bürger der Krieg die Mühsal schlechthin, und militärische Dienstübungen außer der Kriegszeit lehnt er ab, wieder im Gegensatz zum Spartaner. Man muß sich vor Augen halten, daß die Perser bei Marathon von einer Truppe geworfen worden sind, die die Waffe erst für diesen Kampf angelegt hatte. Der Krieg selber lehrte den Krieg, freilich war Krieg der übliche Zustand. Als während des peloponnesischen Krieges dauernd zum Sammelplatz gezogen werden mußte, klagte der Athener bei Aristophanes:
Zeit genug, lange Zeit hat man uns hier abgetrieben, aufgerieben, immer hin, immer her, zum Lykeion, vom Lykeion mit Gepäck und Schild und Speer.
Als man seit dem peloponnesischen Krieg und nachher mit Söldnern die Feldzüge zu führen begann und in Verbindung damit eine eigentliche Kriegskunst aufkam, verlernte das attische Volk seine ursprüngliche Wehrhaftigkeit; erst die reaktionäre Demokratie nach der Niederlage bei Chaironeia hat eine Art Dienstpflicht im Frieden mit Rekrutenschule
eingeführt. Ein Volksheer im wahrsten Sinne ist das athenische geblieben. Die Volksversammlung, die alte Heeresgemeinde, wählt ihre Obersten; mit den Offizieren verkehrt der einzelne Hoplit ganz wie mit seinesgleichen, macht auch die ihm gut scheinenden Vorschläge, so daß noch im späten vierten Jahrhundert ein berühmter Feldherr einmal ausgerufen hat: Obersten sehe ich viele, aber nur wenig Soldaten!
Und was nun das Dienen mit dem Gut anbelangt, so hat es eine alljährlich für die Staatsbedürfnisse erhobene Steuer nicht gegeben. Das empfand der freie Sinn der Athener als Zeichen der Tyrannis, eine solche Steuer hatten die Peisistratiden erhoben. Belastungen, wie sie unsere Zeit — vom Krieg abgesehen — ohne Bedenken auferlegt, wären ihnen unerträgliche Fron gewesen. Nur in Kriegszeit und für die Rettung des Staates kann ein Volksbeschluß, eine besondere direkte Steuer anordnen. Im vierten Jahrhundert ist diese sogar, wie unsere berühmte Basler Steuer, progressiv gestaltet. Dazu traten freiwillige Steuern, die den Zahlenden Anerkennung einbrachten. Erst recht gilt dies für jenes eigenartige, aus der aristokratischen Zeit übernommene, aber ordnungsgemäß durch die kleisthenische Demokratie organisierte Institut der Leiturgie, der den Vermöglichen aufliegenden Realleistung für die Gemeinde: indem man ein Kriegsschiff ausrüstet und auf dem Feldzug kommandiert, indem man den Festreigen für ein Fest stellt oder eine Riege von Fackelläufern, indem man seine Stammesgenossen bewirtet. In jedem Fall ist es Würde und Stellung, und man kann Ehre erwerben: die Leistung erscheint als eine persönliche; man weiß,
was und von wem etwas getan ist. Da mag die Kostenaufwendung schon über das Maß von direkten Geldsteuern hinausgehen, die Pflichterfüllung ist sinnvoll und natürlich. Mögen nun auch in den Texten .die Reichen mit weniger und mehr Recht über die Schwere ihrer Leiturgien jammern; solange sich das Volk als Einheit fühlen konnte und Leute vorhanden waren, die sie zu leisten vermochten, im großen Jahrhundert der Demokratie, war es wirklich nicht so, wie Burckhardt klagt, daß Choregien nur zum Vergnügen der anderen übernommen wurden und der Zwang den Festen die Weihe nahm.
Ehrenvoller Dienst für die Stadt war ursprünglich auch die Uebernahme eines Amtes. So gut wie der militärische Dienst der Waffen-Besitzenden geschah das zunächst ohne Besoldung, in der Demokratie ein aristokratisches Moment. Als die Gründung des delisch-attischen Seebundes es notwendig machte, die Unvermöglichen zum Dienst auf der Flotte dauernd beizuziehen, als nach der Umwandlung des Bundes in eine Herrschaft das Volksgericht beständig tagen mußte, als die Berechtigung zur Aemterbekleidung in logischer Entwicklung ausgedehnt wurde, kamen die Soldzahlungen auf; damit er seine Stellung und seinen Staatsdienst erfüllen könne, durfte schließlich jedermann sich vom Staat bezahlen lassen. Immerhin blieb ein Odium darauf, daß damit die Demokratie an ihrer Grenze angelangt sei. Einst war, um die Geschäfte der Allgemeinheit zu treiben, Bedingung gewesen, daß man dazu Muße habe: jetzt soll der Staat einem diese Muße verschaffen. Der Vermögliche, dem es auf die paar Obolen nicht ankommt, wird sich nicht mehr
zum Amt melden. Es konnte auch hier nicht anders sein als in aller Erdenwirklichkeit, daß, was vom einen Standpunkt aus richtig eingeführt war, sich nach anderer Seite ungünstig erwies.
Uebrigens haben ja die Aemter gerade infolge der breiten Zugänglichkeit kein Gewicht gehabt außer den gewählten militärischen und später auch den finanziellen Aemtern, deren Inhabern auf dem Weg über ihre speziellen Funktionen Einfluß auf die äußere oder die innere Politik zufiel. Denn seine Souveränität übt das attische Volk faktisch aus, es versammelt sich das ganze Jahr über zur Landsgemeinde, und seine Führung muß der Volksleiter, der Demagoge, jedesmal neu durchsetzen. Er kann das nur durch die Ueberzeugung mit der Rede, darum fällt in Athen Redegewalt und Staatsmannschaft zusammen, bei Perikles wie bei Demosthenes. Der Logos gilt in diesem klugen Volk wie nirgendwo, und es folgt dem Logos wie kein anderes und läßt sich durch ihn führen und verführen; Parteiparolen, vorgefaßte Meinungen, undurchsichtige Abhängigkeiten haben da wenig Raum. Der Idee nach ist der Souverän gebunden an die Gesetze, die seit Solon ständig vermehrt, seit der Restauration in einer großartigen Zusammenfassung wie ein Codex Juris ausgestellt waren — neue Reste der Inschriften sind in den Markt-Ausgrabungen zutage getreten —, und die Demokratie definiert sich auch als die Herrschaft der Gesetze im Gegensatz zur Herrschaft einzelner Menschen in den andern Staatsformen. Sie ist es gewiß viel öfter tatsächlich gewesen als nicht.
Wir können uns die moderne Gesellschaft nicht
denken ohne den Schulzwang. Athen kannte ihn nicht und hatte doch jene allgemeine Volksbildung, ohne die die unwiederholbare Entstehung und Blüte der großen dramatischen Kunst unmöglich gewesen wäre. Die Schule der Athener besteht in ihrer den Charakter zur Mischung des Harten mit dem Milden erziehenden Ausgeglichenheit der Gymnastik für den Körper und der Musiké, der Musik und Dichtkunst, für den Geist nur durch freie, natürliche Wahl und Hinwendung. Wir dürfen das Analphabetentum, obschon es nicht gänzlich fehlte, sehr gering anschlagen; die Art des Rechtsverfahrens, die Bedeutung schriftlicher Publikation beweist das. Das geistige und künstlerische Virtuosentum der Sophistenzeit hat dann leider eine Zerspaltung in besondere Bildungsschichten geschaffen. Aber die wesentliche attische Kunst blieb allen zugänglich. Die Athener haben ihrem Sophokles das Feldherrenamt, das wichtigste Schatzmeisteramt und dem greisen Manne noch in der beginnenden Revolutionszeit die Vorbereitung der wichtigsten Staatsgeschäfte anvertraut. Bei der Konstituierung der panhellenischen Kolonie des Perikles in Italien wurden auch der Philosoph Protagoras und der Geschichtsschreiber Herodot beigezogen.
Als das natürliche Zutrauen zu den geistigen Menschen ins Wanken gerät in der Zeit der Zerspaltung, da finden wir zugleich gesteigerte Superstitiosität. Waren einst die Spartaner aus religiöser Peinlichkeit zu spät nach Marathon zum Schlagen gekommen, so erfolgt nun die Niederlage der Athener in Sizilien schließlich, weil Nikias von Aberglauben sich beeinflussen
ließ, und die Demokratie meint sich zu retten, wenn sie die verurteilt, die Athens Götter nicht verehren. Die berühmten Asebieprozesse fallen in die Generation der geistigen und der politischen Krise des hellenischen Kriegs und der Revolutionen. Eine dogmatische Festlegung auf einen Glauben bedeutete auch das nicht, Athen hat kein systematisches Credo gehabt: Götter sind überall da, wo sie sich offenbaren, und so, wie sie sich offenbaren. So konnte Athen auch unbefangen neue Kulte und fremde Götter anerkennen und aufnehmen und seine eigenen nach der Art ihrer Offenbarung in anderer Weise anerkennen. Athena ist mit dem Wachsen Athens an politischer und geistiger Macht mächtiger und geistiger geworden. Die Athener haben sich immer gerühmt, ein besonders gottesfürchtiges Volk zu sein; ihr Verhältnis zur Göttin, nach der die Stadt und das Volk heißt, von der Solon schon sagt: sie halte die Hände über der Stadt, so daß sie nicht untergehen könne, war ein besonders enges. Die Athena aber, der der Parthenon gebaut wurde, ist als geistige Potenz empfunden; so hat ihr Phidias das Bild geschaffen aus der Reflexion über ihr Wesen heraus, über das er im Kreis des Perikles mit seinem Freund, dem aufgeklärten Staatsmann, wohl diskutiert haben mag, und zugleich in Giebeln und Fries Urzeit und Jetztzeit des Beieinanderseins von Göttin und Volk dargestellt. Das bezeichnendste Fest der Athener sind die Panathenäen, die nichts anderes geworden waren als ein Dank und ein Sichempfehlen des Volks an seine Göttin.
Das alte natürliche Zutrauen des Volkes zu seinen
Göttern hat erst nach dem Sieg der Makedonen der priesterliche Staatsmann Lykurg gleichsam wieder erzwingen wollen. Hier erst tritt uns eine Verbindung von Politik und Priestertum entgegen, während sonst der Priester nur für den hergebrachten richtigen Kult zu sorgen hat. Im Staat, der als solcher ganz im Schutz seiner Götter besteht, hat das Priestertum keine besondere Macht. Die dem athenischen Einheitsstaat erst zugekommene eleusinische Mysterienreligion übt panhellenische Propaganda, und die Einweihung ist bezeichnenderweise nicht für die Athener obligatorisch; sowenig wie der Eleusinier Aischylos mögen viele der bedeutenderen Athener just nicht an den Mysterien teilgenommen haben. — Natürlich und schlicht sind auch die Gedanken, die die Athener sich über den Tod gemacht haben. Mancher mochte so denken, wie es der offizielle Dichter des Epigramms auf die bei Poteidaia Gefallenen ausdrückte, daß der Aether die Seelen, die Erde die Leiber der Toten aufnimmt. Die angsterfüllten alten Vorstellungen waren klarem Anschauen und Denken gewichen, das fernere Schicksal der Seele, von dem man nichts weiß, wird nicht weiter verfolgt. Gewöhnlich wird der Tod als wirkliches Ende des Lebens hingenommen, wenn auch daneben der homerische Hades, der Glaube, daß ausgezeichnete Menschen als Heroen weiterwirken, und Urtümliches dauernd weiter existiert. Zwar ist auch der Glaube an individuelle Schicksale der Seele nach dem Tod öffentlich in den eleusinischen Mysterien und in privaten Kreisen durch orphische Lehren auf attischem Boden verbreitet worden, aber eigentlich volkstümlich war das
nicht, wie gerade das Bemühen der Philosophen beweist. Der letzte Lehrer Athens argumentiert in diesem Falle dem allgemeinen Empfinden gemäßer, wenn er sagt: Der Tod geht uns nichts an; was aufgelöst ist, kennt keine Empfindung, weder Lust noch Schmerz; was aber ohne Empfindung ist, geht uns nichts an.
Nur kurz können wir erwähnen, daß die Zweiheit des Trauerspiels und des Lustspiels, die uns wie eine Naturform vorkommt, attisch ist. Ebenso die für antike Einstellung naturgegeben scheinende Dreiheit der Redekunst, der beratenden politischen, der Prozeßrede und der darstellenden. Mit einem Wort nur sei auch gesagt, daß die athenische Form der Geselligkeit nicht die sinnlose Unform der modernen hatte.
Dürfen wir die Einstellung der Athener zur Arbeit nicht auch als die naturgemäße ansehen? Die Voraussetzung zur Beschäftigung mit den allgemeinen Dingen ist, wie gesagt, daß der Bürger Muße dazu, Scholé, hat. Man soll also nicht ein Körper und Geist in ihrer freien Bildung hinderndes banausisches Gewerbe verrichten müssen. Auf dem Markt sitzen, Handel treiben, Arbeit um Lohn tun ist verachtet, denn es macht den, der sich bezahlen läßt, zum Dienenden. Für anständig gilt die Landwirtschaft, weil sie eine natürliche und primäre Erwerbsweise ist. Die Scholé ist ein Ideal, auch wie so manches in der bürgerlichen Ethik der Athener von den alten Aristokraten übernommen, und kann, wenn man ans Leben hohe Ansprüche stellt, nur erfüllt werden, wenn andere für einen arbeiten. Aber die Athener waren eben unglaublich
anspruchslos und ungekünstelt in ihren Bedürfnissen; sie besaßen jene Frugalität, von der Montesquieu sagt, daß sie zur Demokratie gehört, mehr als die anderen Griechen und gar als die Italiker. Das attische Essen war von sprichwörtlicher Einfachheit, ein Komiker spricht einmal vom berühmten Athen, «wo die Kekropidensöhne leichthin immer Hunger leiden, nach Luft schnappen und sich von Illusionen nähren». Fleischgenuß — jede Schlachtung ist eigentlich ein Opfer — ist eine Rarität; statt gebackenen Brotes wird meist nur Teig gegessen; Schlaraffenmahlzeiten, von denen so oft in der Komödie die Rede ist, gibt es üblicherweise nur in der Komödie. Mit ein paar Batzen im Tag kam der einfache Mann aus, wenn er nicht viele Kinder hatte. Man kann also nicht sagen, daß das Scholé-Ideal allein durch die attische Herrschaft verwirklicht werden konnte, es war auch ohne sie da. Allerdings hielt man so sehr darauf, daß Sokrates gesagt haben soll, die Untätigkeit sei die Schwester der Freiheit, und daß in den Reden des vierten Jahrhunderts man sich vor Gericht entschuldigen zu müssen glaubt, wenn man seinen Unterhalt täglich neu erwirbt: da sei Mitleid am Platze, nicht Verachtung; man lebe eben nicht, wie man wolle. Dieses Arbeiten steht also auch im Widerspruch zum demokratischen Ideal des Lebens «wie man will». Als die Staatsleitung nach Perikles von den Vornehmen auf Besitzer von Manufakturen überging, wurde dies als Schande für die Stadt angesehen. Nicht nur für Amtsausübung, sondern für die Betätigung der Souveränität in der Volksversammlung hat schließlich in der ausgebildeten Demokratie
der Bürger Bezahlung beansprucht, um an diesem Tag nicht arbeiten zu müssen, und als die extremste Form der Demokratie, die des Kleophon, wenige Jahre herrschte, konnte er sogar ohne irgendeine Leistung seinen täglichen Sold vom Staat bekommen, war also Staatsrentner geworden. Wir können uns darüber nicht mehr wie die antiken Gegner und die früheren modernen Historiker aufregen. Denn jene Zeit war eine Notzeit und eine Zeit der Arbeitslosigkeit. Mehr schon darüber, daß die Einnahmen des Staats großenteils von den Untertanen gekommen waren; denn als Staat im Herrschaftsgebiet fühlte Athen nicht mehr demokratisch, zu seinem Unheil.
Natürlich ist auch in den besten Zeiten der Wunschzustand, daß jeder Bürger Muße hat, nie vorgekommen. In der Volksversammlung überwogen die kleinen Leute, die trotz den Diäten um ihr Brot arbeiteten. Dazu haben wir auch Aeußerungen der Schriftsteller, des Thukydides und der Redner, die gerade den athenischen Brauch dem anderer Städte entgegensetzen: in Athen sei es keine Schande, seine Armut einzugestehen, vielmehr ihr nicht durch Tätigkeit zu entgehen zu versuchen; der Gesetzgeber verbiete hier niemandem den Zutritt zur Rednerbühne, der, um der Notdurft zu wehren, ein Gewerbe treibe; niemandem dürfe man seine Tätigkeit auf dem Markte vorwerfen. Es liegt also ein Widerspruch vor, der Widerspruch zwischen Wunschbild und Wirklichkeit; das Handwerk war zwar verachtet, aber der Handwerker nicht. Wir brauchen ja nur uns in Erinnerung zu rufen, wie herrliche Gegenstände des athenischen Gewerbefleißes uns erhalten sind,
um zu wissen, daß die Athener das Handwerk verstanden und daß sie wie die Griechen überhaupt fleißige Leute gewesen sind.
Ohne Schutzmaßnahmen des Staats, weder gegen die auswärtige Konkurrenz noch gegen übermäßige Inanspruchnahme der Arbeitskraft, aber auch ohne den Segen und den Fluch der Maschine, in angeborenem Eifer und mit dem Ehrgeiz, es so gut und schön wie möglich zu machen, haben sie die Wunder ihres Kunsthandwerks gefertigt, in freier Konkurrenz, wie die Bauinschriften lehren, der Bürger und der Metöken, und der Freien mit den Sklaven, ohne daß zuzeiten sogar die Bezahlung differiert zu haben scheint. Sie wußten nichts vom sittlichen Wert der Arbeit, der das Bittere versüßen soll, sie dachten über sie nicht anders als die Bibel; denn auch sie gehörten zu dem aus dem Paradies vertriebenen Geschlecht.
Die edelste Blüte, die der Gesinnung der Athener erwächst, ist die attische Philanthropie. Wenn die letzte Generation der Philosophen des vierten Jahrhunderts die natürliche Verwandtschaft feststellt, die den Menschen vom engsten Kreis der Nächstverwandten ausgehend in immer weiteren Kreisen mit allen seinesgleichen verbindet, und auf Grund dieser Erkenntnis die Forderung aufstellt, dementsprechend gegen sie sich zu verhalten, zu handeln, so entstammt auch diese Lehre dem unmittelbaren Gefühl. Man wird nicht vergessen und verschweigen, daß die Athener sich scheußliche Grausamkeiten haben zuschulden kommen lassen, sich hinreißen ließen, um sie verdiente Männer mit dem Tode zu strafen,
daß sie das angebliche Recht des Siegers ausgeübt haben bis zur Ausrottung der Besiegten; aber auch wenn sie sophistische Begründung dafür suchten, dann folgten sie eben nicht dem Charakter, den zu haben sie vorgaben: Alljährlich seit der Perserzeit gehört es zum Thema des Lobredners auf die Gefallenen des Jahres, daß Athen gefeiert wird als die Stadt, die den andern die Segnungen der Kultur geschenkt hat, die seit mythischer Urzeit den Bedrängten und Schutzflehenden Mitleid entgegentrug und Schirm bot. Die Gestalt des Titanen Prometheus, der trotz Götterneid und -mißgunst den Menschen ein von tierischer Not befreites Leben schuf, ist so eine Erfindung des Atheners Aischylos. Welcher Staat kann einen Staatsmann, der zugleich Feldherr war, aufweisen, der wie der größte der demokratischen Zeit Athens von sich sagen zu können behauptete, daß seinetwegen kein Mitbürger Trauerkleider angezogen habe?
Wenn nach Solons Tilgung der Bodenhypotheken und nach der Fürsorge für die Kleinbauern durch Peisistratos die demokratische Zeit nicht mehr unter der Drohung steht, daß ein allgemeiner Schuldenerlaß und eine Wiederaufteilung des Grundes wie zur Zeit der Landnahme die Gesellschaft erschüttert, und wenn der Archon vor dem jährlichen Amtsantritt schwören kann, allen Besitz bis zum Ende seines Amtsjahres zu garantieren, so ist das auch deshalb ermöglicht, weil die Athener der demokratischen Zeit, soweit das für jene Epoche gesagt werden kann, sozial gesinnt waren. Hier wären zu erwähnen die Unterstützungen an die Kriegsverstümmelten, die täglichen Pensionen an arme Erwerbsunfähige, die Sorge für
die Nachkommen einzelner großer Männer, wie des Aristeides, die Erziehung der Kriegswaisen und ihre Ausstattung, mit Waffen durch den Staat; auch die seinerzeit zur Erhaltung der Familien dem Archon zugefallene Aufgabe, Erbtöchter und Waisen vor Schädigung zu bewahren, wirkte sich in sozialem Sinne aus. Wir kennen die Anstellung von Aerzten, die ohne Bezahlung ihre Kunst ausüben. Der Staat sorgt wie für die Getreidezufuhr, so für die Niedrighaltung des Brotpreises; schon früh kommt es zu Gratisverteilungen, öffentlich und als Leiturgie werden Opferschmäuse veranstaltet. Perikles hat, um Arbeit und Verdienst zu geben, seine großen Bauten unternommen. Diäten in Gericht und Volksversammlung dienen dazu, den Minderbemittelten das Existenzminimum zu verschaffen. Verzerrt durch die Ueberlieferung, deswegen, weil Demosthenes dagegen sein mußte, als er sah, daß es sich damals um die Frage des Seins oder Nichtseins der Volksherrschaft überhaupt handelte, ist das Institut der Schaugelder, der Theorika. Perikles hatte sie geschaffen, damit jeder, auch der ärmste Bürger, am Geistigen teilnehmen könne, am Schauen und Zuhören bei den musischen und dramatischen Vorführungen, an denen die Dichter, als die Lehrer der Erwachsenen, die sie sein wollten, zum ganzen Volk sprachen. Freilich waren die Schaugelder im vierten Jahrhundert auch auf Feste ausgedehnt worden, wo es keine Aufführungen gab; aber die Erholung, die die Teilnahme an dem Götterfeste dem Geiste verschafft, rühmt auch der thukydideische Perikles als Auszeichnung der Demokratie. Gewiß, die Theorika waren nach dem bissigen Wort des gescheiten
Demades der Kitt der Demokratie; aber auch im guten Sinn.
Alle diese Erleichterungen und Verschönerungen der Schwere des Lebens, gegenüber denen das «panem et circenses» einer Autokratie nur eine Karikatur ist, kamen aus der menschenfreundlichen Natur des attischen Volkes; denn das ist nicht beschränkt auf die öffentlichen Maßnahmen. Bei Teuerung steuern Private zusammen, um Getreide anzukaufen, und bekommen dafür, denn auch dies gehört zum Humanen, den Dank inschriftlicher dauernder Erwähnung. Ueblich sind Stiftungen und private Vereinigungen zur Unterstützung von in Not geratenen Bekannten.
Als die alte Freiheit dahin war und damit der Staat seine zentrale Bedeutung verloren hatte, waren die Athener keine anderen gewordene. Auch dieser Zwang überlieferter Bindung war gefallen, aber die Bahn war offen für eine naturgemäße Menschenfreundlichkeit rein um des Menschlichen willen. Was sich lange vorbereitet hat, kommt in den Worten des letzten großen Atheners, Epikurs, zum Ausdruck. Als einzigen höchsten Wert des Gemeinschaftslebens stellt er die Freundschaft hin, oder wie man das griechische Wort wiedergeben kann, das Gefühl des Zusammengehörens. Solon hatte den guten Staat auf die wohlverstandenen natürlichen Bedürfnisse gegründet. Epikur mit der Freimütigkeit, die ihn kennzeichnet, führt Staat und Recht auf natürliche egoistische Wurzeln zurück, aber der Seelenbeschwichtiger, der weitherum in seinen früheren Wirkungsstätten und dann in der attischen Heimat Freunde gewonnen hat,
vergöttlicht sie, die nicht mehr auf die Polis beschränkte, mit dem wie von einer Gottheit redenden Wort, er, der Mißachter überkommener Religiosität: Die Freundschaft tanzt den Reigen um die Welt und ruft uns allen zu, uns zu erheben zu ihrer Seligpreisung.