VOLKSCHARAKTER UND FINANZGEBARUNG
JAHRESBERICHT 1943/44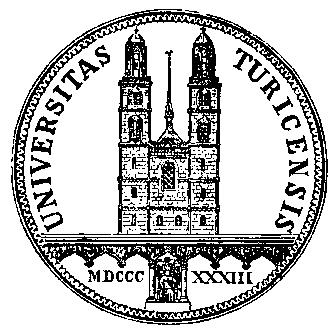
Druck: Art. Institut Orell Füssli A.-G., ZürichINHALTSVERZEICHNIS Seite
I. Rektoratsrede 3
II. Ständige Ehrengäste der Universität 23
III. Jahresbericht 24
a) Erziehungsdirektion 24
b) Dozentenschaft 24
c) Organisation und Unterricht 27
d) Feierlichkeiten und Konferenzen 32
e) Ehrendoktoren 32
f) Studierende 33
g) Prüfungen 35
h) Preisaufgaben 36
i) Stiftungen, Fonds, Stipendien und Darlehen. . . 37
k) Kranken- und Unfallkasse der Universität . . . . 39
l) Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren der Universität 39
m) Zürcher Hochschulverein 41
n) Stiftung für wissenschaftliche Forschung 45
o) Jubiläumsspende für die Universität 49
p) Julius Klaus-Stiftung 51
IV. Schenkungen 57
V. Nekrologe 60
I. FESTREDE DES REKTORS PROF. Dr. EUGEN GROSSMANN
gehalten an der 111. Stiftungsfeier der Universität Zürich
Volkscharakter und Finanzgebarung |
I.
Die Regeln der Kunst, die Finanzen des Gemeinwesens zu verwalten, haben sich erst im Laufe der drei letzten Jahrhunderte herausgebildet. Den Gemeinden gegenüber sind sie, mitunter mit grosser Ausführlichkeit, in der staatlichen Gesetzgebung festgelegt, aber auch die Staaten selber halten sich freiwillig an sie oder sie übernehmen, wenn ihre Finanzen zerrüttet sind, in Verträgen mit Gläubigern die Verpflichtung dazu.
Ihrem Inhalte nach beziehen sich diese Regeln auf die Art der Aufbringung der Mittel für die verschiedenen Kategorien von Ausgaben, auf die Wahl zwischen Steuern, Gebühren, Erwerbseinkünften und Anleihen, auf die Gestaltung dieser Einnahmen im einzelnen und auf das Verfahren, das bei der Abwicklung aller dieser Geschäfte einzuschlagen ist, auf die Aufstellung des Budgets, auf die Kontrolle seiner Ausführung und schliesslich auf die Prüfung der Rechnung am Ende der Finanzperiode.
Geht man der Entstehungsgeschichte dieser Regeln nach, so macht man die Wahrnehmung, dass bei ihrer Aufstellung nur eine verhältnismässig kleine Zahl von Staaten mitgewirkt hat. Das finanzpolitische Gedankengut, über das unsere Zeit verfügt, ist in der Hauptsache in England, in Frankreich und in Deutschland entstanden. Die italienische Finanzgesetzgebung kann, trotz dem hohen Rang, den die Finanzwissenschaft in diesem Lande seit Jahrzehnten einnimmt, nicht auf besondere Originalität Anspruch machen — dafür hat die Fremdherrschaft dort zu
lange gedauert — und in der amerikanischen Finanzpolitik ist der englische Einfluss erst in der allerjüngsten Zeit, als im Zusammenhang mit dem New Deal Roosevelts neue und kühne Auffassungen zur Geltung kamen, etwas geschwunden.
II.
Die führende Rolle ist England durch einige hervorstechende Charaktereigenschaften seiner Bevölkerung zugefallen. Bestimmend waren im wesentlichen die Auffassung des Verhältnisses von Staat und Individuum, dann der bedächtige, phantasiereichen und enthusiastischen Plänen abgeneigte Empirismus und endlich die Gabe, unangenehmen Dingen mit Ruhe ins Auge zu sehen und sich mutig dem Unvermeidlichen zu unterziehen.
Von grundlegender Bedeutung ist die Anschauung vom Verhältnis von Staat und Individuum gewesen, die Anschauung, dass nicht das Individuum für den Staat, sondern der Staat für das Individuum da sei. Das sieht man, soweit die Finanzprobleme in Frage kommen, schon daran, dass es systematische Darstellungen, Lehrbücher der Finanzwissenschaft, wie sie in Deutschland, in Frankreich und in Italien seit mehr als einem Jahrhundert in grosser Zahl veröffentlicht worden sind, in England lange Zeit überhaupt nicht und auch heute noch nur in spärlichem Umfange gibt. Das kommt daher, dass den Engländer der Staat als solcher und die Staatsfinanzen als solche nur mässig interessieren. Was ihn beschäftigt, was aber auch in den nationalökonomischen Werken von jeher ausführlich behandelt wurde, das sind die Wirkungen der staatlichen Finanzgebarung, besonders die Wirkungen der Steuern auf das Vermögen und Einkommen der Individuen.
Aus einer solchen Einstellung heraus zeigt das englische Finanzrecht auf Schritt und Tritt das Bestreben, das Individuum zu schützen vor der Übermacht des Staates. Aus ihr heraus wurde der Krone das Recht bestritten, ohne die Zustimmung der Betroffenen Steuern zu erheben, aus ihr entstand der jahrhundertelange Kampf um das Budgetrecht des Parlaments, der erst in der
Bill of rights vom Jahre 1689 mit dem endgültigen Siege des Parlamentes endete. Die Ansicht, dass diejenigen, die die Steuern bezahlen, auch das massgebende Wort in der Finanzpolitik haben sollen, führte dann in der Folge zu einer immer weiteren Einengung der budgetrechtlichen Befugnisse des Oberhauses zugunsten derjenigen des Unterhauses, bis der Schatzkanzler Lloyd George um das Jahr 1910, als das Oberhaus seine Steuerpläne verwarf, in einer Verfassungskrise von gewaltigem Ausmass das Oberhaus zur finanzpolitischen Bedeutungslosigkeit herabdrückte. Er hat den Kampf nicht zuletzt mit dem Schlachtruf gewonnen, dass das steuerzahlende Volk in seinen finanzpolitischen Entschlüssen durch keine andere Macht behindert werden dürfe.
Das englische Budgetrecht weist noch weitere Züge auf, die dem Bestreben entsprungen sind, das Individuum vor dem Staate zu schützen. Es wäre z. B. auf die Vorschrift zu verweisen, welche es den Parlamentsmitgliedern untersagt, bei der Beratung der Ausgaben über die Anträge der Regierung hinauszugehen. Letzten Endes wurzelt auch diese, zunächst nur gegen den Wettlauf der Parteien um die Gunst der Wähler gerichtete Vorschrift in dem Bestreben, den Steuerzahler vor übermässiger Belastung, das Individuum in seinem Vermögen und Einkommen zu schützen.
Das Budgetrecht ist aber nicht der einzige Gegenstand, an dem sich der Widerstand des Bürgers gegen die Übermacht des Staates geschult und gestählt hat. Auch die Einzelheiten der Steuergesetzgebung sind von ihm stark beeinflusst worden. So hat das englische Volk — im Gegensatz zum Kontinent — bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts die inneren Verbrauchssteuern als eine Einrichtung, die zu lästigen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit des Geschäftslebens führe, abgelehnt, und auch späterhin wurde das Schwergewicht auf einige wenige Objekte, namentlich den Tabak und die geistigen Getränke gelegt und so die Multiplizität der Steuern, wie sie namentlich Frankreich und Italien kennen, vermieden. Auch die finanziell zwar ergiebige, aber den Geschäftsverkehr störende
Umsatzsteuer hat England, im Gegensatz zu den andern Grossmächten, erst im zweiten Weltkriege, im Jahre 1940, eingeführt.
Vor allem aber zeigt sich das Bestreben, das Eindringen des Staates in die private Rechtssphäre zu vermeiden, in der Gestaltung der Einkommenssteuer. Die Meinung ist verbreitet, dass das eigentlich Wesentliche an der englischen Einkommenssteuer die Erfassung gewisser Einkünfte, vor allem der Zinsen und Dividenden und der Löhne bei der auszahlenden Stelle, bei der den Coupon einlösenden Bank, bei dem den Hypothekarzins zahlenden Grundeigentümer, bei dem den Lohn entrichtenden Arbeitgeber sei und dass der Zweck dieser Einrichtung vor allem in der Erschwerung der Steuerhinterziehung bestehe. Indessen darf nicht übersehen werden, dass diese Zwischenschaltung der Banken, der Grundbesitzer, der Arbeitgeber auch der Ausfluss einer allgemeineren Tendenz ist, der Tendenz nämlich, eine persönliche Begegnung des Fiskus mit dem Steuerzahler tunlichst zu vermeiden. Das zeigt sich deutlich daran, dass auch dort, wo das Quellenprinzip nicht angewendet werden kann, eine Person eingeschaltet wird, die gewissermassen die Rolle des Puffers übernimmt. Bei der Einschätzung der Kaufleute und Gewerbetreibenden zur Einkommenssteuer erscheint der vereidigte Bücherexperte, der chartered accountant, auf der Szene und nimmt, sozusagen als gemeinsamer Vertrauensmann des Steuerpflichtigen wie des Fiskus, die Ermittlung des Reingewinnes vor, und bei der Veranlagung zur Erbschaftssteuer spielt der amtliche Testamentsvollstrecker eine ähnliche Rolle.
Die meisterhafte Gestaltung der englischen Einkommenssteuer, die nach vielen Jahrzehnten der Verkennung oder sogar der leicht verächtlichen Ablehnung nun auch auf dem Kontinent mehr und mehr zum Vorbild genommen wird, ist aber nicht nur das Ergebnis des Wunsches gewesen, direkte Zusammenstösse zwischen dem Fiskus und dem Steuerzahler tunlichst zu vermeiden. Sie ist vielmehr zugleich auch das Ergebnis einer anderen grundlegenden Charaktereigenschaft der Engländer: ihres Sinnes für vorsichtiges, schrittweises, empirisches Vorgehen. Selbst der im Alter von 23 Jahren an die Spitze der
Finanzverwaltung gestellte Schatzkanzler William Pitt ist bei aller Energie, die er bei der Hebung des durch die Koalitionskriege gegen Frankreich erschütterten Staatskredites entwickelt hat, auf steuerpolitischem Gebiet kein Draufgänger gewesen. Erst als das im Jahre 1797 eingeführte "Triple Assessment", ein eigentümliches System von Steuern, das aus äusseren Merkmalen die Leistungsfähigkeit ableiten wollte, enttäuschend niedrige Erträge geliefert hatte, entschloss er sich zur Einkommenssteuer, zunächst noch in der uns geläufigen Form, und erst als auch dieser Versuch nicht befriedigte, hat sein Nachfolger, der Schatzkanzler Addington, im Jahre 1803 die für die Income Tax charakteristische Form, eben die Aufspaltung in eine Reihe von Quellensteuern, gefunden. So blieb sie bis zum Ende des Krieges, und in dieser Gestalt hat sie Robert Peel wieder aufgenommen, als er 1842 einen Ersatz für den durch den Übergang zum Freihandel entstandenen Ausfall an Zolleinnahmen suchte. Peel scheint die kurz vorher geschaffene Basler Einkommenssteuer gekannt zu haben. Aber die bestechende Form dieser Abgabe, die Zusammenfassung aller Arten von Einkünften zu einer Grösse und ihre progressive Belastung verführte ihn nicht. Er griff auf die schon einmal bewährte Form zurück, er hielt sich an die "grosse Hauptsache", die möglichst vollständige Erfassung des Objektes, und auf dieser soliden Grundlage haben dann drei Generationen von englischen Finanzpolitikern weiter gebaut, Schritt für Schritt daran verbessert, die Degression des Satzes von einer bestimmten Einkommensstufe nach unten, die Mehrbelastung des fundierten Einkommens gegenüber dem Erwerbseinkommen, die Familienabzüge usw. eingeführt, bis schliesslich, wiederum unter der Führung von Lloyd George, über das ganze komplizierte System noch eine beim Empfänger erhobene allgemeine Einkommenssteuer von den ganz grossen Einkommen, die Surtax, gestülpt wurde, die den Gedanken der Progression noch stärker betonen sollte.
An der Entwicklung der Einkommenssteuer lässt sich der englische Empirismus vielleicht am besten beobachten. Wir begegnen ihm aber auf Schritt und Tritt auch auf anderen Gebieten
der Finanzpolitik. So galt es während vieler Jahrzehnte als ungeschriebene Regel, dass bei eintretendem Mehrbedarf an Steuereinnahmen zwei Drittel durch Verbrauchs- und Verkehrssteuern und ein Drittel durch Einkommens- und Erbschaftssteuern aufzubringen seien. Es leuchtet ein, wie sehr durch eine solche Regel die Verständigung über die Verteilung der Steuerlast erleichtert wird. Nicht minder glückliche Wirkungen hat der Empirismus auf dem Gebiete der Besoldungspolitik gehabt. Nicht einmal die Minister haben in England gleich hohe Besoldungen, sondern die Gehälter sind abgestuft, je nach der Bedeutung der einzelnen Ministerien, und erst recht gilt dieser Grundsatz für die Beamten. Da variieren die Gehälter fast wie in einem privaten Unternehmen, je nach den Leistungen und nach der Bedeutung des Amtes.
Die Neigung zum empirischen Erproben, zum "wait and see", könnte nun die Vermutung begründen, dass bei der Behandlung der schwierigsten Finanzprobleme, die es gibt, bei der Finanzierung von Kriegen, ein ausgesprochener Opportunismus herrsche. Gerade das Gegenteil aber ist der Fall. Wenn die Engländer auf einem Gebiete der Finanzpolitik einer starren Doktrin huldigen, dann bei der Beschaffung der Mittel für die Kriegführung. Die Lehren von Adam Smith und von Ricardo, die mit moralischen, politischen und ökonomischen Gründen die Deckung der Kriegskosten durch Steuern und nicht durch Anleihen verlangten, sind von den Schatzkanzlern, die in kriegerischen Zeiten der Finanzverwaltung vorstanden, angenommen und weitergebildet worden, so von William Pitt in den Koalitionskriegen gegen Frankreich, dann ganz besonders von Gladstone in seiner berühmten Rede über die Finanzierung des Krimkrieges (1854) und dann wieder von Lloyd George im ersten Weltkriege.
Was aber gab diesen Staatsmännern die Kraft, ihren Völkern die Vervierfachung, ja Verfünffachung der Steuerlast im Kriege zuzumuten? Daran war gewiss beteiligt der Umstand, dass die Opposition, die sich in solchen Lagen auf die ungleiche Verteilung der Lasten zu berufen pflegt, in England, infolge jener erwähnten Regeln über die Heranziehung von Verbrauchssteuern einerseits
und Besitzsteuern anderseits und infolge der fast restlosen Erfassung des Objektes bei der Einkommenssteuer, von vornherein einen schweren Stand hatte. Aber daneben machte sich bestimmt auch jene Eigenschaft geltend, die man als "fiscalische Courage" bezeichnen kann. Rein äusserlich zeigt sich das schon daran, dass man es in England immer abgelehnt hat, die Kriegskosten auf einem Sonderkonto zu verbuchen. Man stellt sie in das ordentliche Budget ein und erschrickt nicht vor den Riesensummen, welche die Ausgaben und das Defizit dann erreichen. In der erwähnten Rede Gladstones hat dieser Mut, der Wirklichkeit ins Auge zu schauen, wohl seinen vollendetsten Ausdruck gefunden, an jener Stelle besonders, wo er sagte, dass der Krieg immer ein Sprung ins Dunkle sei und dass darum seine Finanzierung so geordnet werden müsse, wie wenn nicht der Sieg, sondern die Niederlage gewiss wäre.
Auf seine grösste Probe ist dieser Mut übrigens nicht einmal im Kriege gestellt worden, sondern in jener langen Depressionsperiode nach 1920, wo Regierung und Parlament sich weder von den Seufzern der Steuerzahler, noch von den Klagen der Exportindustrie und ihrer Arbeitslosen, ja nicht einmal von dem gewaltigen Streik der Bergarbeiter — Schatzkanzler war in jenem kritischen Moment Winston Churchill — von der traditionellen Linie ihrer Währungs- und Finanzpolitik abdrängen liessen, wie ja denn auch die Abwertung des Pfundes schliesslich gar nicht durch einen Beschluss der Behörden dc jure, sondern dc facto, durch die Störungen in der Zahlungsbilanz herbeigeführt wurde, die infolge des Zusammenbruchs des Vertrauens in den internationalen Kreditbeziehungen sich ergeben hatten.
III.
Wenn wir nun zur Betrachtung des finanzpolitischen Geistes des französischen Volkes übergehen, so sehen wir mit Bezug auf den zuletzt erörterten Punkt, die "fiskalische Courage", allerdings einen grundlegenden Unterschied in den Charakteren der beiden führenden Völker Westeuropas. Die Bravour
der Franzosen auf dem Schlachtfelde wird nicht ganz erreicht von ihrer Bereitschaft zu ökonomischen Opfern.
Eine weitgehende Übereinstimmung finden wir dagegen mit Bezug auf die Auflehnung gegen die Übermacht des Staates. Zwar dauert es ein Jahrhundert länger als in England, bis im Gefolge der Revolution von 1789 das parlamentarische Budgetrecht sieh durchsetzt, aber von da an hat sich das Parlament, trotz mancherlei Rückfällen während des Kaiserreiches und auch noch später, die Verfügung über die Staatskasse nie mehr von der Regierung entwinden lassen. Es hängt wohl mit dem späten Erfolg dieses Kampfes und auch mit dem Umfang der Misstände im Staatshaushalt am Ende des 18. Jahrhunderts zusammen, dass auch nach dem Siege des Parlamentes die misstrauische Einstellung des französischen Volkes zum Staate sich noch bis in die Gegenwart erhalten konnte. Zum Beleg wäre etwa darauf zu verweisen, dass staatliche und kommunale Unternehmungen in Frankreich eher noch weniger verbreitet sind als in England. Das Bestreben, wenigstens die Eisenbahnen zu verstaatlichen, das während Jahrzehnten die Öffentlichkeit beschäftigte, hat sogar unter der Herrschaft des sozialistischen Kabinetts Léon Blum nur den Teilerfolg gehabt, dass die grossen Eisenbahngesellschaften zu einer einzigen Gesellschaft zusammengefasst wurden, an deren Kapital der Staat allerdings massgebend (mit 51 %) beteiligt ist.
Das Misstrauen gegen den Staat zeigt sich aber nicht nur im Hinblick auf seine Eignung zum Unternehmer, wir finden es auch — wenn auch zeitweise nur in latenter Form — im Hinblick auf seine Rolle als Schuldner. Die Erinnerung an die Experimente des schottischen Zauberkünstlers John Law in den 1720er Jahren und besonders an die Assignatenwirtschaft des Revolutionszeitalters haben in dem sparenden französischen Volke fortgewirkt bis ins 19. und 20. Jahrhundert, und der immer wieder zitierte Ausspruch eines der letzten Finanzminister des ancien régime, wonach in jedem Jahrhundert einmal der Staatsbankerott eine notwendige Massregel sei, war nicht geeignet, dieses Misstrauen zu besänftigen.
Nun hat der Staat mancherlei Einrichtungen getroffen, um diese Bedenken zu zerstreuen. Die Steuerfreiheit der Staatsrenten, die immer wieder mit der Begründung verlangt und auch gewährt wurde, dass bei ihrem Fehlen ein verhüllter Staatsbankerott durch hohe Couponsteuern sehr leicht gemacht sei, ist neben der eigentümlichen Einrichtung der Dette viagère, die in der Gleichstellung der zivilen und militärischen Pensions ansprüche mit der eigentlichen Staatsschuld besteht, wohl der sichtbarste Ausfluss dieses Bestrebens. Und nach dem ersten Weltkriege, als Währung und Finanzen des französischen Staates in immer schlimmere Bedrängnis gerieten, sehen wir die beiden hervorragendsten Finanzminister jener Zeit, Caillaux und Poincaré, bemüht, dem Rentner das Erlebnis einer Devalvation der Währung zu ersparen oder die Auswirkungen einer solchen Massnahme wenigstens zu mildern. Caillaux machte im Jahre 1925 den nur teilweise gelungenen Versuch einer wertbeständigen Konsolidierungsanleihe und trug sich auch mit dem Gedanken der Anwendung einer Entwertungsskala bei der Stabilisierung der Währung, durch welche jeder Gläubiger das Mass von Kaufkraft seiner Forderung erhalten sollte, das er seinerzeit dahingegeben hatte. Poincaré seinerseits wirkte vor allem durch den Einsatz seines persönlichen Ansehens, seines Rufes als eines Mannes, der sein Wort hält, ein Einsatz, der dann auch in der Tat im Inlande wie im Auslande sich als so erfolgreich erwies, dass die Welt in den Jahren 1926 und 1927 vielleicht das kaum glaubliche Schauspiel einer Kurssteigerung des Frankens von 10% bis zur Parität hinauf erlebt hätte, wenn Poincaré nicht selber, im Interesse der Exportindustrie und des Fremdenverkehrs, das Signal zum Halt hätte geben müssen.
Die Devalvation vom Jahre 1928 war dann freilich eine um so schwerere Enttäuschung, nicht nur für die Staatsgläubiger, sondern vor allem für Poincaré selber, der lange gehofft hatte, sie vermeiden zu können.
Die Erlebnisse des Durchschnittsfranzosen auf dem Gebiete des öffentlichen Kredites haben natürlich auch seine steuerpolitische Einstellung beeinflusst.
Wiederum gewitzigt durch die Erfahrungen, die im 18. Jahrhundert mit willkürlich durchgeführten Vermögens- und Einkommenssteuern und mit der Überantwortung gewisser Finanzquellen an Steuerpächter gemacht worden waren, brachten die Franzosen schon bei der Neuordnung der Finanzgesetzgebung durch die Constituante und dann das ganze 19. Jahrhundert hindurch der Fähigkeit ihres Staates, die Steuerlast gerecht zu verteilen, ein tiefes Misstrauen entgegen. Das zähe Festhalten an den im Revolutionszeitalter geschaffenen, nach äusseren Merkmalen bemessenen Ertragssteuern, der Grund- und Gebäudesteuer, der Tür- und Fenstersteuer, der Gewerbesteuer, der Steuer vom Mietwert der Wohnungen und die Ablehnung der allgemeinen Vermögens- und Einkommenssteuer wurden immer und immer wieder mit dem Satze begründet, dass ohne inquisitorisches Eindringen des Staates in alle Privatverhältnisse die Einkommenssteuer gar nicht durchführbar sei, und dass man an eine Unparteilichkeit der Verwaltung bei der Feststellung der Besteuerungsgrundlagen nicht glauben könne. Erst dem Finanzminister Joseph Caillaux gelang es, kurz vor dem ersten Weltkriege, das Parlament davon zu überzeugen, dass bei Annahme des englischen Systems der Einkommensbesteuerung die Erfassung des Einkommens weder besondere technische Schwierigkeiten biete, noch der Willkür der Steuerbeamten viel Raum lasse. So kam, nachdem Caillaux selbst inzwischen vom politischen Schauplatz abgetreten war, im Jahre 1917 die grosse, von seinem Geiste getragene Reform der französischen direkten Steuern zustande. Aber der Versuch, die an die Quelle anknüpfende Besteuerung der einzelnen Erscheinungsformen des Einkommens, die impôts cédulaires, durch eine das Gesamteinkommen erfassende, allgemeine und progressive Einkommenssteuer nach dem Vorbild der englischen Surtax zu ergänzen, ist doch nur auf dem Papier geglückt. Alle z. T. von bemerkenswerter Erfindungsgabe eingegebenen Versuche, die Deklarationen des Gesamteinkommens zu kontrollieren, neben denen hartnäckige Bemühungen einhergingen, den Völkerbund zu internationalen Massnahmen gegen die Steuerflucht zu bewegen
— alles das hat nichts genützt und hat nicht verhindern können, dass die subjektive Einkommenssteuer in Frankreich ein Fehlschlag geworden ist. Dieser Misserfolg der allgemeinen Einkommenssteuer ist zweifellos darauf zurückzuführen, dass die Franzosen den geduldigen Empirismus der Engländer, die die Surtax erst 70 Jahre nach der Einführung der Einkommenssteuer schufen, nicht auf brachten, sondern in dem Drange nach rascher Verwirklichung des Gedankens der progressiven Abstufung die Steuer vom Gesamteinkommen gleichzeitig mit den einzelnen Quellensteuern ins Leben rufen wollten und zudem auch die mittleren und sogar kleinen Einkommen dieser Abgabe unterwarfen, wodurch eine Verwaltungsaufgabe entstand, der der zur Verfügung stehende Apparat nicht gewachsen war.
An einer ungünstigen Auswirkung erkennen wir hier den Geist logischer Konsequenz, der dem französischen Denken eignet. Dieser Geist hat aber noch andere, vielseitige Wirkungen auf dem Gebiete der Finanzgesetzgebung gehabt. Er tritt schon in rein formaler Beziehung, in der Gestaltung der Gesetze hervor. Die Klarheit, die prägnante Kürze der französischen Steuergesetze steht im denkbar grössten Gegensatz zu der unsystematischen, sich oft in tausend Einzelheiten verlierenden Breite der englischen und mehr noch der amerikanischen Texte. Die juristische Begabung der Franzosen macht sich aber auch geltend, manchmal allzusehr geltend, im materiellen Gehalt ihrer Finanzpolitik. Es sei etwa verwiesen auf Poincaré, dessen nicht immer glückliche Rolle in der internationalen Finanzpolitik nach 1920 wesentlich dadurch bedingt gewesen ist, dass er die Reparationsansprüche Frankreichs an Deutschland nicht anders behandelt wissen wollte als einen zivilrechtlichen Handel, eine Auffassung, die schliesslich zu dem als Exekution gegenüber einem Schuldner gedachten Einmarsch in das Ruhrgebiet mit allen seinen weitern Folgen geführt hat.
Eine weitere Auswirkung der französischen Neigung zur Verfolgung eines Gedankens bis zu seiner äussersten Konsequenz ist die Tatsache, dass in keinem anderen Lande die Idee der einzigen Steuer, der Vorschlag, die Masse hergebrachter Abgaben durch
eine einzige, möglichst gerechte Abgabe zu ersetzen, die Geister so nachhaltig beschäftigt hat. Schon im 16. Jahrhundert wurden Pläne erwogen, die bestehenden Steuern durch eine Kombination von Haus- und Herdsteuer zu ersetzen. Im Jahre 1707 erscheint die "Dîme royale" des Festungsbaumeisters Vauban, wiederum ein Vorschlag zur Vereinfachung des Steuersystems, der allerdings nur die direkten Steuern zu einer einzigen zusammenfassen wollte. Dann kommen die Physiokraten mit ihrer Lehre, dass nur der Ackerbau produktiv sei und ihrem darauf beruhenden Vorschlag, die Grundsteuer zur einzigen Steuer auszubauen.
Sogar im 19. Jahrhundert noch spukt die Idee der einzigen Steuer in den Köpfen. Im Jahre 1852 leitet der Journalist Emile de Girardin aus der Anschauung, dass die Steuern mit einer Assekuranzprämie für Erhaltung des Vermögens zu vergleichen seien, den Plan einer "Kapitalversicherungsprämie" ab, die an die Stelle aller anderen Steuern treten und die bei einem Satze von 1 % jedem Staatsbürger fast alle öffentlichen Leistungen, einschliesslich Rechtspflege und Altersversorgung, unentgeltlich verschaffen sollte. Noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts, im Jahre 1887, flammt die Idee der einzigen Steuer nochmals auf in einem Beschlusse der Deputiertenkammer, der die Regierung aufforderte, einen Plan zur Ersetzung aller Steuern durch die Einkommenssteuer vorzulegen.
Endlich wäre noch ein Gebiet zu nennen, auf welchem der Geist konsequenten Durchdenkens den Franzosen eine Priorität vor anderen Völkern gesichert hat: die theoretische Begründung der Steuerprogression. Obgleich im Altertum und im Mittelalter progressive Abstufungen der Steuer nach der Höhe des Vermögens schon öfters vorgekommen waren, so rührt die Durchschlagskraft dieses Gedankens doch erst von den Formulierungen her, die ihm französische Schriftsteller des 18. Jahrhunderts — ich nenne nur J. J. Rousseau, der auf einer halben Seite seines "Discours sur l'économie politique" (1755) alles Wesentliche schon sagte — gegeben haben.
Es wird wohl immer ein Rätsel der Völkerpsychologie bleiben,
woher es kommt, dass ein Volk, das so klar denkt, öfter als andere Völker in finanzielle Katastrophen verwickelt worden ist. Aber das sorgenlose Sichgehenlassen, das in guten Zeiten fast regelmässig auf allen Lebensgebieten in Frankreich herrscht, ist vielleicht noch am ehesten durch das zu erklären, was man den "Esprit débrouillard" genannt hat. Die immer wieder gemachte Erfahrung, dass die Folgen der Sorglosigkeit im letzten Momente, am Rande des Abgrundes, durch einen entschlossenen politischen oder militärischen Führer, einen Napoleon, einen Adolf Thiers, einen Waldeck-Rousseau, einen Joffre, einen Clémenceau verhütet wurden, und dass das Volk sich in solchen Augenblicken wie ein Mann hinter solche Führer stellte, hat auch auf dem Gebiete der Finanzpolitik einer soliden Gebarung häufig entgegengestanden. Man war immer wieder davon überzeugt, dass die Dinge sich schon wieder arrangieren würden, und kam es dann zu kritischen Lagen, so rief man nach dem starken Manne, der als Verkörperung des esprit débrouillard gelten konnte. Aber es verdient immerhin Erwähnung, dass, während einzelnen der genannten politischen oder militärischen Führer die Wiederherstellung einer günstigeren Lage für einen längeren Zeitraum gelang, die Finanzpolitiker, die in extremis berufen wurden, im allgemeinen weniger Glück hatten. Ganz eindeutigen und dauernden Erfolg hatte eigentlich nur Adolf Thiers mit seiner meisterhaften finanziellen Liquidation des Krieges von 1870/71. Ihm wäre am ehesten noch Colbert zu vergleichen, der zwei Jahrhunderte vorher sich um Ordnung im französischen Staatshaushalt bemühte und dabei lange Jahre Fortschritte erzielte, bis seine Spartendenzen mit der Verschwendungssucht Ludwigs XIV. in Konflikt gerieten. Einen gründlichen, aber zeitlich auf wenige Jahre beschränkten Erfolg hatte auch Poincaré, wogegen zwei andere mit grossen Hoffnungen begrüsste Retter der Finanzen ihren Abschied nehmen mussten, noch bevor sie recht mit ihrem Werke hatten beginnen können: Turgot, der 1774 von Ludwig XVI. berufen, sich das ehrgeizige Programm vorgenommen hatte, weder neue Steuern noch neue Anleihen zu erheben noch Staatsbankerott zu begehen, aber schon 1776
die Hoffnung, die Verschwendungssucht des Hofes eindämmen zu können, aufgab und seinen Rücktritt nahm, und in der neuesten Zeit Caillaux, der im Jahre 1926 mit seinem Verlangen nach unbeschränkten Vollmachten den Sturz des Kabinetts Briand, dem er als Finanzminister angehörte, herbeiführte. Ob Necker seinen Misserfolg verdient hat oder nicht, ist heute noch umstritten. Seine Geschicklichkeit bei den Anleihensoperationen wurde bewundert, aber Ersparnisse und Steuerreformen hat er nicht mit der Energie angestrebt, welche die damalige Lage der Staatsfinanzen erforderte.
IV.
Kaum lässt sich ein grösserer Gegensatz denken zwischen der sprunghaften, an kühnen Improvisationen reichen politischen Entwicklung Frankreichs und der Kontinuität, mit welcher Deutschland während vieler Jahrhunderte den entscheidenden Einfluss in der Finanzverwaltung dem Beamtentum überlassen hat.
Mit einer Unterbrechung, die von 1918 bis 1932 gedauert hat, ist Deutschland ein "Obrigkeitsstaat"gewesen. Die Regierungen, die von den Landesherren ohne Zutun des Parlamentes bestellt wurden, waren nicht auf dessen Vertrauen angewiesen und konnten von ihm nicht abgesetzt werden. Hier liegt wohl der Grund dafür, dass Deutschland, obgleich es von jeher einen Beamtenstand besass, der an Sachkenntnis und Tüchtigkeit den der zwei anderen führenden Völker mindestens erreichte, doch nur wenig Staatsmänner hervorgebracht hat, die auf dem Gebiete der Finanzpolitik sich internationalen Ruf erworben haben. Aus der langen Reihe der Männer, die seit 1871 im Reichsfinanzministerium sassen, sticht eigentlich nur einer hervor: Karl Helfferich, der im ersten Weltkrieg zeitweise Reichsschatzsekretär war. Aber Helfferich hat das Ansehen, das er sich vorher als Geldtheoretiker und Bankfachmann erworben hatte, in seinem politischen Amte grösstenteils wieder eingebüsst, weil er seine ganze Steuer- und Anleihepolitik in allzu grossem
Optimismus auf die Hoffnung auf eine Kriegsentschädigung gründete und erst durch seine geistige Urheberschaft an dem psychologisch wohl durchdachten Experiment der "Rentenmark" hat er sich teilweise wieder rehabilitiert.
Unbestrittener als der Ruhm Helfferichs ist der der preussischen Finanzminister Motz und Miquel geblieben, die bei der Gründung des deutschen Zollvereins in den 1830er Jahren bzw. bei der Reform der Einkommenssteuer in Preussen zu Anfang der 1890er Jahre eine Rolle gespielt haben. Die Armut Deutschlands an berühmten Finanzministern, selbst in der parlamentarischen Epoche, ist allerdings wohl auch durch das Format des lange führenden Staatsmannes, des Fürsten Bismarck, bedingt gewesen, der wie bei allen wichtigen Geschäften, so auch bei finanzpolitischen Entscheidungen von Bedeutung persönlich einzugreifen pflegte, so namentlich beim Übergang zum Schutzzoll und bei dem Versuch einer Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen Reich und Gliedstaaten zu Ende der 1870er Jahre. Seinem autoritären Auftreten im preussischen Verfassungskonflikt der 1860er Jahre, dem Streitigkeiten um die Militärausgaben zugrunde lagen, ist es anderseits auch zu verdanken, dass ihm später im Parlamente ein Kritiker erstand, Eugen Richter, der sich im Laufe der Jahre zu einem von der Verwaltung gefürchteten Kenner des Budgets entwickelte.
Aber sonst blieb der Einfluss des Parlamentes auf die Finanzgebarung bis zur Umwälzung von 1918 schon deswegen bescheiden, weil nicht wenige Länder, darunter auch grössere wie Bayern, die Einrichtung hatten, dass die Budgets nicht für ein, sondern gleich für zwei bis drei Jahre zu bewilligen waren.
Nach welchen Ideen hat nun in Deutschland die führende Beamtenschicht den Staatshaushalt gestaltet?
Wir sehen hier in erster Linie, wie der den Deutschen eigene Unternehmungsgeist sich ausgewirkt hat. Eine Reihe von Ländern brachten in die Neuzeit einen ausgedehnten Besitz an Forsten, Domänen, Salinen und Bergwerken mit. An diesen hergebrachten öffentlichen Besitz schlossen sich die Eisenbahnen, die z. T. wie in Süddeutschland von Anfang an staatliche Unternehmungen
waren, z. T. wie in Preussen erst später, aber immerhin früh, in den 1870er Jahren schon, vom Staate übernommen wurden. Ganz ähnlich wie unsere Kantone haben die Einzelstaaten auch früh, z. T. sogar schon im 18. Jahrhundert, Staatsbanken ins Leben gerufen, und in den letzten Jahrzehnten kamen noch Kraftwerke und andere Unternehmungen hinzu. So konnte Deutschland, wo die Gliedstaaten vor dem ersten Weltkriege mehr als einen Drittel ihrer Einnahmen aus öffentlichen Betrieben bezogen, lange Zeit als der Typus des "Unternehmerstaates" gelten.
In der Gestaltung der Steuern zeigten sich mitunter die Einflüsse der engen Verbindung des Grossgrundbesitzes und des Heeres mit der führenden Beamtenschicht, so z. B. in der Einstellung zur Militärpflichtersatzsteuer, die bis zum Jahre 1937 mit der Begründung abgelehnt wurde, dass der Militärdienst ein Ehrendienst sei und nicht durch eine Geldleistung ersetzt werden könne, oder in dem hartnäckigen Widerstand des ostpreussischen Grundbesitzes gegen die Erbschaftssteuer, der im Jahre 1909 den Sturz des Reichskanzlers Bülow herbeiführte und dadurch sogar von weitgeschichtlicher Bedeutung geworden ist.
Diesen eher negativ zu wertenden steuerpolitischen Leistungen steht als positives Moment vor allem die umsichtige und in vielem vorbildliche Art gegenüber, wie gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Übergang von den alten, an die Objekte anknüpfenden Ertragssteuern zur subjektiven und progressiven Einkommenssteuer vollzogen wurde. Das geschah fast durchweg in der Weise, dass die Einkommenssteuer zunächst nur im Staatshaushalt eingeführt wurde, während im Gemeindehaushalt das Experiment zunächst verschoben oder sogar ganz unterlassen wurde.
Auf dem Boden des Staates erfolgte dann aber die Durchführung der Einkommenssteuer in der reinsten Form, in der Form der allgemeinen, Vermögensertrag und Erwerb zusammenfassenden Einkommenssteuer, mit mässiger ergänzender Vermögenssteuer, wodurch der Typus der Einkommenssteuer entstand,
der in die finanzwissenschaftliche Literatur als der deutsche oder der preussische Typus eingegangen ist.
Seine weiteren Schicksale waren freilich so eigenartig, dass sie eine Erwähnung verdienen. Nur wenige Staaten haben ihn restlos übernommen. Die meisten schlossen sich dem englischen System an, das heisst sie besteuern ehe verschiedenen Erscheinungsformen des Einkommens tunlichst nahe an der Quelle, setzen aber neben und über diese partiellen Einkommenssteuern für die grösseren Einkommen eine allgemeine und progressive Einkommenssteuer nach deutschem Vorbild, so Italien, Belgien, Frankreich, die Tschechoslovakei und andere. Interessant ist nun aber, dass, während so im Auslande der deutsche Typus der Einkommenssteuer, wenn auch nur im Sinne einer Ergänzung des englischen Systems, vordrang, er in Deutschland selber angefochten und z. T. wieder verlassen wurde. Es ist namentlich die Kritik Heinrich Dietzels und Franz Meisels gewesen, die bewirkt hat, dass die nach dem ersten Weltkriege geschaffene Reichseinkommenssteuer starke Anklänge an das englische System, namentlich im Sinne der Erfassung der Löhne und gewisser Kapitalrenten an der Quelle, aufweist.
Sucht man nach weiteren Anregungen, die von der deutschen Steuerpolitik ausgegangen sind, so wäre etwa noch die Sonderbelastung der Warenhäuser durch eine Umsatzsteuer zu nennen, die zu Ende des letzten Jahrhunderts geschaffen wurde und die dann später auch von anderen Ländern, so von Frankreich und von der Schweiz, übernommen worden ist.
Die Warenhaussteuer, als Ausdruck mittelstandspolitischer Bestrebungen, ist eine der wenigen fiskalischen Einrichtungen, die ihr Dasein mehr den Anschauungen des Bürgertums als denen der Regierungen verdanken. Will man jene Anschauungen noch näher kennen lernen, so muss man den Gemeindehaushalt ins Auge fassen, der schon am Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland der Selbstverwaltung durch die Bürgerschaft überlassen wurde. Hier zeigt sich nochmals eine typische deutsche Eigenschaft, der Schaffensdrang, der noch dadurch eine Steigerung erfuhr, dass das Amt eines Stadtoberhauptes vielfach
als ein rein technischer Beruf aufgefasst wurde, und man sich daher auch nicht scheute, die Oberbürgermeister, Stadträte usw. häufig aus anderen Städten, ja sogar aus anderen Ländern zu berufen. Es ist klar, dass Magistratspersonen, die so unabhängig von lokalen Bindungen waren, die kommunale Wirtschafts- und Finanzpolitik nach sachlichen Gesichtspunkten führen konnten, und so sehen wir denn auch, wie die deutschen Städte meist rechtzeitig zur Verstaatlichung der Versorgungsbetriebe, der Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke, Straßenbahnen usw. schreiten und wie sie eine weitsichtige Bodenpolitik durch Ausdehnung des städtischen Grundbesitzes und Besteuerung des unverdienten Wertzuwachses treiben konnten.
V.
Am Ende dieser Betrachtung der Elemente, aus denen das finanzpolitische Gedankengut der Gegenwart entstanden ist, drängt sich die Frage auf, in welchem Masse die Schweiz aus ihm geschöpft hat und weiter die Frage, ob das Land im Herzen Europas, das auf manchen anderen Gebieten des öffentlichen Lebens Vorbildliches geleistet hat, nicht doch auch etwas zur Mehrung des finanzpolitischen Erfahrungsschatzes beigetragen hat.
Die erste Frage wäre wohl dahin zu beantworten, dass die Schweiz auf dem Gebiete der Finanzpolitik im allgemeinen ihre eigenen Wege gegangen ist. Am Ende des 18. Jahrhunderts wird ihr zwar das damalige französische Steuersystem aufgezwungen und einige Reste davon, namentlich auf dem Gebiete der Gewerbe- und Verkehrssteuern, haben sich in der Westschweiz bis auf den heutigen Tag erhalten. Am Anfang des 20. Jahrhunderts empfangen die schweizerischen Stadtverwaltungen manche Anregungen aus Deutschland, besonders auch mit Bezug auf städtische Unternehmungen und mit Bezug auf die Bodenpolitik. Auf eidgenössischem Boden ist die im Jahre 1915 beschlossene, als "einmalig" erklärte eidg. Kriegssteuer vom Vermögen
und Einkommen sichtlich unter dem Eindruck des "Wehrbeitrages" zustande gekommen, den das Deutsche Reich im Jahre 1913 erhoben hatte. In allerjüngster Zeit erfolgt eine Anlehnung an englische Vorbilder, indem das Prinzip der Erfassung der Einkünfte an der Quelle sich durchzusetzen beginnt, so beim Lohnabzug für den Erwerbsausgleich der Wehrmänner, so bei der Besteuerung der inländischen Wertpapiere und Bankguthaben im Rahmen der Wehrsteuer und — durch das Mittel der "Verrechnungssteuer" — sogar bei den Kantons- und Gemeindesteuern.
Aber das sind vereinzelte Fälle. In der Hauptsache ist das schweizerische Finanzsystem auf eigenem Boden gewachsen. Abneigung gegen die Steuern vom Verkehr und vom Verbrauch, die als Belästigungen von Handel und Gewerbe und als unsoziale Belastung der Massen empfunden wurden, bis in die allerjüngste Zeit, Vorliebe für stark progressive Vermögens- und Einkommenssteuern und — im Widerspruch dazu — zähes Festhalten an Kopfsteuern, das sind die Hauptcharakterzüge der schweizerischen Finanzgebarung. Sie haben oft die Aufmerksamkeit des Auslandes erregt, ihm aber nicht als Vorbild gedient.
Der Kanton Baselstadt galt allerdings zeitweise als der Erfinder der allgemeinen, Vermögensertrag und Erwerb zu einer Einheit zusammenfassenden Einkommenssteuer. Von dem Ratsherrn Johann Georg Von der Mühll schon im Jahre 1818 angeregt, ist dieser Typus der Einkommenssteuer aber in Basel erst 1840 verwirklicht worden, nach Lübeck und nach Sachsen-Weimar, die ihn schon 1816 bzw. 1821 angenommen hatten.
Die Originalität der schweizerischen Finanzpolitik liegt also nicht auf dem Gebiete der Steuergesetzgebung. Wenn sie sich trotzdem Ansehen erworben hat in der Welt, wenn die schweizerischen Staatsschuldtitel noch heute in den Augen vieler Europäer eine Kapitalanlage von maximaler Sicherheit sind, so hängt dies einmal mit der angeborenen und nicht durch Kriege und Währungskatastrophen zerrütteten Schuldnermoral des Schweizervolkes zusammen und sodann mit der wachsenden Einsicht, dass die rein demokratische Staatsform, die sich im
Finanzreferendum ein oft recht wirksames Instrument geschaffen hat, in den Händen eines staatsbürgerlich geschulten und mit seiner ökonomischen Lage im ganzen zufriedenen Volkes, eine Garantie gegen politische und finanzielle Abenteuer bedeutet, wie sie weder die parlamentarische Republik noch die Monarchie oder die Diktatur zu bieten vermögen.






