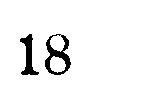Universitas litterarum
Rektoratsrede
von
Verlag Paul Haupt Bern 1947
Alle Rechte vorbehalten Copyright 1947 by Paul Haupt, Berne Printed in Switzerland - Imprimé en Suisse Buchdruckerei F. Graf-Lehmann, Bern
Universitas litterarum
Rektoratsrede von Prof. Dr. W. Näf
Am Dies academicus tritt der Rektor unserer hohen Schule vor die Behörden und Freunde, die Lehrer und Studenten, welche die Universität tragen und ausmachen und sie, einmal im Jahr, in ihrer Gemeinschaft festlich darstellen. Wie im Turnus des Rektorates die sieben Fakultäten einander folgen, wie der Sprecher des Tages gerne die seltene Gelegenheit ergreift, um in diesem weitesten akademischen Rahmen vom Anteil seines Faches an Forschung und Lehre zu künden, strahlt etwas vom reichen Leben unseres Alltags in die Oeffentlichkeit hinaus, und deutlich illustriert die lange Reihe der Rektoratsreden die Vielfalt dieses Lebens. Bisweilen aber geschieht es, dass die Universitas litterarum gewissermassen in Person den Wunsch kundtut, es möge an ihrem Geburtstag von ihr. selbst die Rede sein, da sie über Fakultäten und Fächern ihre eigene Geltung und Würde besitze. Dieser Wunsch ist von mehreren meiner Vorgänger vernommen worden; er erneuert sich stets, denn er geht aus der besorgten Frage hervor, ob diese Universitas in Wahrheit noch bestehe, ob und wie sie die Fülle der Einzelwissenschaften noch zu umfassen vermöge, ob und wie diese sich zur organischen Einheit fügen lassen. Die Frage ist nicht neu; aber erst das 19. Jahrhundert hat sie so gestellt, dass die zuversichtliche Antwort ausblieb; heute reicht sie tiefer als je bis zu den Grundlagen unserer geistigen, ja unserer physischen Existenz.
Der Historiker kennt einen Zugang zum Verständnis der Dinge: den entwicklungsgeschichtlichen Weg. Er vermag aus Folge und Abwandlung der Erscheinungen das im grossen Zusammenhang
Dauernde, damit etwas vom Wesen seines Gegenstandes zu erkennen, etwas von seiner Idee. Er weiss, dass auch die Gegenwart der Dimension angehört, in der sich sein Denken bewegt, der Zeit, und dass jede Zeitlage ihrer Generation erlaubt und gebietet, an die Zukunft zu denken.
Der historische Gehalt der Frage, die wir andeuteten, mag den Sprechenden auch von seinem Fach aus berechtigen, ein so allgemeines und so gegenwärtiges Problem zum Thema seiner Rede zu wählen. 1
Das Problem wird schon im Begriff angezeigt; denn Universitas
bedeutet nicht schlechterdings Einheit, sondern das
zur Einheit Gewendete, Zusammengefasste, — was die Vorstellung
einer Vielheit voraussetzt. Indessen sprach man im
14. und 15. Jahrhundert — der Zeit, in die die mitteleuropäische
Universitätstradition zurückreicht 2 _ nicht von der Universitas
litterarum, sondern von der Universitas magistrorum et scholarium,
der organisierten Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden.
Die Universität war Korporation mit eigenem Recht .und
Gericht, mit Selbstverwaltung und kollektivem Haushalt, mit
besonderer Tracht und Sitte, die ihre Bürger als einen Klerus
aus dem übrigen Volke heraushoben. Wollte man den Rang der
Lehranstalt, im Unterschied von den sogenannten Lateinschulen,
bezeichnen, so sprach man vom Studium generale. Es war in
Aufbau und Ziel einheitlich: ein Cursus durch die Artistenfakultät
zur Theologie mit zwei Abzweigungen zur Juristischen
und zur Medizinischen Fakultät. Die Theologie gibt Sinn und
Richtung; das Studium führt in innerer Konsequenz zum Gottesdienst,
in äusserer Absicht zum Kirchendienst. Der Titel des
Doktors der Theologie ist vollkommener Ausweis des wissenden
Glaubens, beste durch Studium erreichbare Empfehlung für
kirchliche Aemter und Pfründen. Jurisprudenz und Medizin
sind Aussenposten, jene, mehr als kirchliche Rechtskunde, denn
als Rechtswissenschaft, ihrerseits der Kirche dienend, diese, die
Medizin, zwar durch ein unmittelbares praktisches Bedürfnis
eigenständig, aber ausserordentlich dürftig entwickelt und ausgestattet.
Die vier Fakultäten sind also da, aber sie sind einander
nicht nebengeordnet, und völlig fehlt, in Vorstellung und
Organisation, eine Universitas selbständiger Einzelwissenschaften. Die eine lange Bahn vom vorbereitenden artistischen Studium zur krönenden Theologie wurde freilich von wenigen durchlaufen: sie erlaubte an beliebigen Stellen den Austritt, den Uebertritt in den Kirchendienst oder, allmählich immer mehr, in eine weltliche Tätigkeit in Stadt und Staat, Schule und Verwaltung. Es gab im wesentlichen nur verschiedene Stufen einer philosophisch-theologischen Bildung; auch die Spezialisierung, die sich für Juristen und Mediziner andeutete, verliess deren Basis nicht.
Die scholastische Universität fand ihre starke, schliesslich ihre starre Einheit in dem, was die christliche Glaubenslehre anregte, forderte, zuliess. Die Wissenschaft, die sie aufgenommen hatte, trug ursprünglich jene Spannung in sich, die zu allen Zeiten geistiges Leben wahrhaft fruchtbar macht, die Spannung zwischen Wissen und Glauben zwischen Kenntnissen im einzelnen und einer Weltanschauung im ganzen. Die mittelalterliche Wissenschaftsentwicklung hatte in grossartiger Leistung das antike Erbe, d. h. die aristotelische und von da aus die hellenistische Wissenschaft mit dem christlichen Geist zusammengeführt, und diejenige Verbindung von Altertum und Christentum zustandegebracht, deren das kirchlich dominierte Zeitalter fähig war. Dann aber hatte ihr das von der kirchlichen Macht gestützte Dogma Schranken gesetzt: die erforschte und erforschbare Wahrheit muss der geoffenbarten Wahrheit untergeordnet bleiben. Hier wurde der Fortgang gehemmt, und jene Spannung erlahmte. Die Universität, die in ihr monopolisierte Wissenschaft ergab sich, verlor sich in dem Betrieb, der die Spätscholastik des 14. und 15. Jahrhunderts charakterisiert, und der schliesslich als Leerlauf, als Unfreiheit empfunden und angefochten würde: in disputierender Verteidigung dogmatisch gefasster Heilswahrheiten, in bei feststehendem Ausgang nur scheinbaren Meinungskämpfen, in der Rivalität von Schulrichtungen, in der Routine des Fechtens mit Zitaten, die nicht Ueberzeugungen entsprachen, sondern bloss dialektische Argumente waren.
Hier ist denn auch zu erkennen, wo der humanistische Einbruch erfolgte, und was er bedeutete. 3
Der Humanismus gab sich als Befreiungsbewegung; er war kämpferisch. Er stiess von aussen gegen die Universitäten vor, mit neuen geistigen Ansprüchen, die ihren Nachdruck im gewachsenen Bewusstsein der Staaten, in der Kraft und in den diesseitigen Interessen städtischer Bürgerschaften fanden. Er eroberte die Universitäten; er zerstörte ihr korporatives Gefüge nicht, aber er durchstiess die Dämme scholastischer Ausschliesslichkeit. Er hob vergrabene Schätze, um aus ihnen die Bildung des Menschen, das neue Bildungsideal der Humanitas zu erreichen: die alten Schriftsteller, heidnische und christliche. In ihrer Sprache und Form, ihrem Wissen und ihrer Weisheit sahen die Humanisten eigene, unabhängige Werte, neben der biblischen Offenbarung, neben der Theologie und Philosophie der Kirchenväter. Ihr Ruf: Ad fontes! fordert auf, aus allen Quellen zu trinken, wenn es nur reine Quellen sind.
Damit war freilich die strenge Einheit durchbrochen. Die Spannung zwischen Glauben und Wissen ist neu erregt, und anders wird der Wertakzent gelegt: Das Wissen soll entscheiden. Das Wissen aber ist vielfältig, wie die Natur es bietet und der Menschengeist es erfassen kann. Die. Humanisten nannten die Universität Gymnasium, Kampfplatz des Geistes; sie nannten sie auch, in der Vorliebe für klassische Anklänge, Academia oder Musarum Collegium. Die Begeisterung für die neuentdeckte Kulturwelt der Antike verführte die Humanisten freilich leicht zu neuer Einseitigkeit, zu Abhängigkeit von der Autorität der Alten. Die Imitatio klassischer Vorbilder züchtete Epigonentum, wo sie sich auf Nachahmung antiker Sprach- und Versformen, auf Uebernahme des den Alten zugänglichen Wissens beschränkte. Sie wurde schöpferisch nur, wo der Urtrieb antiker Geistigkeit seine Renaissance erlebte, der Trieb zu vorurteilsloser Forschung. Die bedeutenden unter den Humanisten haben sich von ihm inspirieren lassen. Poeta und Orator bleiben freilich Ovid und Cicero verpflichtet, bleiben Schüler Quintilians; der Forscher aber kann und soll über den Stand der Alten hinauskommen. Die Wahrheit über alles! "Welch ein Betrug wäre es", so ruft Vadian einmal aus, "die Autorität über die Wahrheit zu stellen!" Der literarische Humanismus hat kostbares Erbgut übernommen; diejenigen Humanisten aber, die zu neuen
historischen und naturwissenschaftlichen Fragestellungen schritten, haben der modernen Forschung die Wege gewiesen. Die Wissenschaft emanzipierte sich. Zum Beispiel die Geographie: Kein antiker Perieget, kein Zeugnis Augustins, auch nicht die biblische Genesis können das Weltbild bestimmen; Naturgesetz und mathematische Berechnung schaffen die Grundlage der Erd- und Himmelskunde, Beobachtung ermöglicht Erkenntnis und Beschreibung im einzelnen; "ipse observavi", ich habe es selbst untersucht, wird beweiskräftiges Argument.
Einzelwissenschaften werden so begründet: Mathematik, Astronomie, Geographie, Geschichte. Die Spezialisierung beginnt; aber sie verwirrt den Blick nicht. Denn die Wissenschaften alle enthüllen nur immer vollständiger das eine herrliche Bild des Kosmos, wo eines in allem wirkt, alles in einem sich findet: der Mensch mit seinem ganzen Leben, die Natur und der Mensch in ihr, Gott im Menschen und in der Natur. Der Vates erahnt diesen harmonischen Zusammenhang, der Forscher erkennt ihn. Dichter und Forscher stehen nebeneinander, Natur und Geist sind eins. Der allseitig Gebildete ist humanus, ist der wahre Mensch. Der Magister artium studiert Medizin, der Poeta ist conphilosophus des Mathematikers. "Vatibus et medicis unus Apollo favet", — derselbe Apoll ist den Dichtern und den Aerzten gewogen.
Für die deutsche Kulturgeschichte ist zweierlei wichtig geworden: dass diese humanistische Aufklärung sich vor der Reformation vollzog, dass sie aber in ihren Anfängen aufgehalten wurde, dass ein religiös bestimmtes Zeitalter von fast zwei Jahrhunderten ihre unmittelbare Auswirkung auf das Bildungswesen, auf das Universitätsleben unterbrach.
Gewiss ist die Reformation nicht schlechthin in Gegensatz zum Humanismus zu stellen, ist nicht nur die vorübergehende Kampfgenossenschaft von Reformatoren und Humanisten zu sehen. Es bestand eine innere Verbindung, wenigstens in einer Beziehung, der sprachlichen. Luther wie Zwingli gingen aus vom Wort, das sich in den biblischen Sprachen darbot; diese aber hatten die Humanisten erschlossen, neben Latein Griechisch und Hebräisch, und humanistische Philologie wusste
das Wort zu interpretieren. Die Reformatoren schätzten die Bildung hoch, forderten Schulen, gründeten und leiteten Schulen, Melanchthon nach Luther, Bullinger nach Zwingli. Das Wort ist ihnen Waffe im Streit; die Sprachen sind die Scheiden, darinnen das Messer des evangelischen Geistes steckt. 4 Die Verkündigung des Wortes bedarf gelehrter Prediger, gebildeter Hörer; für beides soll die Obrigkeit sorgen. Wie die Kirche, so wird die Schule Angelegenheit des Staates. Dem so gewappneten protestantischen Geiste aber antwortete, mit denselben, noch schärfer geschliffenen Waffen, der gegenreformatorische Geist, die Jesuitenschule.
Eines ist deutlich: Gelehrtenschule und Universität haben neuerdings ihren Bezug, ihre Norm, ihre Einheit. Diese ist im Religiösen, in der Verbindlichkeit des konfessionellen Bekenntnisses gesetzt. Wieder bilden den Unterbau Grammatik, Rhetorik, Dialektik, den Oberbau Theologie. Der wissenschaftliche Geist im Zeitalter der Orthodoxie ist der Scholastik näher verwandt als dem Humanismus. Humanismus als autonome Geistesmacht ist gehemmt und verneint worden. Theologische Philosophie herrscht; Einzelwissenschaften um ihrer selbst willen vermögen in dieser Luft nicht zu gedeihen. Man sprach wohl noch von Naturwissenschaften; aber an Zwinglis Collegium in Zürich hatte Konrad Gesner mit seiner Einführung in Natur- und Erdkunde zugleich das Walten der göttlichen Vorsehung zu erweisen, 5) und im 17. Jahrhundert wurden Naturlehre und Mathematik dem Professor ethicus übertragen. 6 Das Studienprogramm wurde zu Aristoteles zurückgelenkt, 7 Ovids Metamorphosen galten auch für das Sachwissen als Thesaurus eruditionis. 8 Wissenschaft soll der religiösen Bildung dienen, der theologischen Bereitschaft, der sapiens atque eloquens pietas, der wissenden und des Wortes mächtigen Frömmigkeit. Die Forschung ist nicht frei; die Jesuitenschule vor allem hat erreicht, was auf protestantischer Seite nie in dieser Geschlossenheit zustandekam: Uniformitas et soliditas doctrinae, Eindeutigkeit und Sicherheit der Lehre.
Von zwei Seiten war die Ueberwindung dieses starren Standes zu erwarten: vom eingeborenen Erkenntnisdrang des Menschen her und vom Staate aus, wenn dieser sich eigene, vom
Kirchlich-Konfessionellen unabhängige Aufgaben stellte. Beides wird seit dem 17. Jahrhundert spürbar. Die der Wissenschaft gesetzte, sie beengende Norm einer Confessio wird überwunden werden. Die alte Einheit verblasst; aber es wird eine neue Verbundenheit der Wissenschaften entdeckt, ein neues Ziel gesteckt werden.
1637 erschien Descartes' "Discours de la Methode" 9 ausserhalb der Schulorganisation und ausserhalb der orthodoxen Lehre. Descartes säkularisierte die Wissenschaft durch seinen grundlegenden Satz, dass als wahr nur gelten könne, was vor der Vernunft unwiderleglich bestehe. Er führte alle Gegenstände der Forschung auf die einfachsten Elemente, die mathematisch zu berechnen, geometrisch evident zu machen sind, zurück, und er leitete aus ihnen jede Erkenntnis der physischen Welt ab. Er nahm, für seine Metaphysik, die Realität des denkenden Menschen an, weil sie unzweifelhaft einleuchte, er setzte Gott, weil die Existenz eines vollkommenen Wesens dem Denken unentbehrlich sei. Descartes ist, indem er sich das Werkzeug seiner Methode schuf, zum unvergleichlichen Förderer der Mathematik geworden; er hat, indem er das Seelische vom Körperlichen trennte, die Scheidung von Geisteswissenschaften und physikalischen Wissenschaften eingeleitet. Aber Descartes' System blieb einheitlich; einheitlich begründet in der Raison, einheitlich gerichtet durch das Gebot der Zweckmässigkeit. Eine doppelte Einheitlichkeit; denn in eigentlich verblüffender Wendung setzte Descartes neben das Prinzip der Vernunft den Gesichtspunkt der Nützlichkeit. Nützliches aber ist, von der Basis logisch deduzierter Erkenntnis aus, zu erreichen durch unendlich vielfache Untersuchungen und Erfahrungen; diese sollen vor allem der dem Leben nützlichsten. Wissenschaft, der Medizin, dienen.
Descartes erhob diesen Ruf als Forderung; indessen war, vor ihm, neben ihm, das neue Denken, die neue Forschung in vollem Fluss; Wissen ist Macht, hatte Bacon erklärt; soeben hatte Harvey die bedeutungsvolle Entdeckung. des Blutkreislauf es gemacht, die ohne experimentelle Methode unerreichbar gewesen wäre. Vom 16. zum 18. Jahrhundert wurde das "natürliche Weltbild" gewonnen, wurden Mathematik und experimentelle
Naturwissenschaften weit über das hinausgeführt, was die Humanisten erkannt oder geahnt hatten.
Das andere stiess dazu: der Staat, der sein Selbstbewusstsein steigerte, seine Autorität rational rechtfertigte, seine Wirtschaft zum materiellen Gedeihen nutzte, Wohlfahrtsaufgaben übernahm. Die Staatswissenschaften wurden wichtig; die juristischen Fakultäten entfalteten sich.
Die Wissenschaften empfingen ihr inneres Gesetz von der Vernunft, und sie waren gehalten, nützlich zu sein. Vernunft und Nützlichkeit, — in Glauben und Willen der Zeit widersprachen sie sich nicht, sondern fanden sich in der Gleichung, dass das Vernünftige nützlich, das Nützliche vernünftig sei. Dies bestimmte das Bildungsziel. Freilich wirkte auch ein Gebot von aussen: die Universitäten sind Staatsanstalten geworden.
Anstalten sind konservativ. Zwar spürten auch die Universitäten den Zug der Zeit; Halle zuerst, Göttingen sodann wurden Zentren neuer Studien, die eine Vielzahl von Fächern zu enzyklopädischer Bildung verbinden wollten. Noch hielt sich, aus scholastischer Tradition, vieles im Studienaufbau. Die Lateinschule entliess Knaben zur Universität; der Student "philosophierte" nach Art der Artisten, auch wenn er ein Fachstudium ins Auge fasste, philosophisch-philologisch-historisches Wissen galt allen als unentbehrlich. Um 1740 hörte der junge Pütter, den Staatswissenschaften zugewandt, ausser den Vorlesungen seiner Fakultät Mathematik, Metaphysik, Logik, Universalhistorie, philosophische Moral und, da er, dreizehnjährig zur Universität gekommen, noch nicht konfirmiert war, auch Dogmatik. 10
All dies wurde freilich äusserlich und verlor die geistig verpflichtende Kraft. Der zur Herrschaft gelangte Aufklärungsgeist hat schliesslich die Einheit der lehrbaren Wissenschaften nur eben in einem nüchternen Bildungsbegriff festgehalten, in der konventionellen Schätzung des gesellschaftsfähigen, brauchbaren, in vielen Sätteln gerechten Mannes. Diese Einheit war schwach geworden, aber sie löste sich nicht. Es zeigte sich, dass die Ueberwindung des dogmatischen Zwanges, die Förderung der Staatswissenschaften, die Differenzierung der Naturwissenschaften nicht genügten, um den Einheitsstaat der
Gelehrtenrepublik zur Föderation gleichberechtigter Glieder zu lockern, dass auch, jetzt noch, keine Notwendigkeit der Methode, kein Bedürfnis der Praxis dazu drängte. Dies war entscheidend: Es blieb, jedem Lehrer, jedem Schüler, der Einheitsgrund und der fassende Rahmen jener Bildung, die mit Buch und Sprache und Vorstellungswelt das Altertum begründet, das Mittelalter überliefert, die "Philosophische Fakultät" bewahrt hatte. Früh und ohne Prüfungszäsur lief der Gang vom Gymnasium zur Philosophischen Fakultät; diese aber war nicht Berufsschule; sie hatte der Spezialisierung widerstanden, war noch immer die untere und zugleich die überwölbende, die allgemeine Fakultät. Als in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Sinn sich wandte, wurde sie Basis und Trägerin eines neuen Bildungsgedankens, eines neuen Humanismus: Bildung um des Menschen willen, zur Entfaltung seiner geistigen Schönheit und sittlichen Güte. Solche Bildung ist zu gewinnen durch die alten Sprachen, das Griechische vor allem. sie nährt sich an klassischer Philosophie und Poesie, sie wird durch Geschichte erzogen. Sie findet im Altertum für die Gegenwart Mass und Gestalt, den umfassend humanen Sinn. 11
In diesem humanistischen Geisteszug, der bis zu unsern Tagen reicht, ja, wenn wir uns nicht täuschen, eben jetzt wieder anschwillt, ergreift uns eines: dass es, bei so weit fortgeschrittenem Stand der Entwicklung, möglich war, den Wissenschaften allen eine gemeinsame ideale Heimat anzuweisen. 12 Das Einheitsprinzip aller Bildung ist behauptet und neuerdings fordernd aufgestellt worden, jetzt zum erstenmal im vollen Bewusstsein der Tatsache, dass es Einzelwissenschaften gab. Als es sich nach revolutionärer Erschütterung darum handelte, dem wissenschaftlichen Leben Deutschlands in einer Universität Berlin einen neuen Brennpunkt zu schaffen, hat Schleiermacher "Gelegentliche Gedanken über Universitäten" niedergeschrieben. 13 "Alle wissenschaftlichen Bemühungen", so lesen wir hier, "ziehen einander an und wollen in Eines zusammen gehen, und schwerlich giebt es auch auf irgend einem andern Gebiete des menschlichen Thuns eine so ausgebreitete Gemeinschaft ... als auf dem der Wissenschaft". 14 Was sich spalten und sondern will, entgeht doch der "Gewalt einer inneren
Einheit" nicht; es ist Organ im Kosmos. Diese Einheit aber liegt im Wissenschaftlichen an sich, im wissenschaftlichen Geist; ihn zu bilden,, ist die wahre und eigentliche Aufgabe der Universität, insbesondere ihrer Philosophischen Fakultät. Verschieden sind die Talente, vielfältig ist das Sachwissen, gemeinsam aber der systematisch philosophische Geist. Von der Philosophie ist daher auszugehen; sie eröffnet den Blick auf Natur und Geschichte, wovon das Allgemeinste allen bekannt sein muss. Der Student beginne nicht mit Fachstudien, sondern mit weiter Umschau, er sei ein der Philosophie Beflissener; jeder Professor aber sei fähig und verpflichtet, in der Philosophischen Fakultät "von Zeit zu Zeit Vorträge aus dem reinen wissenschaftlichen Gebiete" 15 zu halten.
Das Beispiel der Berliner Universität stand keineswegs allein. Im frühen 19. Jahrhundert ist die moderne Form der Universität überhaupt entstanden. Diese vereinigte mit dem, was bisher ihren Namen getragen hatte, dasjenige, was ausserhalb der alten Universitätsorganisation und des Kanons ihrer Lehrgegenstände gewachsen war und unverbunden stand. Neben dem Carolinum, der hohen Schule Zürichs, hatten sich ein medizinisches und ein politisches Institut aufgetan; 1833 wurde aus dieser Dreiheit die Universität geformt. Sie sollte in neuer Umschreibung Universitas litterarum sein.
Wenn wir fragen, wie es denn damals möglich gewesen sei, die Gesamtheit der Wissenschaften in der Universität darzustellen, wissenschaftliche Gesamtbildung zwar kaum je zu erreichen, aber als ideales Ziel zu pflegen, besser als wir es jetzt zu tun vermögen, so sind zwei einst gegebene, heute verlorene Voraussetzungen zu nennen. Der Universität war die Aufgabe gestellt, zu lehren und zu erziehen; sie war dagegen noch kaum Forschungsstätte. Spezialforschung, so erklärte Schleiermacher, ist nicht Sache der Universitäten, sondern der Akademien. 16 Zum zweiten aber: die Universität war nur in beschränktem Masse Berufsschule, am wenigsten noch immer in ihrer Philosophischen Fakultät. Als sie beides wurde, werden musste, werden wollte, wurde erst die Spannung zwischen Spezialistentum und Universalbildung scharf und für den Bestand der Universitas litterarum kritisch.
Von hier aus ist es möglich, ohne dass wir den Verlauf durch das 19. Jahrhundert begleiten, die heutige Situation zu analysieren. Wir messen den Abstand, der unsere spezialisierte Organisation vom letzten Einheitstyp der Universität trennt; eine unvergleichlich intensive Entwicklung durch mehr als hundert Jahre hat uns auf einen andern Standort geführt. Wir wissen um eine Veränderung der Mentalität; das alte Bildungsideal verblasste, der Positivismus verharrte bei den Dingen, bei den Befunden, bei den Gesetzmässigkeiten des Physischen, — in Natur und Geisteswelt; es wäre wenig getan, wollten wir dies beklagen. Wir wissen andererseits, dass dieser Geistesrichtung immer wieder, und im 20. Jahrhundert vermehrt, die Neigung zum Meta-Physischen, Psychologischen, Religiösen entgegenwirkte,' die Sehnsucht nach philosophischer, ästhetischer, moralischer Bildung; es würde wenig erreicht, wollten wir uns nur eben dazu bekennen, durch einen Aufruf diese Richtung empfehlen. Es ist auszugehen von dem, was der Universität in der Gegenwart aufgetragen ist, was sie nicht nur als unabweisbare Pflicht übernahm, sondern selbst ergriff und entfaltete, und was heute ihren Wert und ihre Ehre ausmacht. Die Universität wurde, zum einen, hohe Schule, Stätte fachlicher Ausbildung für bestimmte wissenschaftliche Berufe. Es ist doch gegenwärtig so, und es wird in Zukunft so bleiben, dass der Student diese Ausrichtung und Ausbildung für einen Lebensberuf braucht, und dass der Gemeinschaft von Staat und Volk und Menschheit wissenschaftliche Fachleute unentbehrlich, sind. Freilich erhebt sich die Gefahr, dass die Ansprüche der Fach- und Berufsschulung Lehrer und Schüler der Universität absorbieren, und dass die Pflanzgärten der Fächer das freie Feld der akademischen Allmende durch Zäune und Hecken in Parzellen aufteilen. Das Unwiderrufliche geschah durch die Verselbständigung und gleichzeitige Verfächerung der Philosophischen Fakultät. Noch in der bernischen Akademie vor 1834 war sie "die untere Theologie" genannt worden, 17 hatte zur eigentlichen Theologie geleitet, während sie von Juristen und Medizinern bereits umgangen werden konnte. Sie hatte jahrhundertelang zwischen Gelehrtenschule und Universität gestanden. Jetzt wurde die allgemeine Bildung dem Gymnasium zugeschieden,
dieses selbst aber in der Folge durch Naturwissenschaften und moderne Sprachen zerlegt, so dass sein Bildungsziel nicht nur durch Talent- und Interessenrichtungen, sondern bereits durch Berufsabsichten beeinflusst wurde. Der Durchpass durch seine Maturitätsprüfung aber führte über eine deutlich markierte Schwelle; das Reifezeugnis galt als Freibrief für alle Fakultäten und wurde, immer entschlossener und unvermittelter, zum Fachstudium genutzt. Auch in der Philosophischen Fakultät; ihr grammatisch-philosophisch-historischer Organismus wurde zum bestenfalls friedlichen, wechselseitig anregenden Verein von Fächern, und zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften wurde selbst diese Wechselwirkung, über eine organisatorische Zweiteilung hinweg, selten und schwierig.
Aber die Berufsschule erhielt gleichzeitig ihr Fundament und ihre Weihe durch das Prinzip der forschenden Wissenschaft. Ihre Stätte wurde erst jetzt mit ganzem Ernst, fast mit Ausschliesslichkeit, die Universität. Damit ist jene Doppelbelastung durch Lehre und Forschung entstanden, die zunächst den Professor auszeichnet; er ist nach seinem Pflichtenheft — und wer wollte es hierin ändern? -— nicht nur Treuhänder und Vermittler des Wissensgutes, sondern dessen Förderer und Mehrer. Forschung aber verlangt Spezialisierung auf das Fach, innerhalb des Faches. Grossartig und beängstigend wuchsen die Wissenschaften in die Breite und in die Tiefe, vermehrte sich die Literatur, verfeinerten sich die Methoden, komplizierten sich die von unerhört leistungsfähig gewordener Technik bereitgestellten Apparaturen. Dies verlangt vom Forscher Konzentration — es ergreift aber auch den Studenten. Zu seinem Vorteil! Mit Recht sieht die Universitätspädagogik in der Forschung eines ihrer wichtigsten Erziehungsmittel, wo immer es sich darum handelt, nicht nur gelehrige Schüler zu unterrichten, sondern die wissenschaftlich erfüllte und disziplinierte Persönlichkeit zu bilden, die allen geistigen Berufen vonnöten ist, selbst wo die spätere Praxis keine eigentlichen Forschungsaufgaben stellen wird. Nach Fächern und Stufen und Begabungen verschieden wird der Student in die Forschung eingeführt, damit er erfahre, dass die Erkenntnis gesucht und wie sie gesucht werden müsse. Zu Vorlesungen und Lehrgespräch
ist, mit zunehmendem Gewicht, die Arbeit in Laboratorien und Seminarien getreten. Unvermeidlich ist damit auch der Student in gewissem Masse Spezialist geworden, und er spürt die Doppellast: zu lernen und zu schaffen.
Es ist nicht zu bestreiten, dass die Universität im 19. Jahrhundert und in der Jetztzeit für die wissenschaftliche Forschung und für die berufliche Schulung mehr geleistet hat und leistet als je zuvor. Dies wäre ohne die Spezialisierung unmöglich gewesen. Aber freilich, die Uebersicht ging verloren, die Universitas zersetzte sich.
Die Klage darüber ist längst erhoben worden; sie tönt heute lauter als je. Man wird kaum ein Heft einer studentischen Zeitschrift aufschlagen können, ohne dem Vorwurf zu begegnen, die Universität sei Fachschule geworden, ohne Gemeinschaft ihres lebendigen Körpers, ohne geistige Anteilnahme über Fächer und Fakultäten hinweg, ohne richtungweisendes Ethos, ohne innerlich befriedigenden Gehalt. Wir stimmen unsern Studenten darin, wenn auch in etwas anderer Tonart, zu: wir anerkennen den Vorwurf nur zum Teil, aber wir begrüssen das geistige Bedürfnis, das sich in ihm andeutet. Wie kann ihm Genüge geschehen? Wir können die Entwicklung nicht rückgängig machen, an den Anforderungen des modernen Lebens nicht vorbeisehen. Wenn der humanistische Professor des 16. Jahrhunderts nebenbei noch Medizin studierte, so war dies möglich weniger zufolge seiner überlegenen Kapazität als zufolge des ungemein primitiven Standes der Medizin; wenn der philologisch und theologisch Gelehrte früher zu jedem Lehramt geeignet schien und im Bildungsziel Naturwissenschaften, Muttersprache,. moderne Fremdsprachen kaum Platz fanden, so werden wir dies nicht zurückrufen, noch zurückwünschen können. Das Ideal des Polyhistors ist unzeitgemäss, eine umfassende Bildung von gleichmässigem wissenschaftlichem Tiefgang ist unmöglich geworden. Wer die Universität verlässt, soll in einem Berufsfach sicheren Stand haben. Dies bedingt Spezialausbildung. Es wird freilich zu bedenken sein, dass dafür ein vernünftiges Mass einzuhalten, oder, wo es überschritten wurde, wieder zu setzen ist; es gibt einen Intensitätsgrad spezialistischer Forschung, der im Universitätsunterricht nicht anwendbar ist. Aber die Anforderungen
bleiben, auch auf das Notwendige beschränkt, gross genug. Und nun soll darüber hinaus etwas erreicht, die Universitas litterarum zurückgewonnen werden. Die Forderung wird erhoben, aber der Einwand steht bereit, dass dazu die Zeit fehle.
Ich sehe zwei Wege, — gangbar, weil alle Wissenschaften unverlierbar einen Treffpunkt haben und einander nie völlig fremd und unverständlich werden können.
Der eine Weg ist ein Weg der Ausweitung, der Ausblicke; er soll vom eigenen Fach zu andern Fächern führen, zu jenem. edeln Dilettantismus, der demjenigen erlaubt und nötig ist, der an einer Stelle Fachmann ist. Dabei kommt es weniger auf Kenntnisse jenseits der Fachgrenzen an als auf das Wissen um Fragen, Methoden, Ergebnisse anderer Forschungsgebiete, so dass das Verständnis geöffnet, die Anteilnahme rege, das Gespräch möglich wird. Die allgemeine Bildungsschule des Gymnasiums gibt dafür die Ansätze; sie verkümmern jedoch häufig gerade in der Studienzeit, während sich später das. Bedauern über ihren Verlust regt. Der Student sollte sie durch die Jahre seines Spezialstudiums hindurchretten und entwickeln. Dies ist möglich; die Universität selbst bietet hiezu die Hand, — bei uns zum Beispiel seit zwanzig Jahren, bewusst, doch noch immer ohne genügende Gegenliebe, durch die Kulturhistorischen Vorlesungen. Es kann noch mehr getan werden; es braucht dazu nichts als Willen und Entschluss.
Der andere Weg ist ein Weg der Vertiefung, der Einblicke. Hier ist Schwierigeres zu leisten, hier wären auch gewisse Eingriffe in die heutige Ordnung des Universitätsbetriebes nötig. Die Ueberlegung aber ist einfach. Wahre Universalität wird nicht durch Summierung von Einzelwissen zustandegebracht; sie bildet sich vielmehr an den Stellen, wo immer Wissenschaft zum Wesen der Dinge vordringt und damit zum Allgemeinen und Gemeinsamen, zum Philosophischen gelangt. Von jeder Einzelwissenschaft aus ist dieser Punkt zu erreichen, ist die Teilhaberschaft an der Gesamterkenntnis zu gewinnen.
Vor Jahren erkundigte ich mich bei einem ausländischen
Freund von der naturwissenschaftlichen Fakultät, welches Problem
denn gegenwärtig im Zentrum seiner Wissenschaft, der
Astronomie, stehe. Wir sind heute so weit, antwortete er, dass wir fragen: was ist ein Stern? Dies erscheint primitiv; es ist im Grunde die wesentlichste Frage, die sich stellen lässt. Entsprechend wird der Linguist dazu kommen, nach dem Wesen der Sprache zu fragen, der Historiker nach dem Wesen des Staates, nach den Bedingungen der Politik, der Biologe nach den Geheimnissen des Lebens, der Jurist nach der Kraft des Rechtes und so weiter. Das Ringen um Antworten auf diese Fragen aber ist gemeinsames Anliegen aller, die überhaupt dem wissenschaftlichen Geiste verpflichtet sind. Insofern wir daran beteiligt sind, bilden wir uns eine Weltansicht; hier stehen die Haltepunkte der Gesinnung, die die beängstigend gesteigerte Technik zum Segen statt zum Fluche wenden kann, hier liegen die Wurzeln wahrer Universalität und Humanität. Daran sollen Professoren und Studenten als Glieder der Universitas litterarum Anteil haben.
Es scheint mir, dass diese Aufgabe noch nicht mit vollem Bewusstsein ergriffen worden und in der heutigen Universität noch nicht befriedigend lösbar sei. Wir anerkennen, dass die Spezialisierung der alten Universität nötig und fruchtbar gewesen ist. Die Organisation ist ihr angepasst worden. Aber das Nötige und Nützliche kann dem wahren Leben der Universität nicht genügen; die Organisation kann hemmend wirken, namentlich an den Punkten, wo Mechanisierung und Bürokratisierung sie versteifen. Es fehlt der Universität ein Oberbau; wir möchten ihn, gestatten Sie die Vision, in Zukunft entstehen sehen.
Das geistige Leben folgt eigenen Gesetzen; die Universität
kann sich nie restlos in allgemeine Regeln fügen. Sie steht in
innigem Verhältnis zum Staat, ein Lieblingskind, ein Sorgenkind;
sie ist ihm tief verpflichtet, ihm, dem Volk, den Völkern.
Aber sie kann nicht blosse Staatsanstalt sein; sie ist schwer zu
verwalten; denn aus der Ausnahme von der Regel schöpft sie
beste Kraft, aus dem Sonderfall, vom singulären Menschen.
Wenn ich an jenen Oberbau, den Thronsaal reiner Wissenschaft
denke: ist es nicht ein Verlust, dass die Universität der Weisheit
der Siebzigjährigen beraubt wird? Für Fakultäts- und Institutsverwaltung,
für Schulungspflicht und Prüfungsrecht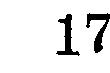
gibt es, mit gutem Sinn, eine Altersgrenze, für die geistigen Werte nicht. Sie sollten, in geeigneter Form, zurückgewonnen werden. Und es gibt, wie ich glaube, noch eine andere "Altersgrenze" in der akademischen Laufbahn. Sie liegt dort; wo der Gelehrte, der die Fünfzig überschritten hat, auf Grund jahrzehntelanger Erfahrung das Bedürfnis und die Fähigkeit empfindet, sich eben jenen tiefen und allgemeinen Fragen zuzuwenden. Er ist ein anderer geworden; es wird, wenn man das Beste von ihm erwartet, unzweckmässig, ihn im unveränderten Pflichtenkreis festzuhalten. Hier ist der Punkt, wo der Nachwuchs einrücken soll, mit dem Vorteil jugendlicher Frische für Unterricht und Forschung, als Entlastung für diejenigen, deren Metamorphose eine neue Leistung verheisst, im Kontakt noch immer mit allen Aufgaben der Universität, aber mit neuen und anderen Vorlesungsheften und demjenigen näher, was die Universitas litterarum in ihrer die Fächer überwölbenden Kuppel ausmacht.
Wenn wir das ideale Ziel einer neuen Universitas litterarum
ins Auge fassen, so stellen wir ihren Träger, die Universität,
mitten in das fortschreitende, zukunftsvolle Leben unseres
Volkes und seines Staates ein. Und wohl uns, dass unser schweizerischer
Staatsgedanke seine Erfüllung darin suchen darf, ein
freier und menschlicher, ein universaler Gedanke zu sein!