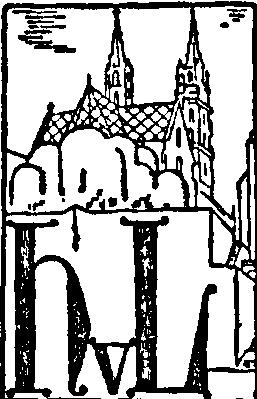GEDANKEN ÜBER ERNÄHRUNG UND WACHSTUM
Rektoratsrede
von
Verlag Helbing &Lichtenhahn —Basel 1951
Druck von Friedrich Reinhardt AG., BaselHochansehnliche Versammlung!
Das 19. Jahrhundert ist in bezug auf die Naturwissenschaften als das Jahrhundert der Theorien bezeichnet worden. Die merkwürdige Ordnung und Regulation in der Welt hat man in Gesetzen, in Konstanten zum Ausdruck gebracht. Es war sehr naheliegend und in manchen Fällen wohl auch richtig, daß der Biologe und der Mediziner die großen Wunder des Lebens, die merkwürdige Ordnung des Organismus, trotz der darin stetigen Aufnahme und Abgabe der verschiedensten Stoffe durch ähnliche Gesetze und Konstanten zu erklären versuchte. Man hat Regulatoren gefunden in Form von Zentren: Atmungszentrum, Schlafzentrum. Man spricht von Konstanten des Blutzuckers, des Blutdruckes, der Zahl der roten Blutkörperchen, von Gesetzen des Wachstums, des Energieverbrauches usw. und nimmt an, daß diese Konstanten und diese Gesetze gewissen Regulationszentren (Temperaturzentrum, Blutzuckerzentrum, Blutdruckregler) und Substanzen, sog. Hormonen, zu verdanken sind. Die meisten Autoren nehmen Wachstumshormone an, die den Körper derart gesetzmäßig beeinflussen sollen, daß der Wachstumsvorgang in einer mathematischen Formel ausgedrückt werden könne.
Die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war hingegen eher eine Zeit der Beobachtungen. Die Resultate
der beiden Richtungen, der Theorien und der Beobachtungen, stimmen aber bei weitem nicht überein. Die neuesten Erfahrungen der Physik und der Chemie haben ungeahnte Perspektiven eröffnet, die noch nicht genügend und vielleicht nicht immer richtig auf die Biologie und die Medizin übertragen werden.
In der Physik haben wir seit der Quantentheorie von Planck, der Wellenmechanik von de Broglie und den Untersuchungen von Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Fermi u. a. neben der klassischen Physik eine Mikrophysik, die eine besondere Wissenschaft geworden ist.
Seit zirka dreißig Jahren gibt es eine makromolekulare Chemie, die gewisse biologische Anschauungen umzuwälzen vermag. Schon im Jahre 1918 haben Willstaetter und Stoll, später Maquenne ein molekulares und ein makromolekulares oder kolloldales Chlorophyll unterschieden. Einzig das makromolekulare Chlorophyll vermag die Assimilationsarbeit des Blattes zu vollziehen. Moureu hat um dieselbe Zeit in seinen Arbeiten über die "Antioxygènes" und die "Prooxygènes" die (notion) Hypothese über die besonders activierten Molekel aufgestellt. Die Chemiker kennen jetzt Proteinmolekel mit Millionen von Atomen. Es existiert nicht mehr ein Molekulargewicht, sondern ein chemisches und ein physikalisches Molekulargewicht.
Die Vorgänge im lebenden Körper folgen den Gesetzen der Chemie und der Physik. Aber Chemie und Physik machen noch kein Leben aus. Das Wesen des Lebenden ist eine besondere Art von Bewegung, eine spontane (movens se ipsum der Antike), zielstrebige, zielgerichtete, richtunggebende, wobei damit — was Bertalanffy mit Recht betont — nicht eine bewußt zielstrebige Bewegung gemeint ist. Diesen Gedanken habe ich 1935 zu erläutern
versucht, und der Basler Gelehrte Gustav Wolff hat 1932 geschrieben: "Das Leben ist durch Zielursächlichkeit charakterisiert." Eine reizvolle Aufgabe ist es, die Wechselbeziehungen zwischen Medizin und Physik sowie zwischen Medizin und Chemie in einigen Punkten zu prüfen.
An Beispielen aus den Gebieten der Ernährung und des Wachstums möchte ich versuchen, dieselben zu erläutern.
Gehen wir von einem einfachen Beispiel aus (die folgenden Daten entnehme ich z. T. einer Arbeit von Tangl): Ein Hühnerei wiegt ohne Eischale rund 54 g. Nach der Bebrütung wiegt es noch 41 g. In den 21 Tagen der Bebrütung sind also 13 g verlorengegangen. Der Gewichtsverlust ist durch einen Verlust von 11 g Wasser und 2 g Trockensubstanz bedingt. Ein Hühnerei enthält rund 87 Kalorien. Nach der Bebrütung finden wir im
lebenden Kücken 38 Kalorien im zurückbleibenden Dotter 26 Kalorien 64 Kalorien
In den 21 Tagen der Bebrütung sind 23 Kalorien verlorengegangen. Nun sind zum Verdampfen von 11 g Wasser durch die Schale hindurch mindestens 6 Kalorien notwendig. Dazu kommt, daß das bebrütete Ei stets eine um 0,1 bis 0,2° C höhere Temperatur als seine Umgebung aufweist. Ist der Brutofen auf 380 C eingestellt, so ist die Innentemperatur des Eies zirka 38,20 C, zeigt der Brutofen 39°C, so hät das Ei 39,2°C. Sind die Temperaturen viel niedriger oder höher, so stirbt das Ei. Zum Aufrechterhalten der Temperaturdifferenz von innen nach außen von 0,1 bis 0,2°C während 21 Tagen stehen 17 Kalorien zur Verfügung. Das ist alles, was wir aus der Thermodynamik über die Vorgänge während dieser 21 Tage entnehmen
können. In dieser Zeit hat ein intensives Wachstum stattgefunden. Aus dem Embryo ist ein Kücken mit schlagendem Herzen, Eingeweiden, Haut und Federn entstanden, das die Eischale durchbrechen und hüpfen kann.
Diese Zahlen lehren uns folgendes:
1. Damit aus dem Ei ein Kücken wird, muß die Temperatur des Eies eine gewisse Höhe haben; ihre aktiven Schwankungen innerhalb bestimmter Grenzen hängen von der Außentemperatur ab. Man könnte hier ebensogut von einer Konstante sprechen, wie man es beim Warmblüter und beim Menschen tut. Wie kommt diese Konstante zustande?
2. Die 23 Kalorien, die von Tangl, m E. zu Unrecht, als "Entwicklungsarbeit" zur Entwicklung eines reifen Kückens während der Bebrütungszeit von 21 Tagen bezeichnet werden, dienen der Wasserverdampfung und der Aufrechterhaltung der Temperaturdifferenz zwischen Ei und Umwelt. Die Zellvermehrung, d. h. die Teilung einer Zelle in zwei Tochterzellen, geht immer mit einer minimalen Wärmeabgabe einher.
3. Für die Verarbeitung eines Teiles der Eisubstanz zum Kücken bleibt praktisch keine Kalorie übrig. Über die wunderbaren Vorgänge, die dabei stattfinden müssen, gibt uns die Thermodynamik keine Antwort, sondern, wie mir scheint, nur unbedeutende Anhaltspunkte.
4. Die Natur stellt dem Embryo einen großen Überschuß an Nahrung zur Verfügung. 1/4 bis 1/3 der ursprünglichen Menge bleiben zur Zeit des Ausschlüpfens noch übrig. Es gehen allerdings nicht nur 11 g Wasser verloren, sondern es werden während der Bebrütungszeit noch ca. 6 g CO2 produziert, die das Ei durch die Eischale verlassen. Es wird Sauerstoff aufgenommen, es findet eine Atmung mit vorwiegendem Verbrauch des Eifettes statt.
Das ganze Eiweiß, d. h. die N-haltige Substanz ist in toto im Ei geblieben.
Gestatten Sie mir, diesen auffallenden Tatsachen folgende Überlegungen anzuschließen:
1. Die Körpertemperatur
Der Mensch besitzt das Empfindungsvermögen für kalt und warm. Diese Qualitäten unserer Umwelt, die durch Selbstbeobachtung gewonnen werden, hat die Physik für sich in Anspruch genommen, sie hat sie analysiert und eine Eigenschaft derselben als Temperatur bezeichnet. Rückwirkend auf die Medizin haben dann Biologen und Mediziner einen Temperatursinn angenommen, und manche sind der Ansicht, daß wir in unserem Körper eine Art Thermometer besitzen. Dies ist zweifellos nicht der Fall. Schon die Tatsache, daß wir für die Empfindung Kälte andere Nervenendungen besitzen als für die Empfindung Wärme, spricht dagegen. Die Empfindungen kalt und warm gehen übrigens mit dem Sinken und Steigen eines Thermometers in keiner Weise parallel. Wenn ich ein Holzstück, das eine Temperatur von 20°C aufweist, berühre, so habe ich eine Empfindung der Wärme. Einen Eisenstab mit der gleichen Temperatur empfinde ich als kalt. Stehe ich mitten in einem Raume, dessen Wände ca. 0°haben, aber mit einer unmittelbaren Temperatur um meinen Körper von 18-20°C, so habe ich die Empfindung von Kälte. Ist das Verhältnis umgekehrt, haben die Wände des Raumes 18° C und ist meine unmittelbare Umgebungstemperatur ca. 0°C, so habe ich eher ein Gefühl der Wärme.
Bekanntlich unterscheidet man zwischen Warm- und Kaltblütern. Diese Unterscheidung ist keine scharf abgegrenzte. Dafür gibt Russel Beispiele. Gewisse Fledermäuse zeigen im Schlaf eine der Außentemperatur angenäherte
Temperatur. Werden sie geweckt, so kann sich die Fledermaus durch Zittern und rhythmische Bewegung der Beine im Laufe von einer halben Stunde von 20° auf 39°C erwärmen. Die Körpertemperatur ist hier eine Folge der Muskeltätigkeit.
Bei den höheren Säugetieren, den Warmblütern schwankt die Körpertemperatur innerhalb geringer Grenzen: es tritt normalerweise ein Gleichgewichtszustand zwischen Wärmeproduktion und Wärmeverlust ein.
Das Tier verfügt über die verschiedensten physikalischen Mittel, um seine Körperwärme zu erhalten. Das Haarkleid wird dicker (die Giraffen Hagenbecks in Hamburg hatten am Ende des Winters einen Haarwuchs, der zweieinhalbmal länger war als der normale), ebenfalls das Fettpolster. Es treten zahlreiche physiologische Reaktionen auf: Durchblutung der Haut, Ausdünstung durch Haut und Lunge, Aufrichtung der Haare, Muskelzittern. Außerdem reagiert das Tier triebartig, bzw. instinktiv auf die Außentemperatur. Der frierende Hund legt sich vor den Ofen. Ratten verhalten sich beim Nestbau der Außentemperatur entsprechend: in kalter Umgebung werden die Nester fester und dichter gebaut (Russel).
Der Mensch verhält sich nicht anders. Er trägt wärmere Kleider, heizt sein Zimmer. Genügt das nicht, so tritt Muskelzittern ein, das eine gewaltige Wärmequelle darstellen kann. Rubner und andere nehmen eine chemische Wärmeregulation an.
Nach Versuchen aus der schwedischen Schule (Tigerstedt und Johannson) und nach eigenen Beobachtungen ist beim Menschen eine chemische Wärmeregulation zum mindesten nicht bewiesen und existiert ziemlich sicher nicht. Die Versuche Eykmans an Tropenbewohnern sprechen ebenfalls im gleichen Sinne. Das Muskelzittern in
der Kälte ist keine chemische Wärmeregulation. Beim Tier ist das Muskelzittern oft schwer zu kontrollieren. Daß durch Reizung gewisser Hirnpartien 1, z. B. Schädigung des Zwischenhirns, eine Steigerung der Körpertemperatur erzeugt werden kann, beweist m. E. keineswegs, daß ein Wärme- oder Kältezentrum vorhanden sein muß. Auch ein großhirnloser Hund kann Temperatursteigerungen aufweisen. Alle Lebewesen sind zum Leben auf eine gewisse Temperaturbreite angewiesen; es ist beim Tier wie beim bebrüteten Ei: ist die Außentemperatur zu hoch oder zu niedrig, so hört das Leben auf.
2. Kalorienproduktion und Lebensmittel
Die thermodynamischen Vorgänge sind beim Menschen, beim höheren Tier, wie auch bei niedrigen Lebewesen ebenso wenig entscheidend wie beim Embryo des Huhnes. So wird z. B. eine Konstanz des sog. Grundumsatzes angenommen, d.h. eine Konstanz der Kalorienproduktion beim gesunden Menschen im nüchternen Zustand, bei vorsätzlicher Muskelruhe und bei einer bestimmten Außentemperatur. Bekanntlich wird diese Kalorienproduktion nicht unmittelbar, sondern aus dem Gaswechsel, der 02-Aufnahme und der CO2-Produktion, berechnet. Diese Methode ist für klinische Zwecke zwar brauchbar, sie trifft aber nur annähernd und unter gewissen
Bedingungen zu. Gesunde Zwergmenschen, z. B. die Pygmaeen, die Bambutti, weisen denselben Grundumsatz auf wie Neger der üblichen Körpergröße. Dies würde bei einem normalen Menschen der weißen Rasse einer Grundumsatzsteigerung von minimum + 50% entsprechen (Bouckaert). Hier versagt also jeder Vergleich der Berechnungen nach Körpermaßen (Gewicht, Größe, Oberfläche).
Die Erfahrung zeigt ferner, daß ein Mensch z. B. bei einer Einnahme von 2000 Kalorien in der Kost an Gewicht zunimmt, während ein anderer, der die gleichen körperlichen Leistungen verrichtet, bei einer Aufnahme von 4000 Kalorien abnimmt. Die Fettsucht ist in der Hauptsache keine Überfütterungsfrage. Die Überfütterung bedingt nach Jahren die Erkrankung eines Organes oder Organsystems, z. B. des Kreislaufs. Diese Erkrankung ist die unmittelbare Ursache der Fettsucht oder, was ja auch vorkommt, einer Magersucht. Die Fettsucht wie auch die Magersucht können wir als zweite Krankheit bezeichnen.
Füttert man z. B. ein Kaninchen mit gewöhnlichem Futter und zwingt das Tier außerdem täglich 40 g Traubenzucker einzunehmen, so nimmt das Tier in den ersten Wochen ein wenig an Gewicht zu, um später abzunehmen. Das Kaninchen geht dann nach 2-4 Monaten unter starker Abmagerung zugrunde. In der Leber des Tieres ist keine Spur Glykogen zu finden. Ein Kaninchen lebt ca. 6 Jahre. Bei einer abnorm. zuckerreichen Kost sind 2 bis 3 Monate nötig, um Krankheitserscheinungen zu erzeugen. Beim Hunde gelang es bei einer ähnlichen Überfütterung mit Traubenzucker während 8 Monaten nicht, krankhafte Erscheinungen zu erzeugen, bei der Ziege sind 3 bis 4 Monate nötig. Der Mensch lebt im Durchschnitt heutzutage beinahe 70 Jahre. Wendet man einen ähnlichen Maßstab wie beim Tier an, so darf man
annehmen, daß eine abnorm zusammengestellte Kost erst nach Jahren bis Jahrzehnten zu deutlich krankhaften Erscheinungen zu führen braucht.
Die Bedeutung des Gaswechsels geht aus folgenden Zahlen hervor. Der Basler Arbeiter verbrauchte 1914 nach eigenen Untersuchungen pro Tag ca. 90-100 g Eiweiß, ca. 90 g Fett und 450 g Kohlehydrate. Der Sauerstoffverbrauch beträgt ca. 500 g, ist also gewichtsmäßig und physiologisch der wichtigste Nahrungsstoff. Die CO2-Produktion ist ebenfalls sehr hoch, ca. 400 g pro Tag.
Es ergibt sich nun, daß z. B. bei einer Steigerung der Zufuhr von Nahrungsstoffen im Verhältnis von 1:2:3:4 (Multipla von 50 g) die Steigerung des Gaswechsels, und somit auch jene der Kalorienproduktion, nicht nach demselben Verhältnis verlaufen; bei Eiweißzufuhr z. B. ist es ungefähr 1:3:9, bei Zucker steigt der Gaswechsel bei Dosen über 150 g Dextrose überhaupt nicht weiter.
Auch bei der gleichen Nahrungszufuhr kann beim gleichen Individuum je nach dem Ernährungszustand die Gaswechselwirkung verschieden sein; 10 bis 12 Stunden nach einer Mahlzeit z. B. verursacht die Einnahme von 50 g Traubenzucker eine Steigerung der CO2-Ausscheidung. Dieselbe bleibt aber aus, wenn die Versuchsperson vorher 2 bis 3 Tage gefastet hat. Ich konnte auch vor Jahren den Nachweis erbringen, daß ein im Dunkeln gehaltenes Tier sein Futter anders verarbeitet als ein Tier, das dem Tageslicht ausgesetzt ist. Schließlich sei noch daran erinnert, daß bei bestimmten Krankheiten, bei Diabetes mellitus z. B., die Einnahme gewisser Nahrungsmittel nicht dieselben Veränderungen des Gaswechsels erzeugt wie bei gesunden, nüchternen Menschen. Wenn ich noch erwähne, daß die verschiedenen Kohlehydrate verschiedene Veränderungen des Gaswechsels bewirken,
50 g Traubenzucker z. B. verursachen unter gleichen Bedingungen eine bedeutend kleinere CO2-Produktion als 50 g Fruchtzucker, und daß ferner der gleiche Mensch dieselbe Muskelarbeit bei sehr verschiedenem Gaswechsel und bei verschiedener Kalorienproduktion leisten kann, so ersieht man, wie wenig brauchbar die Kalorienberechnung allein für die Ergründung der physiologischen und pathologischen Vorgänge ist.
Die unterschiedliche Wirkung der verschiedenen Kohlehydrate kommt auch in der Immunochemie in der Form einer biologischen Spezifität zur Geltung. Ich erinnere nur an die bekannten Untersuchungen Tomcsiks über die Polysaccharide bei Bakterien und ihre Bedeutung z. B. für die Anaphylaxie. Der rein bausteinmäßig begründete Wert der Kohlehydrate wie der Eiweißstoffe erschöpft die biologische Charakteristik dieser Substanzen keineswegs. Der Zustand und der Aufbau polymer homologer, makromolekularer Verbindungen üben zweifellos einen noch ungeahnten Einfluß aus.
Unsere Körpertemperatur beträgt ca. 37°C. Eine Thermalquelle, welche mehrere tausend Liter von 45°C pro Stunde liefert, stellt eine intensive Wärmequelle dar. Mit diesen vielen Kalorien ist man jedoch nicht imstande, ein Ei zum Gerinnen zu bringen. Die sehr große Zahl Kalorien bei 45° können einige Kalorien bei 100° C nicht ersetzen.
Wenn auch für das lebende Wesen der erste Hauptsatz der Thermodynamik, das Prinzip der Erhaltung der Energie, zutrifft, so ist es nicht bewiesen, daß der zweite Hauptsatz beim Tier in der gleichen Intensität zur Geltung kommt wie in der unbelebten Natur. Dem zweiten Hauptsatz entspricht der Tierorganismus insofern, als er kein perpetuum mobile darstellt. Eine thermodynamische Maschine ist er aber ganz sicher nicht.
Richtiger scheint mir, was der französische Astronom Brunhes vor 30 Jahren behauptete, daß das Tier die "Dégradation" der Energie in der Welt wesentlich verlangsame. Die Behauptung Schrödingers, der lebende Organismus erhöhe ununterbrochen seine Entropie (durch Essen, Trinken, Atmen) und strebe darnach, sich dem gefährlichen Zustand der maximalen Entropie, der den Tod bedeute, anzunähern, halte ich nicht für richtig. Der Tod ist doch nicht die Folge der Tätigkeit des Lebens, sondern des Versagens der Vorgänge, die das Leben erhalten. Viel besser und ähnlich wie Brunhes äußert sich Pigorine. Das lebende Tier ist ein offenes, irreversibles System, das die Tendenz hat, das Minimum an Entropie zu gebrauchen. Lehnen wir für das lebende Wesen die Deutung als thermodynamische Maschine ab, so erscheint uns auch sehr fraglich, ob atomare Kräfte in Frage kommen. Die Folgerungen, die Pascual Jordan aus seinen interessanten Experimenten über die Bedeutung eines Lichtquants für das Leben eines Bazillus bzw. eines einzelligen Wesens zieht, finde ich viel zu weitgehend. Die Spontaneität des Lebens äußert sich in den verschiedensten Formen; alle unterscheiden sich von der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation.
Wir sehen also, daß die bloße Berücksichtigung des chemischen Problemes der Ernährung, z. B. des Gaswechsels nach Nahrungsaufnahme, wichtigere Resultate zu liefern vermag, als thermodynamische Berechnungen. Ich möchte hier noch zwei Tatsachen erwähnen, die in der Literatur bisher kaum berücksichtigt wurden.
Werden Zucker und Eiweiß im Nüchternzustand gleichzeitig aufgenommen, so bekommt man eine Steigerung der Kohlensäureausscheidung, die genau die Addition derjenigen CO2-Mengen darstellt, welche nach Zucker allein
und nach Eiweiß allein gefunden werden. Die Verarbeitung des Nahrungseiweißes wird von einer gleichzeitigen Darreichung von Zucker inbezug auf den Gaswechsel nicht beeinflußt.
Die zweite Tatsache ist die, daß die Nahrung nicht unmittelbar für eine besondere Tätigkeit des Organismus, z. B. für die Muskelarbeit, verbraucht wird. Werden z. B. 50 g Traubenzucker eingenommen, so findet eine Steigerung der CO2-Ausscheidung um 7 g statt, wird bei einer bestimmten Muskeltätigkeit ein Plus von z. B. 10 g CO2 erzeugt, so erhalte ich bei dem kombinierten Versuch: Einnahme von 50 g Traubenzucker + Muskelarbeit eine Steigerung der CO2-Produktion, die genau die Addition der beiden Werte darstellt, nämlich 17 g.
Die Kalorienzufuhr durch die Nahrung, z.B. durch Zucker bei einer Sportübung, ist also für die gerade zu leistende Muskeltätigkeit gar nicht brauchbar, und die günstige Wirkung des Zuckers ist, wie später dargelegt wird, anders zu erklären.
Der üblichen Formel, der Mensch genieße Eiweiß, Fett und Kohlehydrate, um soundso viele Kalorien zur Verfügung zu haben, möchte ich z. B. folgende fiktive Formel parallel setzen: die Luft bestehe aus Sauerstoff, Stickstoff und Kohlensäure, damit sie uns blau erscheine. Beide Formeln sind falsch.
Diese Berechnungsart versagt auch bei niederen Lebewesen. Goetsch hat in der Torulahefe ein neues Vitamin entdeckt, den T-Vitamin-Komplex oder das Supravitamin, einen Stoff, der die Grundform der Lebewesen determinieren soll. Nun vermag bei Wirbeltieren, z. B. bei der Maus, Vitamin T, dieser "Großmodifikator", eine Gewichtszunahme von 10-20 % hervorzurufen; eigenartig ist, daß dieser Erfolg nicht nur bei normalem Futter,
sondern auch bei wenig oder geringwertigem Futter erzielt wird. Auch die Darreichung von Vitamin T an das Muttertier während der Schwangerschaft bewirkt, daß sich die Jungen besonders kräftig entwickeln. Solche Junge erreichen z. B. das Gewicht von ca. 14 g nicht erst am 40. Lebenstag, sondern 5 oder sogar 10 Tage früher.
Die Kalorie stellt eine Maßeinheit dar. Die Kalorie existiert nicht: ihre Existenz annehmen, heißt einen mathematischen Mythos anerkennen.
Das optimale Gedeihen des Körpers, die Lebenstüchtigkeit, ist nicht durch eine energetisch ausreichende Zufuhr von Nahrungsmitteln sichergestellt. Wichtiger als der Begriff Nährstoff scheint der Begriff Wirkstoff zu sein. Das Leben bedarf einer Anzahl bestimmter Stoffe z. T. in größerer, oft aber auch in kleinster Konzentration.
Der Wert eines Lebensmittels kann weder vom Standpunkt der Kalorienproduktion noch von demjenigen der analytischen Zusammensetzung aus erfaßt werden. Es stehen zwar einige neue Forschungsmethoden zur Verfügung.
Der Forscher muß, um die Wirkungsweise des Lebens zu erkennen, zum überschaubaren Modellversuch greifen. Eines der gewaltigsten Werkzeuge der Natur für ihre unheimlichen chemischen Leistungen ist die Bildung von Fermenten. Die Isolierung der Fermente hat uns schon im Modellversuch der Beantwortung der wichtigsten Fragen nähergebracht. Ich denke nur an das Atmungsferment, an die Cocarboxylase u. a. Die Wirkung der Cocarboxylase auf die Brenztraubensäure ist durch Markees kürzlich studiert worden. Andere Modellversuche sind diejenigen mit Gewebebreien, mit "überlebenden" Organen, mit Kleinlebewesen, wobei die Übertragung der Resultate auf den Menschen allerdings nur mit Vorsicht geschehen darf. In den letzten Jahren sind durch Modellversuche mit
durch Isotope gekennzeichneten Stoffen wertvolle Erkenntnisse gewonnen worden. Ich erinnere nur an die von Bernhard und Mitarbeitern erhaltenen Ergebnisse über die Verarbeitung der Fettsäuren im Organismus. Die Isotopentechnik hat uns gelehrt, daß die aktivierte Essigsäure "gewissermaßen im Verkehrsknotenpunkt von Fett-, Eiweiß- und Kohlehydratumsatz steht" (Täufel).
Unsere Lebensmittel sind in ihrer großen Mehrzahl lebendige Einheiten aus der Pflanzen- oder Tierwelt. Durch die neuen Modellversuche haben wir einfache Zwischenprodukte des Stoffwechsels kennengelernt, die eine große Reaktionsbereitschaft besitzen. Die Lebensmittelchemie zeigt uns die weitere große Reaktionsbereitschaft vieler Nahrungsstoffe nach ihrer Trennung von der Muttersubstanz. Der Kampf der Industrie gegen das Verderben der Fette ist kürzlich in einer Sitzung der Schweiz. Akademie der Medizinischen Wissenschaften zur Sprache gebracht worden. Wahrscheinlich lassen sich hier durch die Verwendung von sog. natürlichen Fett-Antioxydantien oder durch den Gebrauch von Antibiotika Erfolge erzielen.
Kultur der Pflanzen und Züchtung der Nutztiere dürfen nicht einseitig auf die Steigerung des Ertrages ausgerichtet sein, sondern es ist insbesondere der Qualität, dem ernährungsphysiologischen Nutzeffekt gebührende Aufmerksamkeit zu schenken (Täufel).
3. Regulation des Blutdrucks und des Blutzuckers und von Stoffwechselvorgängen
Ich habe oben erwähnt, daß der Grundumsatz unter gewissen Bedingungen eine relativ konstante, brauchbare Größe darstellt. Ungefähr dasselbe ist beim Blutdruck der Fall. Wir wissen ja, daß der Körper sog.
Blutdruckregler besitzt. Nun ist es so, daß der Blutdruck nie genau auf einem bestimmten Niveau gehalten wird, sondern er pendelt um ein mittleres Niveau hin und her. Nach Wagner kommt die Erhaltung des mittleren Blutdruckes durch ein fortgesetztes Balancieren zustande und "spielt sich ähnlich ab, als ob wir etwa einen Stock aufrecht auf einem Finger stehend in Balance halten wollten. Damit das labile Gleichgewicht aufrechterhalten werden kann, der Stock auf dem Finger stehenbleibt und nicht umfällt, muß man bekanntlich fortwährend Korrekturbewegungen machen und bestrebt sein, immer wieder den Unterstützungspunkt unter den Schwerpunkt zu schieben". Eine solche Balance, schreibt Wagner, spielt sich beim Blutdruck von der Geburt bis zum Tode ab.
Ich zweifle sehr daran, daß dies die richtige Deutung des Phänomens sein kann. Das Leben ist Bewegung und niemals stationärer, wenn auch scheinbar oszillierender Zustand. Richtiger scheint mir folgender Gedanke: Die primäre Richtung des Blutdruckes ist stets die einer Steigerung desselben. Beim gesunden Menschen steigt der Blutdruck nicht über eine gewisse Höhe, weil in jedem Augenblick eine Bremsvorrichtung besteht, die aktiv einwirkt. Unter nicht normalen Bedingungen kann der Blutdruck ein stark erhöhtes Niveau erreichen, z. B. 200 mm Hg systol. Druck statt 130 mm Hg, und oft jahrelang mit kleinen Schwankungen auf dieser Höhe bleiben, ohne daß schwere krankhafte Erscheinungen auftreten müssen. Diese Erklärung entspricht dem Wesen, dem zielgerichteten Verhalten des Lebens besser als die Annahme eines oszillierenden Zustandes um einen konstanten Wert.
Etwas komplizierter ist das Verhalten beim Blutzucker. Der Blutzuckerwert, der beim nüchternen Menschen um 0,1 % oszilliert, wird sowohl durch Nahrungsaufnahme,
namentlich Traubenzucker, beeinflußt als auch durch die Tätigkeit des Organismus. Die Bestimmung des Blutzuckers ist relativ einfach, daher ihre weite Verbreitung. Man darf aber nicht glauben, daß der eingeführte Traubenzucker in toto via Blutzucker in den sog. endogenen Stoffwechsel, bzw. in die Depots gelangt.
Die Müdigkeit und gewisse Kollapserscheinungen werden auf ein Blutzuckerdefizit, eine Hypoglykämie zurückgeführt, und nach Ansicht vieler Autoren ist die Quelle der Müdigkeit in den Muskeln lokalisiert. Wenn man aber bedenkt, wie klein die Menge Blutzucker ist (0,1 % in 4 bis 6 Liter Blut) und die Menge Glykogen (in der Leber ca. 200 g) im Vergleich zu dem Verbrauch an Kohlehydraten (400-500 g täglich), so dürfte man wohl an der Richtigkeit dieser Annahme zweifeln. Wir haben ja beim Ei gesehen, wie reichlich die Natur für notwendige Vorräte sorgt, wenn sie wirklich Vorräte anlegen will. Man denke z.B. an die Fettvorräte. Der Glykogenvorrat wäre in wenigen Stunden verbraucht, wenn er der Muskelarbeit dienen sollte. M. E. ist der Glykogenvorrat in der Leber in erster Linie, wenn nicht ausschließlich, für die Tätigkeit des Gehirns vorhanden; in diesem Falle entspricht er dann auch mengenmäßig einem richtigen Vorrat. Die Ermüdung ist beim Menschen m.E. ein Gehirnsymptom und nicht ein Muskelsymptom. Man bedenke z. B., daß beim Augenzittern (Nystagmus) die betreffenden Muskeln stundenlang 300-400 Zuckungen in der Minute ohne Ermüdungserscheinungen leisten können. Wie beim Blutdruck möchte ich auch hier vermuten, daß beim Gesunden die primäre Tendenz des Organismus stets eine Steigerung des Blutzuckers darstellt. Dieselbe wird wie beim Blutdruck durch Bremsvorrichtungen ausgeglichen.
Ich glaube aber, daß weder beim Blutdruck noch beim Blutzucker die Annahme von Konstanten den Tatsachen entspricht. Le Roy hat seinerzeit geschrieben: "Le physicien veut des constantes, c'est parce qu'il en veut, qu'il en trouve, grâce à une violence ingénieuse qu'il fait subir à la nature." In der Biologie ist dieser Satz noch viel richtiger.
In bezug auf den Blutzucker dürften wir noch eine weitere Bemerkung machen. Der Blutzucker kann nur im toten Blut bestimmt werden. Und wenn wir die neuen Errungenschaften der makromolekularen Chemie berücksichtigen, so ist es m. E. sicher, daß der Traubenzucker nicht isoliert als reines Molekel in unserem Blute kreist, sondern nur makromolekular und wahrscheinlich an andere Stoffe mehr oder weniger locker gebunden. 1
Diese Annahme der naturgegebenen Steigerung des Blutzuckerspiegels im Organismus spricht gegen das Vorhandensein eines Zuckerzentrums oder eines Zentrums irgendeiner chemischen Einheit wie Wasser oder Kochsalz. In diesem Sinne gibt es keine Stoffwechselzentren. Die neuen Errungenschaften der makromolekularen Chemie bestätigen diese Auffassung.
Zentren in unserm Zentralnervensystem kann es m. E. nur für biologische, nicht für biochemische Zwecke geben. Es gibt mit Sicherheit Atmungszentren, wobei ich den Plural betonen möchte; es gibt auch z. B. Hunger- und Durstzentren; hier ist zu bemerken, daß die Ansicht Cannon's, wonach der Durst durch Trockenheitsgefühl, Speichelmangel ausgelöst wird und der Hunger durch gewisse
Zustände im Magen nur sehr beschränkt gültig ist. Gegen diese Annahme sprechen Beobachtungen am kranken Menschen und an siamesischen Zwillingen. Anoktine konnte bei einem solchen Zwillingspaar mit gemeinsamem Bauch, aber getrennter Brust, getrenntem Kopf und Zentralnervensystem folgende wertvolle Beobachtungen machen: Es handelt sich um 2 Mädchen, die äußerlich ein Wesen mit 2 Köpfen und 2 Paar Armen darstellen, wobei Becken und Beine nur einen Körper bilden. Es ist nur ein Nabel vorhanden. Das Röntgenbild läßt 2 Herzen erkennen und, was wichtiger ist, jedes Mädchen hat eine voll ausgebildete Wirbelsäule, d. h. jedes Mädchen hat sein eigenes Zentralnervensystem. Die Eindrücke der Umwelt können also individuell registriert werden. Die Herztätigkeit ist nicht synchron. Nun ergibt es sich, daß das eine Mädchen gesättigt ist, während das andere hungrig ist. Das eine schläft, während das andere spielt. Schlaf, Appetit und Schmerz sind für beide Kinder getrennt, d.h. Wirkstoffe oder Hormone, die innerhalb Sekunden aus dem Blut des einen Kindes in dasjenige des andern dringen, können nicht die Ursache dieser Erscheinungen sein.
4. Wie steht es nun mit den sog. Wachstumshormonen?
Die Entwicklung des Embryo führt uns zu diesem weiteren Problem der Biologie. Man fragt sich, warum wächst ein Lebewesen? Ich glaube, es wäre richtiger zu fragen: warum hört ein Wachstum auf? Und nun findet man sogenannte Wachstumshormone, vor allem im Hypophysenvorderlappen. Es ist zwar richtig, daß man durch Injektion von H. V. L.-Hormon beim Hunde z. B. einen Riesenwuchs erzeugen kann. Der Mediziner kennt hypophysäres Riesenwachstum bei Tumoren des Hypophysenvorderlappens und einen Zwergwuchs bei Zerstörung desselben.
Man nimmt ein Wachstumshormon in der Hypophyse an. Trifft dies wirklich zu? Man kennt in der Pathologie Zwergwuchstypen, bei welchen die Hypophyse sicher intakt ist. Es gibt z. B. einen Zwergwuchs, der durch eine Stenose im obersten Abschnitt des Dünndarms bedingt ist; wird die Stenose im Kindesalter operativ entfernt, so wächst das Kind sofort. Man kennt Zwergwuchsformen bei Nierenerkrankungen und bei bestimmten Herzerkrankungen (Mitralstenose), wenn dieselben im frühen Kindesalter auftreten. Ein Stillstand des Wachstums junger Tiere findet statt, wenn in der Nahrung gewisse Aminosäuren, Lysin, Histidin, Tryptophan, oder wenn Vitamin A oder B2, das Lactoflavin, fehlen (Edlbacher). Reichliche Zufuhr von oestrogenen Stoffen, z. B. von Stilbooestrol wirken dagegen wachstumshemmend.
Folgende Tatsachen sprechen ferner gegen die Annahme eines Wachstumshormons.
Ist, wie z. B. bei Züchtung eines Gewebes auf künstlichem Nährboden, ein biologisches Ziel nicht gegeben, so wächst das Gewebe beständig, solange Nährmaterial vorhanden ist. Ähnlich ist es beim Wachstum der Geschwülste, z. B. der Krebsgeschwülste. Auch hier ist ein biologisches Ziel nicht gegeben. Die Geschwulst wächst unbeschränkt, das gesunde Gewebe zerstörend oder verdrängend, besetzt Bindegewebe, Gefäße, steht aber —und das erscheint mir wesentlich —ohne unmittelbare Beziehung zum Zentralnervensystem. Ferner die merkwürdige Tatsache, daß das Krebsgewebe gärt, auch wenn es mit Sauerstoff gesättigt ist, — ein Vorgang ohne O2-Verbrauch also, während im gesunden Gewebe die Atmung entscheidend ist —könnte zu sehr interessanten Überlegungen führen.
Ganz anders bei Vorgängen im normalen Körper. Entfernt man durch einen Aderlaß eine größere Menge Blut
und somit rote Blutkörperchen, so bildet sich beim Gesunden das Blut sehr rasch wieder, aber nur bis zu der notwendigen normalen Menge von 4-5 Mill. roten Blutkörperchen pro cmm, wenn der Mensch in der Ebene lebt; im Hochgebirge wächst die Zahl zweckentsprechend auf z. B. 6 Mill pro cmm. Jede Minute gehen beim gesunden Erwachsenen 130-160 Mill. rote Blutkörperchen zugrunde, und gleichzeitig werden genau so viele produziert (Theorell). Modellversuche mit Isotopen haben gezeigt, wie unheimlich schnell im erwachsenen Körper Abbau und Aufbau sogar im Skelett und in den Zähnen erfolgen.
Interessant ist das Gewebewachstum bei der Wundheilung. Das Wachstum hört nicht auf, bis die Wunde geheilt ist. Es handelt sich um einen zielgerichteten Prozeß auf Wiederherstellung des strukturellen und funktionellen Normalzustandes (Russel). Ähnliches sieht man z.B. beim Hunde nach Entfernung eines Stückes der Leber. Das Wachstum hält an, bis das notwendige Lebergewebe wieder hergestellt ist; dann hört das Wachstum auf.
Das Wachstum erfolgt durch Zellteilung. "Das Ei ist nicht nur eine Zelle, die sich teilt so gut sie kann; es ist ein Baumeister, der bald hier, bald dort einen Stein legt, aber immer im Hinblick auf die künftige Entwicklung." Mit physikalischen Gesetzen ist dies nicht zu erklären. Es wird vieles, z. B. in der angepaßten Struktur der Knochen, entwickelt, lange bevor der Embryo seine Glieder gebrauchen kann. Manches, was aufgebaut wird, kommt erst zur Verwendung, wenn das Ganze vollendet ist. Ich brauche nur die Lunge zu erwähnen, die erst nach der Geburt für die Luftatmung in Funktion tritt.
Ich habe oben die Versuche des Zoologen Goetsch erwähnt, nach welchen Stoffe, sog. Großmodifikatoren, die Grundform der Lebewesen determinieren. Goetsch konnte
bei Termiten, wenn er die Tiere in einer bestimmten Phase der Entwicklung mit einer Substanz aus dem Penicillium fütterte, nach Belieben Soldaten mit vergrößerten Schädelorganen erzeugen. Das Extrakt aus dem jetzt bekannten Penicillium notatum war aber nur wirksam, wenn das Penicillin vorher zerstört wurde.
In der Entwicklung interessieren hauptsächlich die morphologischen Prozesse: gerichtetes Wachstum, Differenzierung von Zellen und ihre Anordnung, um Gewebe und Organe zu bilden (Bertalanffy).
Der Annahme, daß es gelinge, Probleme der Embryonalentwicklung, des Wachstums, der Formgestaltung einer exakt mathematisch formulierten Lösung zugänglich zu machen, vermag ich nicht zu folgen. Diese Möglichkeit kann vielleicht für die rein äußerliche Formgestaltung des Individuums einigermaßen zutreffen; will man jedoch die innere Formgestaltung erkennen, die mindestens ebenso wichtig ist, so muß diese Annahme versagen. Das Vertraute wird allzu leicht zum Gemeinplatz, und wir sind deshalb geneigt zu vergessen, wie beachtenswert ein Entwicklungsprozeß, z. B. in der Foetalzeit, eigentlich ist. Zur Illustration: die Nebennieren sind im 3.-4. Foetalmonat die größten Organe des Bauches. Beim erwachsenen Menschen sind sie nur noch einige Gramm schwer, während die Leber z. B. 2 kg und mehr wiegen kann. Diese auffallende Tatsache wird m. E. zu wenig berücksichtigt, wenn man die Aufgabe der Nebennieren studiert. Ist es nicht sehr merkwürdig, daß die Nebennieren in der Lebensperiode des Foetus am größten sind, in welcher sich das Gehirn am meisten entwickelt und für Schädigungen durch Erkrankung der Mutter am empfindlichsten ist. Die Nebennieren haben zweifellos für den Aufbau des Gehirns und seine Tätigkeit ihre
wichtigste Funktion. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß das Nebennierenrindenhormon für die Phosphorylierung der Kohlehydrate eine bedeutende Rolle spielt. Das Gehirn ist aber gerade dasjenige Organ unseres Körpers, das auf den Zuckerverbrauch am meisten angewiesen ist. Es ist das einzige Organ mit einem respirat. Quot. = 1.
In der Pflanzen- und Tierwelt gibt es Wirkstoffe, einige werden Hormone genannt, die die Organbildung und Organausprägung steuern. Es sind dies z. B. die Großmodifikatoren von Goetsch, ferner sog. Blühhormone und Streckungshormone (Auxin von Kögl), die Sexualhormone, das Biotin usw.
Von Bedeutung für die Ausgestaltung des Organismus ist das Zusammenwirken von solchen Wirkstoffen mit dem Licht.
Die meisten Blütenpflanzen werden in Langtags- und Kurztagspflanzen eingeteilt. Garner und Allard fanden 1920, daß die Länge der täglichen Beleuchtung für die Blütenbildung ausschlaggebend ist. Es ergab sich dann auch hier, daß stoffliche Faktoren, also Hormone (sog. Florigen oder Metaplasin) diese Wirkung auslösen, was sich aus Pfropfversuchen beweisen läßt. Man kann eine Langtagsrasse des Tabaks mit Erfolg auf eine Kurztagsrasse des Bilsenkrautes aufpfropfen. Der Stoff des Langtagspartners Tabak wandert in den Kurztagspartner Bilsenkraut und überwindet dort die Hemmungen, denen die Blütenbildungdieses Kurztagspartners unter den gegebenen Bedingungen unterliegt. Diese Wirkstoffgruppe ist also nicht gattungsspezifisch und scheint zur Gruppe der Sexualhormone zu gehören. Dihydrofolliculin, ein Sexualhormon bei Mensch und Tier, vermag die Blütenbildung bei der Komposite Callistephus sinensis stark zu beschleunigen.
Bedeutungsvoll ist es, daß das Blatt in Abhängigkeit von der Länge des ihm gebotenen Lichttages und völlig unabhängig von Nachbarblättern, die unter blühhemmenden Lichttagsbedingungen stehen, das Blühhormon ausbildet.
Nicht die Lichtzeitsumme ist für die Entwicklung maßgebend, sondern die Darbietung des Lichts zu bestimmten Zeitpunkten; wird eine Kurztagspflanze unter günstigsten Kurztagsbedingungen gehalten, so genügt ein Lichtblitz einer Osram-Vacublitzlampe von 1/40 Sekunde Dauer während einer bestimmten Phase der täglichen Verdunkelungsperiode, um die Blütenbildung aufs stärkste zu beeinträchtigen.
Der Vorgang der Blühhormonbildung ist ein Glied in der inneren Rhythmik und folgt bei den Kurztagspflanzen anderen Gesetzen als bei den Langtagspflanzen (Photoperiodismus). Zur Tageslänge kommen noch Temperatur und Stickstoffernährung als mitbestimmend hinzu. Der Einfluß der Tageslänge beschränkt sich natürlich nicht auf die Blütenbildung.
Bekanntlich ist der Mensch in Westeuropa in den letzten 70-80 Jahren größer geworden. In ungefähr allen Gegenden, die Schweiz inbegriffen, sind die Rekruten um 5-6 cm größer als damals. Über die Ursache wird noch gestritten. M. E. liegt die Erklärung, an welche bisher nicht gedacht wurde, und die ich als die weitaus wahrscheinlichste ansehen möchte, in der vermehrten, intensiveren und qualitativ anderen Belichtung des Körpers. Die Beleuchtung mit elektrischem Licht bedeutet für unseren Körper etwas ganz anderes als diejenige mit Petrollampen oder Kerzen. Auch diese Erscheinung spricht nicht für das Vorhandensein von spezifischen Wachstumshormonen. Die Wachstumskurve des Menschen verläuft
anders als die der Tiere. Das menschliche Wachstum erscheint erheblich verlängert und verzögert. Es ist nicht auf die sog. Wachstumsperiode beschränkt. Die Haut ist ein Gewebe, das ununterbrochen bis zum Tode wächst. Wie ich mich wiederholt überzeugen konnte, kann auch der Brustumfang zwischen dem 20. Altersjahr (Rekrutierung) und einem spätem Alter, 50-70 Jahren, um mehrere Zentimeter größer werden, ohne daß die Zunahme der Weichteile (Fettpolster) eine befriedigende Erklärung dafür liefert. Unter pathologischen Bedingungen, z. B. bei der Akromegalie, sehen wir auch eine Vergrößerung verschiedener Skeletteile, z.B. der Gesichtsknochen, ferner eine Vergrößerung der Leber, des Herzens, eine sog. Splanchnomegalie.
Sind alle diese Veränderungen bei der Pflanze, beim Tier und beim Menschen der Ausdruck einer Ueberproduktion eines sog. Wachstumshormones? Diese Frage ist nicht identisch mit der Frage, ob es Wirkstoffe gibt, die die Organbildung und Organausprägung steuern. Der Zusammenhang zwischen Geschlecht und Wachstum ist ein sehr enger.
Diese Wirkstoffe dürfen m. E. nicht als reine Wachstumshormone angesehen werden. Die sog. Großmodifikatoren wie auch z. B. die reinen Sexualhormone beeinflussen qualitativ das Wachstum. Sie sind aber nicht Wachstumshormone. Wachsen ist ein integrierendes Attribut jedes Lebewesens. Hier, wie bei der Annahme von Konstanten und von gewissen Zentren, ist der Satz Bergsons am Platze: "On se borne à traduire des faits physiologiques on pathologiques incontestés dans un langage biologique contestable."
5. Triebe und Instinkte.
Wenn es keine spezifischen Stoffwechselzentren, also auch keine Zucker- oder Kohlehydrathormone 1 und keine spezifischen Wachstumshormone gibt, so finden wir im lebenden Organismus doch sehr präzise, zielgerichtete Vorgänge. Aber zielgerichtete Bewegung, dieser Faktor jeden vitalen Verhaltens, heißt bei höheren Tieren wie auch beim Menschen wohl nichts anderes als den "Trieben" und ihren Gehilfen, den Instinkten, folgen. Es gibt Lokomotionszentren, z. B. Zentren für die Muskulatur der Extremitäten, ferner ein Sprachzentrum, ein Sehzentrum u. a. m. ; es existieren aber sicher weder ein Zentrum für den Selbsterhaltungstrieb, noch eines für den Fortpflanzungstrieb. Die Triebe verursachen sehr verschiedene Reaktionen; letztere können dann als Folge der Tätigkeit von Zentren, z.T. funktionell gedacht betrachtet werden.
Ein Beispiel entnehme ich Tinbergen:
"... Die Organisation des instinktiven Verhaltens scheint nun so zu sein, daß bei Aktivierung eines übergeordneten Zentrums zuerst ein Appetenzverhalten ganz allgemeiner Art erscheint. Der Wanderfalke, in dem der Jagdtrieb rege wird, begibt sich auf die Suche nach Beute, wobei noch nicht vorauszusagen ist, ob er eine fliegende Ente, eine schwimmende Möwe oder eine Feldmaus verfolgen wird. Er wird vom einen Teil seines ausgedehnten Jagdreviers zum anderen Teil fliegen, vielleicht von ganz bestimmten Erfahrungen über frühere Erfolge geleitet. Dieses zweckstrebige Verhalten wird erst dann in anderes Verhalten übergehen, wenn sich eine neue Reizsituation
dartut: er sieht eine Entenschar. Dieser Reiz löst nun eine neue Art von Appetenzverhalten aus: er fliegt auf die Enten zu und führt eine Reihe von Scheinangriffen aus, wovon der objektive Zweck ist, eine Ente aus dem Trupp loszulösen. Erst wenn dieses gelungen ist, tritt eine dritte, wieder speziellere Form von Appetenzverhalten auf: er stößt zu, und wenn es ihm gelingt, der Ente ganz nahe zu kommen, greift er sie, tötet, rupft und frißt sie. Letzteres ist eine Reihe von "consummatory actions". Also die Aktivierung der Zentren erfolgt von hoch bis niedrig, und jedes Zentrum ruft zuerst eine beschränktere Form von Appetenzverhalten hervor, bis schließlich das niedrigste Niveau, das der Endhandlung, aktiviert wird ..."
Der Mensch wie auch das Tier hat Triebe, die, zur Handlung bringen oder auch zwingen. Es sind der Selbsterhaltungstrieb, der Arterhaltungstrieb, der Gesellschaftstrieb beim Menschen und bei manchen Tierspezies, beim Menschen allein noch der intellektuelle Trieb. Letzterer kommt in der "Fragenot" des Kindes zum Ausdruck. Die Triebe spielen ineinander, sie treffen das ganze Wesen. Triebe, Instinkte lassen sich nicht lokalisieren. Sie sind Eigenschaften des ganzen lebenden Organismus.
Ein Trieb kann über einen anderen dominieren. Dabei ist zu bemerken, daß eine Dominanz des Arterhaltungstriebes, oder, allgemeiner ausgedrückt, des "Neuformungstriebes", wie Hartmann ihn nennt, über den Erhaltungstrieb oder Selbstbewahrungstrieb besteht.
Folgendes Beispiel entnehme ich Russel: Eine Planarie, ein einzelliges Tierchen, dessen Größe durch langdauernde Anstrengung sehr reduziert ist, bildet, in zwei Teile zerschnitten, zwei neue, wenn auch winzige Ganze. Die Energien des Tieres sind auf ein einziges biologisches
Endziel, die Wiederherstellung einer normalen Struktur, gerichtet. Das ganze Material wird für die Neuformung einer Struktur verwendet. Analoges beobachten wir beim höheren Tier.
Das Leben ist nicht auf Erhaltung, sondern auf Neuformung eingerichtet. Der Nahrungsbedarf wird instinktmäßig beherrscht. Dabei ist der Trieb nicht auf eine lange Lebensdauer eingestellt. Das Tier sucht sich die Nahrung, die es gegen seine Gegner in der Natur kampffähig oder schutzfähig und es zur Fortpflanzung geeignet macht. Ein Tier, das sich nicht fortpflanzen und nicht verteidigen kann, ist für die Natur nicht mehr brauchbar und wird von seinen Rivalen oder von einer andern Tierspezies rücksichtslos beseitigt.
Dieser Instinkt existiert auch im Menschen, und das erklärt die Schwierigkeit für den Arzt, bei Krankheiten eine richtige Diät zu verordnen. Die Aufgabe des Arztes ist hier derjenigen der Natur beinahe widersprechend. Die Aufgabe des Arztes ist es ja, den Menschen möglichst lange am Leben zu erhalten. Diese Aufgabe entspricht nicht dem Instinkt des Patienten; deshalb empfindet der Patient z. T. mit Recht die Vorschriften des Arztes als nicht dem Körper zweckentsprechend zielgerichtet. Der Mißbrauch gewisser Genußmittel ist sicher nicht auf Instinktlosigkeit zurückzuführen. Auch das Tier kann z. B. in Gefangenschaft, oder wenn es domestiziert ist, seinen Instinkt, z. B. in bezug auf den Erhaltungstrieb, mißbrauchen und ein Futter gerne fressen, das ihm dargeboten wird, obwohl es ihm schädlich ist. Die Behauptung Rößles, daß die Instinktlosigkeit des Menschen im Gegensatz zum Tier den vorzeitigen Tod vor dem natürlichen Tod oft verursache, kann nicht richtig sein. Abgesehen von der Tatsache, daß in der Natur das höhere
Tier kaum eines natürlichen Todes stirbt, sind die Instinkte beim Menschen nicht weniger entwickelt als beim Tier.
Das Wachstum ist ein integrierender Bestandteil jedes Lebewesens; der Arterhaltungstrieb kann erst nach einem bestimmten Wachstum des Organismus zustande kommen.
Das Leben selbst ist ein andauerndes Wachstum, es ist eine spontane Selbsterhaltung, die dem Verbrauch und der Zerstörung aktiv entgegenarbeitet. Differenzierung und Reifung ist ohne Wachstum unmöglich. Was sich im Lebensprozeß identisch erhält, ist nicht die organische Form, sondern der Gesamtrhythmus des Lebens. Die Stabilität ist nur eine scheinbare; das Gleichgewicht ist labil. "Das Individuum ist ein unteilbar Einheitliches, nicht nur der Form nach, sondern auch dem Prozeß nach" (Hartmann).
Ist diese Einheitlichkeit vom Ei bis zum erwachsenen Wesen nicht ein Beweis der unheimlichen organisatorischen Kraft des Lebens, die weder mit rein physikalischen noch chemischen Prozessen allein erklärt werden kann? Das menschliche Ei ist eine kleine Zelle von nur 0,2 mm Durchmesser. Aus derselben entsteht ein mit besonderen Erbanlagen versehenes Individuum, das aus Trillionen von Zellen nach einem wunderbaren Plan aufgebaut ist. Der Untergang des Leblosen ist ein Übergang in ein anderes Lebloses. Nur was lebt kann sterben, nur was lebt pflanzt sich fort.
Literatur.
Anoktine. Presse médicale 11. III. 1939.
v. Bertalanffy. Vom Molekül zur Organismenwelt. Akad. Verl. Potsdam 1949.
Das biologische Weltbild. Francke, Bern 1949.
Das Gefüge des Lebens. Teubner, Leipzig 1932.
Bernhardt. Bullt. Schweiz. Akad. Med. Wiss. 5, 331, 1949.
Bohr u. Hasselbach. Skand. Arch. Physiol. 10, 1900.
Bouckaert. Institut pr. la recherche scientifique en Afrique centrale. Rapport annuel 1948, S. 85.
Brunhes. La dégradation de l'énergie. Flammarion, Paris 1922.
Edlbacher. Die Chemie der Wachstumsvorgänge. Rektoratsr. Basel 1934.
Gigon. Die Arbeiterkost. Springer, Berlin 1914.
Pflügers Arch. 140, 1, 1911, Presse médicale 1922.
Ergebn. der Physiologie 1925. Ergebn. Inn. Med. 1926.
Wien. Arch. Enn. Med. 27, 197, 1935.
Helv. Med. Acta 1. 1935. Schweiz. Med. Woch. 1942.
Gigon u. Noverraz. Schweiz. Med. Woch. 1929.
Goetsch. Experientia 3, 326, 1947.
Gurwitsch. Zellteilung. Springer, Berlin 1926.
Hartmann. Philosophie der Natur. De Gruyter, Berlin 1950.
Hasselbach. Skand. Arch. Physiol. 10, 353, 1900.
Hundt. Wirkungsquantum u. Naturbeschreibung. 1949.
Jordan. Eiweißmoleküle. Wissensch. Verlag, Stuttgart 1947.
Die Physik und das Geheimnis des Organ. Lebens. Vieweg, Braun. schweig 1945.
Physik im Vordringen. Vieweg, Braunschweig 1949.
Markees u. Meyer. Schweiz. med. Woch. 79, 931, 1949.
Noack. Die Ausgestaltung der Organismen, ein chemisches Problem. Akad. Verlag, Berlin 1949.
Ohm. Mikroneurologie des Auges. Enke, Stuttgart 1943.
Rößle. Stufen der Malignität. Akad. Verlag, Berlin 1950.
" Experientia 4, 295, 1948.
E. R. Russel. Lenkende Kräfte des Organischen. Francke, Bern 1947.
Schrödinger. Was ist Leben? Francke, Bern 1946.
Schumacher. Die Naturwissenschaften 34, 176, 1947.
Staudinger. Philosophisches Jahrbuch 60, 306, 1950.
Tangl. Pflügers Arch. 130, 1 u. 55, 1910.
Tangl u. Mituch. Pflügers Arch. 121, 437, 1908.
Theorell. Semaine des Hôpitaux 24, 1705, 1948.
Täufel. Ernährungsstörungen und Lebensmittelchemie. Berlin 1950.
Tomcsik. Proc. of the Soc. for Experim. Biol. sud Medicine 24, 810-812, 1927.
Tomcsik u. Kurotchkin. Journ. of Experim Medicine 47, p. 379, 1928.
Tomcsik u. Sponzett. Zeitsch. 1. Immunitätsforschung. 76, 1932 u. 77, p. 86, 1933.
Tomcsik u. Ivanovic. Zeitsch. f. Immunitätsforschung 94, p. 28, 1938.
Tinbergen. Experimentia 4, p. 191, 1948.
Wagner. Über Regulationen im lebenden Organismus. Bayr. Akad. d. Wiss. München 1950.
Wartburg. Ideen zur Fermentchemie der Tumoren. Berlin 1947.
G. Wolff. Leben und Erkennen. Reinhardt, München 1932.