Die Klinik und ihr Leben.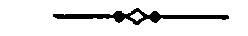
Rectoratsrede
gehalten zum Jahresfeste der Universität Basel
von
o. ö. Professor der klinischen Medicin zu Basel, d. Z. Rector der Universität.
Basel. Benno Schwabe, Verlagsbuchhandlung. 1881.Hochansehnliche Versammlung!
Zu dem Jahresfeste der Universität, so wie es jeweilen in den Tagen des Herbstes uns an dieser ehrwürdigen Stätte vereinigt, heisse ich Sie Alle heute voll innigen Dankes willkommen! Vornehmlich und mit besonderer Erkenntlichkeit begrüsse ich Sie, meine hochgeachteten Herren Mitglieder unserer hohen Regierung, Mitglieder des Erziehungsrathes und Mitglieder der Curatel, deren treuer Obhut und Fürsorge das Wohl unserer Hochschule anvertraut ist, und die Sie mit nichtermüdender Liebe dieses Erbe der Vorfahren auch während des letztverflossenen Jahres verwalteten! — In zweiter Reihe gilt mein achtungsvoller Gruss und mein Dank Ihnen, den so zahlreich hier erschienenen Gönnern und Freunden der Universität, die Sie, hochgeehrte Herren, Ihr lebendiges Interesse an unserer Anstalt bereits so oft durch Wort und Werk bethätigten und uns durch Ihr persönliches Erscheinen zu der heutigen Jahresfeier auf's Neue Ihre Gewogenheit zu erkennen geben! — Endlich wende ich mich grüssend noch an die Mitgliederschaft der Universität selbst, — an Sie, meine werthen Herren Collegen, an Sie, meine lieben Herren Commilitonen, — an Beide, als an die Genossin der Arbeit, — mit dem herzlichen Wunsche, wir »Cives academici« möchten allesammt in das neu-begonnene Semester auch geistig-frisch und wohlgerüstet eingetreten sein, sowie den Muth in uns fühlen, der uns gewiesenen
schönen Aufgabe des Lehrens und des Lernens mit unseren besten Kräften fort und fort gerecht zu werden!
Wenn dann endlich noch persönlich mir, vermöge meines diesjährigen Amtes, die Ehre zu Theil wird, am heutigen Tage dieser hochansehnlichen Versammlung Rede stehen zu dürfen, — so werden Sie, meine Herren, es wohl natürlich und namentlich auch ganz am Platze finden, dass ich das Thema hierzu mir auf demjenigen Lebensgebiete gesucht habe, auf welchem meine hiesige academische Wirksamkeit fusst. — Für den Kliniker aber, und als solcher stehe ich ja vor Ihnen da, ist dieses Gebiet sicherlich die Klinik, — das heisst: das academische Wirken und Treiben am Krankenbette; gestatten Sie mir nun, auf eben nichts Anderes, denn auf dieses Leben der Klinik selbst, als Ganzes sowohl, wie in seiner dreifältigen Theiläusserung, als heilende, als lehrende und als forschende Thätigkeit, oder Function, für die Dauer dieser Stunde Ihre geneigte Aufmerksamkeit hinzulenken. Ich möchte dabei von allen jenen, im Principe völlig untergeordneten Differenzen absehen, die für das Leben der Klinik im Besondern und in der Gegenwart vermöge der Spaltung der einigen klinischen Medicin in die Separatfächer der internen Heilkunde, der Chirurgie, Geburtshilfe, Augenheilkunde u. s. w. sich nach und nach herausgebildet haben; mein Wunsch bei heutigem Anlasse ist im Gegentheile nur der, von der Klinik an sich, wie ich es wohl nennen darf, zu reden, wiewohl dieses Ding, dem eben Angedeuteten zufolge, in Wirklichkeit nicht mehr als »Ens simplex«, sondern nur noch als Complex von Fragmenten existirt. Bei alledem aber ist dieser Complex zum Glücke auch heute noch,
 wenngleich nicht einfach, so doch in soweit einheitlich,
dass er unbedenklich als Einheit der Betrachtung
unterzogen werden darf; auch dürfte es wohl keinem
Zweifel unterliegen, dass, gerade in solcher Allgemeinheit
gefasst und losgelöst von allzu-enger beruflicher Specialistik,
das Thema noch am Ehesten Anspruch auf allgemeineres
Interesse hat.
wenngleich nicht einfach, so doch in soweit einheitlich,
dass er unbedenklich als Einheit der Betrachtung
unterzogen werden darf; auch dürfte es wohl keinem
Zweifel unterliegen, dass, gerade in solcher Allgemeinheit
gefasst und losgelöst von allzu-enger beruflicher Specialistik,
das Thema noch am Ehesten Anspruch auf allgemeineres
Interesse hat.
Als ansprechendster Weg ferner, die Idee der modernen Klinik klar zu stellen, bietet sich nun wohl jedenfalls der historische dar, welcher zudem auch da ohne Scheu betreten werden kann, wo es gilt, sich über das Wesen der Institution ganz im Allgemeinen zu verständigen. — Denn die Entwickelungsgeschichte, oder, wenn ich so sagen darf, Embryologie der Klinik ist doch nicht lediglich der trockene Bericht von dem äusserlichen Hergange ihrer Disgregation in so und so viel Parcellen oder Specialkliniken, sondern weit mehr noch die Darlegung ihres Werdeganges überhaupt, oder die Beantwortung der Frage, wie auf practisch-ärztlichem Gebiete Hand in Hand mit der Ausübung der Kunst sich das Lehren und Lernen derselben, ferner auch die Forschung allmälig zu der Form gestaltet haben, unter welcher die Gesammtklinik, uns zur Zeit entgegentritt? — Diese Frage, grossentheils disparat von derjenigen nach den historischen Ursachen der vorerwähnten äusserlichen Disgregation, ist übrigens ganz, wie letztere, der historischen Behandlung zugänglich; total von beiden verschieden hingegen verhält sich hierin jenes schon seiner ganzen sonstigen Art nach völlig andere, philosophische Problem, warum nämlich eigentlich überhaupt die Klinik, — das heisst: jene Trias, oder Combination von heilender Thätigkeit einerseits, — practischer Lehre und
 practischer Forschung auf dem Gebiete des Heilens anderseits,
— irgendwann entstanden ist, und warum insbesondere
die zuletzt genannten beiden Coëfficienten,
Lehre und Forschung, in der Folge stets mit dem Hauptfactor,
der Therapeutik, als solcher, einen gewissen gemeinsamen
und zugleich erkennbaren Entwickelungsgang
genommen haben? Hier nämlich stossen wir allerdings
auf eine Thatsache und auf einen Process, die beide
historisch und deductiv nicht zu fassen sind, dafür aber
anthropologisch und inductiv, mittelst Betrachtung
der menschlichen Natur, ihrer Leistungen und ihrer Strebungen,
ohne Weiteres als nothwendig, — weil natürlich
begriffen werden können! Denn eine solche Betrachtung
lehrt, je allseitiger angestellt, auch desto zwingender,
dass aus der factischen Existenz und Aeusserung irgendwelcher
intellectuellen oder technischen Begabung immer
auch erfahrungsgemäss das Bedürfniss der Mittheilung,
beziehungsweise Erwerbung solcher Potenz: das Lehr-
und das Lernbedürfniss entspringt, — und ferner, dass
neben dieser mehr handwerksmässigen — banausischen
— Auffassung des Berufes, als einer Fertigkeit, die da
einfach nur auszuüben, oder von Anderen völlig abzulernen
sei, allezeit auch noch jener andere, ideale Drang
nach »Mehrung des Reiches«: der Forschungstrieb —
sich regt und an die Pforten des Herzens klopft! —
Das anthropologische Bürgerrecht der Klinik erhellt
hieraus von selbst, als besonderer Fall eines allgemeinen
anthropologischen Princips, und einer historischen Rechtfertigkeit
ihres Daseins, wie ihrer Entwickelungsfähigkeit
bedarf es nicht, sobald man nur überhaupt mit Krankheit
und Heilkunde, als praehistorisch gegebenen Grössen
rechnet. Dagegen ist es keineswegs überflüssig, ja für
practischer Forschung auf dem Gebiete des Heilens anderseits,
— irgendwann entstanden ist, und warum insbesondere
die zuletzt genannten beiden Coëfficienten,
Lehre und Forschung, in der Folge stets mit dem Hauptfactor,
der Therapeutik, als solcher, einen gewissen gemeinsamen
und zugleich erkennbaren Entwickelungsgang
genommen haben? Hier nämlich stossen wir allerdings
auf eine Thatsache und auf einen Process, die beide
historisch und deductiv nicht zu fassen sind, dafür aber
anthropologisch und inductiv, mittelst Betrachtung
der menschlichen Natur, ihrer Leistungen und ihrer Strebungen,
ohne Weiteres als nothwendig, — weil natürlich
begriffen werden können! Denn eine solche Betrachtung
lehrt, je allseitiger angestellt, auch desto zwingender,
dass aus der factischen Existenz und Aeusserung irgendwelcher
intellectuellen oder technischen Begabung immer
auch erfahrungsgemäss das Bedürfniss der Mittheilung,
beziehungsweise Erwerbung solcher Potenz: das Lehr-
und das Lernbedürfniss entspringt, — und ferner, dass
neben dieser mehr handwerksmässigen — banausischen
— Auffassung des Berufes, als einer Fertigkeit, die da
einfach nur auszuüben, oder von Anderen völlig abzulernen
sei, allezeit auch noch jener andere, ideale Drang
nach »Mehrung des Reiches«: der Forschungstrieb —
sich regt und an die Pforten des Herzens klopft! —
Das anthropologische Bürgerrecht der Klinik erhellt
hieraus von selbst, als besonderer Fall eines allgemeinen
anthropologischen Princips, und einer historischen Rechtfertigkeit
ihres Daseins, wie ihrer Entwickelungsfähigkeit
bedarf es nicht, sobald man nur überhaupt mit Krankheit
und Heilkunde, als praehistorisch gegebenen Grössen
rechnet. Dagegen ist es keineswegs überflüssig, ja für
 ein gründliches Studium des dermaligen Standes der
Klinik sogar eigentlich unerlässlich, den Modus ihrer
zeitlichen und räumlichen Entwickelung, wie er den
sonstigen Umständen gemäss verlief, an der Hand
der Geschichte näher zu verfolgen.
ein gründliches Studium des dermaligen Standes der
Klinik sogar eigentlich unerlässlich, den Modus ihrer
zeitlichen und räumlichen Entwickelung, wie er den
sonstigen Umständen gemäss verlief, an der Hand
der Geschichte näher zu verfolgen.
Hier aber ergeben sich nun freilich der Stadien und Wandelungen im Einzelnen so viele, dass es unmöglich ist, sie alle, — schwierig, auch nur die wichtigeren derselben in den engen Rahmen eines Vortrages zu fassen, und es mir darum für meine heutige Aufgabe anfänglich sogar gerathener erschien, auf geschichtliche Evolution überhaupt zu verzichten. Wenn ich nun trotzdem es doch jetzt noch wage, der einfach-analytischen Betrachtung des Gegenstandes in der Gegenwart eine Art Entwickelungsgeschichte der Klinik vorauszuschicken, so geschieht es meinerseits aus der Empfindung, dass eine völlige Enthaltung von der Historie bei einer Herzensangelegenheit fast einem Mangel an Pietät gleichkommt, aus diesem Grunde also für mich nicht wohl statthaft ist! Anderseits darf ich aber wohl mich Ihnen gegenüber mit der Kürze der mir hier verfüglichen Zeit entschuldigen, wenn meine historische Beleuchtung der Klinik entsprechend kurz und summarisch ausfällt, und wenn ich namentlich mich begnüge, diese Beleuchtung vorwiegend äusserlich, das heisst, im Wiederscheine der Zeiten und der regionären Verhältnisse, augenblicklich hier vorzunehmen.
Kliniken, nach heutigen Begriffen, im concreten und zugleich vulgären Sinne dieses Wortes, das will sagen: ständige Krankenanstalten, in denen die zur Pflege und zur Heilung aufgenommenen Patienten auch gleichzeitig zu Unterrichts- und eventuell zu Forschungszwecken
 benutzt worden wären, hat es begreiflicherweise nicht
eher geben können, als überhaupt Krankenhäuser, Spitäler,
existirten; die primären Gründungen solcher Häuser
fallen aber erst in eine relativ-späte Periode menschlicher
Cultur. Weder das Aegypten der Pharaonen, noch
das brahmanische Indien vor dem Auftreten des Buddha
Sakya-Muni, —weder die jüdische Theokratie, noch Hellas,
noch endlich das völkerbezwingende Rom hatten, oder
kannten das humane Institut geordneter Krankenpflege in
Spitälern; es fehlte also damals und dort noch ganz und
gar derjenige Grund und Boden, auf welchem, aus Opportunitätsrücksichten
verschiedener Art, die Klinik später
ihren Hauptsitz aufgeschlagen hat. Dieser Mangel war
sicherlich ein schwerwiegendes Hemmniss, ebenso gewiss
aber kein absolutes Hinderniss für klinische Forschung
und klinischen Unterricht, wie nicht nur anthropologisch
a priori gefolgert, sondern auch historisch, direct aus
Quellen, nachgewiesen werden kann. Aelter nämlich um
Vieles zunächst, als das Spital, älter aber anderseits auch
wohl jedenfalls, als das mehr künstliche Destillat, des
einfach-theoretischen Vortrages, oder der abstracten Disputation
über medicinische Dinge, die beide später vielfach
über Gebühr auf Kosten des klinischen Elementes
sich breit gemacht haben, ist das durch und durch naturwüchsige
Institut der Klinik an sich, das heisst, der
Lehre und Forschung direct am kranken Menschen;
freilich nur in derjenigen Form, für welche neuerdings
im Gegensatze zur stationären Klinik des Spitals, oder
»Klinik« schlechthin, mehr und mehr der Name Poliklinik
(Stadtklinik) in Gebrauch gekommen ist. Diese
ältere Poliklinik war ferner auch, im Gegensatze zu der
spätem und heutigen, nicht sofort schon vorzugsweise
benutzt worden wären, hat es begreiflicherweise nicht
eher geben können, als überhaupt Krankenhäuser, Spitäler,
existirten; die primären Gründungen solcher Häuser
fallen aber erst in eine relativ-späte Periode menschlicher
Cultur. Weder das Aegypten der Pharaonen, noch
das brahmanische Indien vor dem Auftreten des Buddha
Sakya-Muni, —weder die jüdische Theokratie, noch Hellas,
noch endlich das völkerbezwingende Rom hatten, oder
kannten das humane Institut geordneter Krankenpflege in
Spitälern; es fehlte also damals und dort noch ganz und
gar derjenige Grund und Boden, auf welchem, aus Opportunitätsrücksichten
verschiedener Art, die Klinik später
ihren Hauptsitz aufgeschlagen hat. Dieser Mangel war
sicherlich ein schwerwiegendes Hemmniss, ebenso gewiss
aber kein absolutes Hinderniss für klinische Forschung
und klinischen Unterricht, wie nicht nur anthropologisch
a priori gefolgert, sondern auch historisch, direct aus
Quellen, nachgewiesen werden kann. Aelter nämlich um
Vieles zunächst, als das Spital, älter aber anderseits auch
wohl jedenfalls, als das mehr künstliche Destillat, des
einfach-theoretischen Vortrages, oder der abstracten Disputation
über medicinische Dinge, die beide später vielfach
über Gebühr auf Kosten des klinischen Elementes
sich breit gemacht haben, ist das durch und durch naturwüchsige
Institut der Klinik an sich, das heisst, der
Lehre und Forschung direct am kranken Menschen;
freilich nur in derjenigen Form, für welche neuerdings
im Gegensatze zur stationären Klinik des Spitals, oder
»Klinik« schlechthin, mehr und mehr der Name Poliklinik
(Stadtklinik) in Gebrauch gekommen ist. Diese
ältere Poliklinik war ferner auch, im Gegensatze zu der
spätem und heutigen, nicht sofort schon vorzugsweise
 eine öffentliche, von der staatlichen Genossenschaft fundirte
Anstalt, sondern, den einfacheren Verhältnissen
ihres Entwickelungsbodens gemäss, rein private Angelegenheit
der unmittelbar Betheiligten, — des ärztlichen
Lehrers also, des Schülerkreises und der Patienten.
eine öffentliche, von der staatlichen Genossenschaft fundirte
Anstalt, sondern, den einfacheren Verhältnissen
ihres Entwickelungsbodens gemäss, rein private Angelegenheit
der unmittelbar Betheiligten, — des ärztlichen
Lehrers also, des Schülerkreises und der Patienten.
Historische Belege nun aber solcher privater poliklinischer Thätigkeit aus jenen Culturstadien und Culturregionen, denen die Spitalversorgung kranker Individuen noch gänzlich fern lag, gibt es, wie gesagt, in Menge, und zwar tritt uns in derselben die Poliklinik alsbald auch unter jenem doppelten Bilde entgegen, unter welchem sie überhaupt möglich ist und noch in der Gegenwart existirt: als poliklinischer Krankenbesuch nämlich in der Behausung des Patienten, und als poliklinische Sprechstunde (oder »Ambulatorium«) in der Wohnung des Arztes, beziehungsweise einer sonstigen passenden Localität. — Poliklinik war es zum Beispiele, wenn der heilkundige Brahmane des alten Indiens 1) seine Besuche bei den Patienten meist in Begleitung von Schülern machte und so die Gelegenheit wohlweislich benutzte, diesen sein Wissen und sein Können »ad hominem« zu demonstriren, — oder wenn er gar, in Gemeinschaft mit solchen lernbegierigen Zöglingen, Excursionen nach auswärtigen Gebieten hin unternahm, um fremde Krankheitsformen, — interessante Endemieen — an Ort und Stelle kennen zu lehren und selbst kennen zu lernen. — Poliklinischer Art und demjenigen der heutigen Ambulatorien analog, war auch vielfach das Treiben in jenen Empfangsräumen der altgriechischen Aerzte, welche unter dem Namen: bei Hippokrates 2), ferner bei Plato 3), Xenophon 4) und Aeschines 5) genannt und beschrieben werden, da es ausdrücklich von diesen Localen
 heisst, sie seien nicht nur von Kranken und Heilbedürftigen,
sondern auch häufig von Schülern der Medicin
um der Belehrung willen aufgesucht worden. Ebenso
aber, wie die poliklinische Sprechstunde, prosperirte
auch der poliklinische Hausbesuch in Hellas, — und
später fast noch mehr in Rom, — denn wiederholt verlautet,
dass hervorragende griechische und namentlich
römische Aerzte zu ihren Patienten nicht allein, sondern
begleitet von einem ganzen Schwarme lern- und untersuchungseifriger
Schüler, — wir würden sagen, poliklinischer
Practicanten, — gekommen sind. Und dass schon
damals nicht immer eitel Lust und Freude die Signatur
des Empfanges ob solcher Begleiterschaft war, sondern
mitunter wohl auch recht winterliches Missvergnügen
die Seele des also Heimgesuchten und Ueberfallenen
beschlich, dafür bürgt, — aus der Periode der flavischen
Kaiser, — das noch erhaltene, aber nichts weniger denn
liebenswürdig gehaltene Epigramm des Martialis 6) an
Symmachus, den höchst-eigenen Hausarzt und damals
sehr berühmten Practiker, in welchem sich der römische
Dichter selbst als Opfer derartiger poliklinischer Heimtücke
folgendermaassen beklagt:
heisst, sie seien nicht nur von Kranken und Heilbedürftigen,
sondern auch häufig von Schülern der Medicin
um der Belehrung willen aufgesucht worden. Ebenso
aber, wie die poliklinische Sprechstunde, prosperirte
auch der poliklinische Hausbesuch in Hellas, — und
später fast noch mehr in Rom, — denn wiederholt verlautet,
dass hervorragende griechische und namentlich
römische Aerzte zu ihren Patienten nicht allein, sondern
begleitet von einem ganzen Schwarme lern- und untersuchungseifriger
Schüler, — wir würden sagen, poliklinischer
Practicanten, — gekommen sind. Und dass schon
damals nicht immer eitel Lust und Freude die Signatur
des Empfanges ob solcher Begleiterschaft war, sondern
mitunter wohl auch recht winterliches Missvergnügen
die Seele des also Heimgesuchten und Ueberfallenen
beschlich, dafür bürgt, — aus der Periode der flavischen
Kaiser, — das noch erhaltene, aber nichts weniger denn
liebenswürdig gehaltene Epigramm des Martialis 6) an
Symmachus, den höchst-eigenen Hausarzt und damals
sehr berühmten Practiker, in welchem sich der römische
Dichter selbst als Opfer derartiger poliklinischer Heimtücke
folgendermaassen beklagt:
» Languebam; sed tu, comitatus protinus ad me Venisti centum, Symmache, discipulis. Centum me tetigere manus, Aquilone gelatae, Neque habui febrem, Symmache, — nunc habeo!
Wer, der je selbst poliklinisch als Lehrer thätig war, oder als Studirender der Medicin poliklinischer Unterweisung am Krankenbette unter erschwerenden Verhältnissen beiwohnte, wird nicht die partielle Berechtigung dieses poetischen Stossseufzers bereitwilligst anerkennen, wer aber nicht auch die Gelassenheit dieser ärztlichen
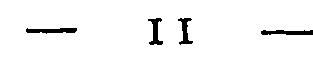 Lehrer bewundern, — die, in Ermanglung augenscheinlich
eines »Corporis vilioris«, mit frostiger Hand (»Aquilone
gelatae!«) und doch so höchst unverfroren — sogar
ihre vornehme Privatclientel poliklinisch ausnutzten!
Lehrer bewundern, — die, in Ermanglung augenscheinlich
eines »Corporis vilioris«, mit frostiger Hand (»Aquilone
gelatae!«) und doch so höchst unverfroren — sogar
ihre vornehme Privatclientel poliklinisch ausnutzten!
Man könnte nun vielleicht glauben, dass mit Begründung der ersten öffentlichen Krankenanstalten, mit Anbruch also des Zeitalters der Spitäler, diese letzteren überall auch alsbald als die geeignetsten Orte für klinischen Unterricht erkannt und als solche fortan benutzt seien. Beherbergten doch diese Anstalten immer und überall seitdem vorwiegend solche Insassen, die, herausgerissen aus socialer Bedrängniss, und zugleich an geringe persönliche Ansprüche gewöhnt, voraussichtlich auch früher schon, gerade so wie jetzt, sich grösseren Theils ganz willig in die Rolle klinischer Patienten gefunden hätten! Und leuchtet es nicht anderseits einem jeden Unbefangenen heutzutage ohne Weiteres ein, dass auf dem geschlossenen Raume des Spitales die genaueste Untersuchung und Ueberwachung der Kranken, die schärfste Controle der Heilerfolge möglich ist, — Bedingungen also hier meist existiren, wie sie günstiger für Lehre und Forschung kaum gegeben sein können! Solchen Ueberlegungen gegenüber mag es auf den ersten Blick hin auffällig erscheinen, dass trotzdem nicht das Spital, sondern die Poliklinik — und zwar fast ausschliesslich immer noch die private, nicht die öffentliche, — auf viele Jahrhunderte hin der vornehmlichste Schauplatz practischer medicinischer Lehre und Forschung geblieben ist. Das Befremden verschwindet jedoch, wenn man erwägt, dass die von tiefstem religiösen Gefühle getragene barmherzige Liebe, welche die ersten Spitäler baute, in schlichter Einfalt nichts Anderes wusste und nichts Anderes
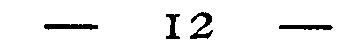 wünschte, als das in Krankheit und Armuth gegebene
und vorhandene Elend zu lindern, und dass die mehr
rationelle Idee ihr zunächst und auf sehr lange hin
noch völlig transcendent war, es lasse sich an einem
also Aufgenommenen auch noch in anderer Weise, als
lediglich durch Pflege und Heilung seiner selbst, eine
höchst humane Mission erfüllen. Den grossen, ja unermesslichen
Segen der Spitäler, nach jener einfach-curativen
Richtung hin, verdankt die Menschheit ursprünglich,
wie schon erwähnt, nicht dem heidnischen Alterthume
der Classicität, auch nicht dem Judenthums 7), sondern, wie
jetzt hinzuzufügen ist, ausschliesslich dem mildern Walten
jener zwei Religionen, die, weil sie beide ausdrücklich
Liebe gegen die Mitgeschöpfe predigen, auch beide,
unabhängig von einander, die Pflege der Armen und
Kranken zum ausdrücklichen Gebote erhoben haben, —
dem Geiste des Buddhismus und des Christenthumes!
Der Buddhismus, der, beiläufig bemerkt, den Gedanken
des Spitales nicht nur für den kranken Menschen, sondern
in der Folge auch für das kranke Thier verwirklichte,
hat als die ältere der beiden Religionen auch
die älteren Spitäler gehabt. Schon 200 Jahre nach
dem Auftreten des Buddha, also im fünften Jahrhunderte
vor unserer Zeitrechnung, sollen auf Ceylon 8) öffentliche
Krankenhäuser von menschenfreundlichen Fürsten gestiftet
worden sein; zu Beginne der christlichen Aera
existirten solche in ganz Hindostan, in Kashmir 9)
und andern buddhistischen Ländern, während die Geschichte
des christlichen Krankenhauses erst mit dem
Jahre 370 nach Christi Geburt, mit der Gründung der
Basilias, der ehrwürdigen Schöpfung des heiligen Basilius,
Bischofs zu Caesarea in Cappadocien, ihren Anfang
wünschte, als das in Krankheit und Armuth gegebene
und vorhandene Elend zu lindern, und dass die mehr
rationelle Idee ihr zunächst und auf sehr lange hin
noch völlig transcendent war, es lasse sich an einem
also Aufgenommenen auch noch in anderer Weise, als
lediglich durch Pflege und Heilung seiner selbst, eine
höchst humane Mission erfüllen. Den grossen, ja unermesslichen
Segen der Spitäler, nach jener einfach-curativen
Richtung hin, verdankt die Menschheit ursprünglich,
wie schon erwähnt, nicht dem heidnischen Alterthume
der Classicität, auch nicht dem Judenthums 7), sondern, wie
jetzt hinzuzufügen ist, ausschliesslich dem mildern Walten
jener zwei Religionen, die, weil sie beide ausdrücklich
Liebe gegen die Mitgeschöpfe predigen, auch beide,
unabhängig von einander, die Pflege der Armen und
Kranken zum ausdrücklichen Gebote erhoben haben, —
dem Geiste des Buddhismus und des Christenthumes!
Der Buddhismus, der, beiläufig bemerkt, den Gedanken
des Spitales nicht nur für den kranken Menschen, sondern
in der Folge auch für das kranke Thier verwirklichte,
hat als die ältere der beiden Religionen auch
die älteren Spitäler gehabt. Schon 200 Jahre nach
dem Auftreten des Buddha, also im fünften Jahrhunderte
vor unserer Zeitrechnung, sollen auf Ceylon 8) öffentliche
Krankenhäuser von menschenfreundlichen Fürsten gestiftet
worden sein; zu Beginne der christlichen Aera
existirten solche in ganz Hindostan, in Kashmir 9)
und andern buddhistischen Ländern, während die Geschichte
des christlichen Krankenhauses erst mit dem
Jahre 370 nach Christi Geburt, mit der Gründung der
Basilias, der ehrwürdigen Schöpfung des heiligen Basilius,
Bischofs zu Caesarea in Cappadocien, ihren Anfang
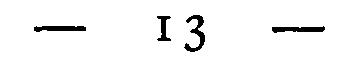 nimmt 10). Dieses grossartige Werk christlicher Liebe
war, der Beschreibung nach, nicht ein einzelnes Haus,
sondern eine ganze Krankenstadt, jedenfalls aber das
erste seiner Art in christlichen Landen; rasch breitete
sich allerdings von nun an die einmal eingeleitete Bewegung
für Errichtung solcher Anstalten der ganzen
damaligen Christenheit mit, aber weder hier zunächst,
noch auch früher auf buddhistischem Gebiete verlautet
irgend etwas davon, dass die Spitäler auch gleichzeitig
als Kliniken verwendet worden seien. Der in das Spital
aufgenommene Kranke war und blieb vorderhand eben
ausschliesslich Object liebevoller und heilender Bemühung,
—also reines Passivum; — dass er ausserdem auch noch
sehr wohl in gewissem Sinne Activum, oder richtiger
gesagt, Medium, nämlich Vermittler heilkräftiger Lehre
und Träger heilbegehrender Forschung sein könne, daran
dachte von den frommen Stiftern und Erhaltern dieser
Anstalten in der That noch lange Niemand!
nimmt 10). Dieses grossartige Werk christlicher Liebe
war, der Beschreibung nach, nicht ein einzelnes Haus,
sondern eine ganze Krankenstadt, jedenfalls aber das
erste seiner Art in christlichen Landen; rasch breitete
sich allerdings von nun an die einmal eingeleitete Bewegung
für Errichtung solcher Anstalten der ganzen
damaligen Christenheit mit, aber weder hier zunächst,
noch auch früher auf buddhistischem Gebiete verlautet
irgend etwas davon, dass die Spitäler auch gleichzeitig
als Kliniken verwendet worden seien. Der in das Spital
aufgenommene Kranke war und blieb vorderhand eben
ausschliesslich Object liebevoller und heilender Bemühung,
—also reines Passivum; — dass er ausserdem auch noch
sehr wohl in gewissem Sinne Activum, oder richtiger
gesagt, Medium, nämlich Vermittler heilkräftiger Lehre
und Träger heilbegehrender Forschung sein könne, daran
dachte von den frommen Stiftern und Erhaltern dieser
Anstalten in der That noch lange Niemand!
Nur auf anderem Boden begegnen wir während des Mittelalters Beweisen dafür, dass die Spitäler, ausser ihrer eigentlichen Bestimmung, auch dem Unterrichte dienten und autorisirte Stätten wissenschaftlicher Forschung waren. Dieser Boden ist interessanter Weise geographisch so gelegen und nach Geschichte, wie Cultur so geartet, dass auf ihm christlich-griechische und buddhistisch-indische Einflüsse sehr leicht sich treffen, ja mit einander vermischen konnten, und dass er selbst trotzdem beiden gegenüber dauernd seine völlige Neutralität zu behaupten vermochte. Historisch handelt es sich kurz um folgende, etwas verwickelte Ereignisse:
Nestorianische Christen 11) werden um ihres Glaubens willen, weil sie die Einheit der göttlichen und der
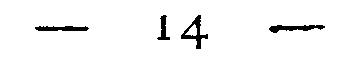 menschlichen Natur Christi leugnen, namentlich aber
der gebenedeiten Mutter des Herrn den Namen »
Gottesgebärerin« versagen, auf der Synode zu Ephesus
431 nach Christo als Ketzer verdammt, daraufhin Jahrzehnte
hindurch von den byzantinischen Kaisern auf
das Heftigste verfolgt, und finden endlich, nach vielen
Drangsalen, um die Wende des fünften Jahrhunderts
gastfreie Aufnahme in Persien, das damals noch parsisch,
das heisst noch nicht, wie jetzt, schiitisch-mahomedanisch
war. Hier unter der letzten Sassaniden Herrschaft
gründen die Fremdlinge, die grossentheils gelehrte Leute
sind, Schulen, auf welchen sie vor Allem natürlich ihre
Theologie, daneben aber auch allerlei profane Wissenschaft,
— namentlich griechische Medicin — lehren.
Hier entstehen aber auch auf ihren Antrieb hin Spitäler
nach christlichem Muster, deren Leitung zwar vorzugsweise
sie selbst übernehmen, an denen ausserdem jedoch
in der Folge wiederholt auch noch buddhistische Aerzte
aus dem benachbarten Indien 12) wirken und ihre heimische
Medicin zu hohem Ansehen bringen. Das wichtigste
dieser Spitäler ist dasjenige zu Dschondisapor 13)
im heutigen Khuzistan, welches drei Jahrhunderte hindurch,
unter wesentlich gleicher Verfassung, insbesondere
unter christlich-nestorianischer Führung, fortbesteht und
zur höchsten Blüthe gedeiht, als inzwischen Persien selbst
bereits längst eine Beute der mahomedanischen Eroberung
(unter Omar) geworden ist. Dort nun zu Dschondisapor,
— auf ursprünglich parsischem Religionsgebiete
der Zend-Avesta, aus gemeinsamer Beisteuer indessen
von Christenthum und Buddhismus erstellt, aber wohl
erst unter dem Scepter des Islam vollendet, — stand
allem Anscheine nach die Wiege der Spitalklinik, denn
menschlichen Natur Christi leugnen, namentlich aber
der gebenedeiten Mutter des Herrn den Namen »
Gottesgebärerin« versagen, auf der Synode zu Ephesus
431 nach Christo als Ketzer verdammt, daraufhin Jahrzehnte
hindurch von den byzantinischen Kaisern auf
das Heftigste verfolgt, und finden endlich, nach vielen
Drangsalen, um die Wende des fünften Jahrhunderts
gastfreie Aufnahme in Persien, das damals noch parsisch,
das heisst noch nicht, wie jetzt, schiitisch-mahomedanisch
war. Hier unter der letzten Sassaniden Herrschaft
gründen die Fremdlinge, die grossentheils gelehrte Leute
sind, Schulen, auf welchen sie vor Allem natürlich ihre
Theologie, daneben aber auch allerlei profane Wissenschaft,
— namentlich griechische Medicin — lehren.
Hier entstehen aber auch auf ihren Antrieb hin Spitäler
nach christlichem Muster, deren Leitung zwar vorzugsweise
sie selbst übernehmen, an denen ausserdem jedoch
in der Folge wiederholt auch noch buddhistische Aerzte
aus dem benachbarten Indien 12) wirken und ihre heimische
Medicin zu hohem Ansehen bringen. Das wichtigste
dieser Spitäler ist dasjenige zu Dschondisapor 13)
im heutigen Khuzistan, welches drei Jahrhunderte hindurch,
unter wesentlich gleicher Verfassung, insbesondere
unter christlich-nestorianischer Führung, fortbesteht und
zur höchsten Blüthe gedeiht, als inzwischen Persien selbst
bereits längst eine Beute der mahomedanischen Eroberung
(unter Omar) geworden ist. Dort nun zu Dschondisapor,
— auf ursprünglich parsischem Religionsgebiete
der Zend-Avesta, aus gemeinsamer Beisteuer indessen
von Christenthum und Buddhismus erstellt, aber wohl
erst unter dem Scepter des Islam vollendet, — stand
allem Anscheine nach die Wiege der Spitalklinik, denn
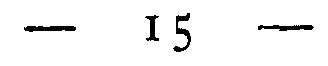 ausdrücklich heisst es von den Schülern der Medicin
daselbst im achten Jahrhundert, dass sie, wohnend im
Weichbilde des Krankenhauses, auch ihre medicinische
Ausbildung im Spitale selbst 14) erhielten. Wäre nicht
diese erste Begründung der Spitalklinik hier, im fernen
Oriente, im Grunde genommen doch nur ein so höchst
minimer Bruchtheil der gesammten menschlichen Culturarbeit,
— ein Differential dieses gewaltigen Integrales,
— und wäre nicht namentlich leider die damals erzielte
Frucht nur von ziemlich vorübergehender Lebenskraft
gewesen, man könnte wirklich, Angesichts einer so
complicirten Assistenz bei ihrer Geburt an den Ausruf
Virgil's 15) denken:
ausdrücklich heisst es von den Schülern der Medicin
daselbst im achten Jahrhundert, dass sie, wohnend im
Weichbilde des Krankenhauses, auch ihre medicinische
Ausbildung im Spitale selbst 14) erhielten. Wäre nicht
diese erste Begründung der Spitalklinik hier, im fernen
Oriente, im Grunde genommen doch nur ein so höchst
minimer Bruchtheil der gesammten menschlichen Culturarbeit,
— ein Differential dieses gewaltigen Integrales,
— und wäre nicht namentlich leider die damals erzielte
Frucht nur von ziemlich vorübergehender Lebenskraft
gewesen, man könnte wirklich, Angesichts einer so
complicirten Assistenz bei ihrer Geburt an den Ausruf
Virgil's 15) denken:
»Tantae molis erat, Romanam condere gentem!«
Ganz ephemer und räumlich eng-umgrenzt war übrigens ihr Dasein keineswegs, denn wesentlich diesen in Persien erhaltenen Eindrücken von dem Nutzen der Spitäler als Heil- und Lehranstalten ist es zuzuschreiben, dass sofort auch die Nachfolger des Propheten, die Khalifen, im richtigen Verständnisse dessen, was Noth that, mit Eifer selbst die Gründung von Krankenhäusern und medicinischen Schulen betrieben. So entstanden vom achten bis dreizehnten Jahrhunderte an den Hauptsitzen des weiten mahomedanischen Machtgebietes, zu Bagdad, Damaskus, Cairo und verschiedenen anderen Orten ziemlich zahlreiche, zum Theil grossartige Spitäler, von denen manche, namentlich das 1283 von El-mansur in Cairo gegründete 16), gleichzeitig auch Unterrichtsanstalten waren und sogar öffentliche poliklinische Ambulatorien besassen. Es erhellt demnach, dass während der Blüthezeit arabischer Cultur auf mahomedanischer Seite mancherorts Einrichtungen zu Stande kamen, die denjenigen
unserer heutigen öffentlichen Klinik und ambulatorischen Poliklinik wahrscheinlich in der Hauptsache glichen; im Uebrigen aber blieb auch bei den Arabern bis zum Niedergange ihrer Macht und Civilisation, der Privatunterricht ausserhalb des Spitals, also die rein-private Poliklinik die Hauptquelle practischer medicinischer Ausbildung.
Und vollends im christlichen Abendlande ist von einer Benutzung des Krankenhauses zu Unterrichtszwecken, ferner von öffentlichen poliklinischen Ambulatorien noch während des ganzen Mittelalters nicht merklich die Rede. Denn weder zu Salerno, noch zu Montpellier, — Namen, die der Mediciner und vornehmlich der Kliniker nie anders, denn mit Ehrfurcht nennen wird! — haben Spitalkliniken während dieser Periode existirt, wahrscheinlich auch nicht öffentliche Ambulatorien, so hoch man auch speciell dort, inmitten zunehmender Erstarrung ringsumher, das Banner klinischer Medicin in trüber Zeit hochgehalten hat, und so eifrig man, entgegen sonstiger Vernachlässigung, gerade an diesen beiden Sitzen mittelalterlich-ärztlicher Gelehrsamkeit und Kunst auf die practische Ausbildung ihrer Jünger Bedacht nahm. Von den übrigen Universitäten, soweit deren Stiftung noch in das eigentliche Mittelalter und in die Blüthezeit der Scholastik hinabreicht, ist medicinischerseits am Besten zu schweigen, Anderes wenigstens kaum zu vermelden, als dass Hippokrates daselbst beinahe vergessen, an seine Stelle Galen und des Letzteren allergetreuester Schildknappe Avicenna getreten war, und dass die rund in sich abgeschlossene Doctrin dieser Beiden fast das einzige Thema im Tretrade der Collegien und Disputationen bildete. Medicin
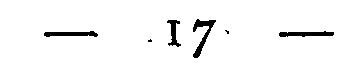 am Krankenbette zu treiben, oder gar zu lehren, galt
hier als abgeschmackt und Sache geringerer Leute; wen
dennoch unter der Jugend nach solchem minderen Tranke
dürstete, der mied diese academischen Schankstätten des
Wissens, ging privatim zum bescheidenen Medicus oder Chirurgus
in die Lehre, oder versuchte wohl auch oft ohne jede
Anleitung gleich selbstständig, als Naturarzt, sein Glück!
am Krankenbette zu treiben, oder gar zu lehren, galt
hier als abgeschmackt und Sache geringerer Leute; wen
dennoch unter der Jugend nach solchem minderen Tranke
dürstete, der mied diese academischen Schankstätten des
Wissens, ging privatim zum bescheidenen Medicus oder Chirurgus
in die Lehre, oder versuchte wohl auch oft ohne jede
Anleitung gleich selbstständig, als Naturarzt, sein Glück!
Dem Föhne gleich, der winterliches Eis bricht, braust nun die grosse Zeit der Renaissance heran und über die gealterte Welt; sie haucht auch der greisenhaft-gewordenen academischen Medicin frisches Leben, ihren Vertretern an Hochschulen vor Allem die Erkenntniss ein, dass sie selbst unwürdige Sclavenketten tragen und dass Befreiung Noth thue! An dem neuerwachten Studium des Hippokrates, des Altmeisters empirisch-ärztlicher Methode, entzündet sich lebhafter, denn je zuvor, der Forschungstrieb und wird zur brennenden Begierde nach neuer, nach möglichst gehäufter Erfahrung: Der Lehrer der Anatomie secirt, Anfangs heimlich, zum ersten Male wieder seit fast 2000 Jahren (nämlich seit der ägyptischen Ptolemäer Zeiten) menschliche Leichen, und fördert bei diesen Untersuchungen binnen Kurzem eine fast erschreckliche Fülle vordem unbekannter Thatsachen zu Tage; der Pathologe findet seinen Weg zum Kranken wieder, untersucht, publicirt, treibt sogar medicinische Statistik 17), — das ist die, baslerischem Gedächtnisse unvergessliche Zeit von Paracelsus, Vesal, Felix Platter, Bauhin, — das ist aber auch die Zeit, wo, jenseits unserer Alpen, das Krankenhaus auf einmal dem Unterrichte sich öffnet, und auf abendländischem Boden, sowie am Sitze einer Universität die erste Spitalklinik ersteht!
Aber, als habe zum Schmieden eines solchen Rüstzeuges das Feuer der Alten gewissermaassen doch nicht ausgereicht und sei noch frischere Gluth nöthig gewesen, das Werk. zu fördern, die Gründung dieser ersten Universitätsklinik erfolgt nicht etwa aus Erkenntniss der Lehrer, sondern auf Andringen der Schüler. Es ist die wissensdurstige academische Jugend, welche, der trockenen Kathederdiät satt, mit Ungestüm die Klinik heischt, — es sind deutsche Studenten — auf italischer Erde die Schmiede!
Im Jahre 1578 stellen nämlich die Studirenden der germanischen Nation zu Padua 18) das nicht misszuverstehende Gesuch, es möchten doch die beiden Herren Professoren der Medicin Albertino Bottoni und Marco degli Oddi, welche beide zuvor Aerzte am Hospitals des heiligen Franciscus geworden waren, ihnen die Vorträge über Krankheiten fortan am Krankenbette selbst, im Spitale, halten, — auch dann und wann wenigstens ihnen einmal eine Leiche öffnen, damit man doch den rechten Sitz der Krankheit sehe und erfahre! — Dem sonderbaren Begehren der nordischen Strudelköpfe wird, weil es im Grunde doch nicht so gar unvernünftig lautet, nach einigem Bedenken gewillfahrt, und die Klinik ist nun für's Erste da: Albertino Bottoni hält sie auf der Männerabtheilung, Marco degli Oddi auf der Weiberabtheilung des Spitales, — auch Sectionen werden kurze Zeit hindurch gemacht, bis leider der Nebenbuhler beider Docenten, Aemilio CampoIongo, welcher die gleiche Venia für sich erwirkt hatte, durch rücksichtsloses Heimtragen pathologisch-anatomischer Präparate vom Leichentische öffentliches Aergerniss erregt, und auf das Klagen einiger älterer Damen (»anicularum querelis ad praefectum
 delatis«, wie es beim Gewährsmanne dieser
Vorgänge, Tomasini, heisst) Seitens hoher Obrigkeit
von Padua das Seciren den Herren Professoren wieder
untersagt wird.
delatis«, wie es beim Gewährsmanne dieser
Vorgänge, Tomasini, heisst) Seitens hoher Obrigkeit
von Padua das Seciren den Herren Professoren wieder
untersagt wird.
Und auch die Klinik selbst sollte vorerst noch nicht im Leben der Universitäten dauernd Fuss fassen; zwar bestand sie in Padua noch eine Weile fort, auch wurden sogar bald darauf noch in analoger Weise Spitalcurse zu Pavia und zu Genua eingerichtet, und es konnte demnach für den Moment vielleicht so scheinen, als wolle das Institut in Italien überhaupt sich einbürgern.. Aber das Feuer war dort leider doch nur Strohfeuer, die Zeit ferner zur sicheren Fundirung der Universitätsklinik wohl auch noch nicht ganz reif; mit einem Worte, der anfänglich so rege Eifer bei Lehrenden und Lernenden erkaltete allmälig wieder, und das endliche Schicksal dieser ersten italienischen Kliniken war bedauerlicher Weise Verkümmerung.
Durchschlagend hingegen und in seiner Nachwirkung ganz universell war der Erfolg, den die Einführung öffentlichen klinischen Unterrichtes etwa 60 Jahre später in Holland errang, —jenem Alluvium mit seinen Deichen und seinen dem Meere abgerungenen Marschen, seiner so thatkräftigen und vor Allem so zähen Bevölkerung, auf welchem, nach Abschüttlung des spanischen Joches, nach Erlangung der nationalen und religiösen Unabhängigkeit, alsbald auch eine so reiche und mannigfaltige Culturblüthe sich erschloss! Grosses war aber inzwischen auch anderswo auf dem Gebiete des Geistes geschehen, um die Gemüther einer Umgestaltung des ärztlichen Unterrichtes im Sinne der academischen Klinik günstig zu stimmen: In England hatte Baco von
Verulam's Lehre der inductiven Methode für alle Gebiete physischer Forschung den Sieg verschafft und den Sinn denkender Naturforscher und Aerzte von nun an definitiv auf Beobachtung und Versuch, als die ergiebigsten Quellen dieser Art von Erkenntniss, gelenkt; von England aus kam auch, gewissermaassen als erste Werthprobe des neuerrungenen Standpunktes, im zweiten Decennium des siebzehnten Jahrhunderts die staunenerregende Kunde von der fundamentalen physiologischen Entdeckung des Blutkreislaufes durch William Harwey und das gleichfalls durch Beobachtung gezeitigte, in seiner Einfachheit so grandiose Dictum des gleichen Forschers: »Omne vivum ex ovo!« — Kein Wunder darum wohl, wenn der von philosophischer, wie physiologischer Seite ergangene, so laute und eindringliche Appell: »Suchet und versuchet, achtet und beobachtet!« auch im Lager der Pathologen gehört wurde, und bei letzteren jetzt den Wunsch wachrief, für Lehre und Forschung auf dem Gebiete des kranken Lebens in der erneuten Begründung von Spitalkliniken ein möglichst geeignetes Uebungs- und Recognoscirungsterrain sich zu schaffen! Practische Gestalt nahm diese in eminentem Maasse damals zeitgemässe Idee wie gesagt, zuerst in den Niederlanden, — zu Lug dunum Batavorum, jenem Leyden, das erst vor nicht langer Zeit (1575) sich als Lohn für die mannhafte und siegreiche Vertheidigung seiner Bürger gegen die belagernden Truppen des spanischen Statthalters Requesenz von der holländischen Nation eine Universität ausgebeten hatte! Hier nun, auf doppelt geweihtem Boden, auf dieser Walstatt patriotischen Muthes und wissenschaftlicher Begeisterung hat um 1640 der Professor Otto Heurnius, zuerst unter
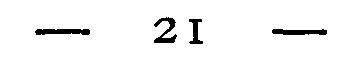 dem bescheideneren Namen »Collegium medicum practicum«
die Klinik sammt Ambulatorium als integrirenden
Bestandtheil des medicinischen Gesammtunterrichtes
eingeführt und dann abwechselnd mit seinem
Collegen Schrewelius geleitet 19)! Hier wirkten nach
ihm Kyper und de le Boë Sylvius; hier aber ging alsdann
um die Wende des Jahrhunderts der leuchtende
Stern des grossen Hermann Boerhaave auf, dessen strahlendem
Glanze die Leydener Klinik in der ersten Hälfte
des achtzehnten Jahrhunderts ihren Weltruf verdankt!
Nicht minder aber verdankt ihm auch die gesammte
wissenschaftliche Medicin die allmälige völlige Popularisirung
der klinischen Idee an den Universitäten, wie
bei den Regierungen; denn Boerhaave's hinreissender
Persönlichkeit und ausserordentlichem Können in ärztlicher,
wie ärztlich-lehrender Beziehung ist es ganz wesentlich
zuzumessen, dass die von ihm verfochtene Idee von der
Nothwendigkeit der Klinik zunächst bei seinen von
ihm begeisterten Schülern, weiterhin aber durch einige
derselben auch bei den eigentlich maassgebenden Kreisen
Eingang fand. Und zwar ist als der weitaus wichtigste
dieser secundären Impulse wohl zweifellos der von Boerhaave's
grösstem und treuestem Schüler Gerhardt van
Swieten, ausgegangene anzusehen, — dem Leibarzte und
Vertrauten der Kaiserin Maria Theresia, dem kühnen
und rücksichtslosen Reformator des österreichischen Medicinalwesens,
— dem Begründer der Universitätsklinik
zu Wien 20)! Denn nach Erringung dieses dominirenden
Postens und nachdem einmal hier, auf dem Boden einer
Weltstadt, die academische Klinik (seit 1753) feste
Wurzeln geschlagen hatte, stand die Institution, als
solche, auch anderswo immer im Vordergrunde der
dem bescheideneren Namen »Collegium medicum practicum«
die Klinik sammt Ambulatorium als integrirenden
Bestandtheil des medicinischen Gesammtunterrichtes
eingeführt und dann abwechselnd mit seinem
Collegen Schrewelius geleitet 19)! Hier wirkten nach
ihm Kyper und de le Boë Sylvius; hier aber ging alsdann
um die Wende des Jahrhunderts der leuchtende
Stern des grossen Hermann Boerhaave auf, dessen strahlendem
Glanze die Leydener Klinik in der ersten Hälfte
des achtzehnten Jahrhunderts ihren Weltruf verdankt!
Nicht minder aber verdankt ihm auch die gesammte
wissenschaftliche Medicin die allmälige völlige Popularisirung
der klinischen Idee an den Universitäten, wie
bei den Regierungen; denn Boerhaave's hinreissender
Persönlichkeit und ausserordentlichem Können in ärztlicher,
wie ärztlich-lehrender Beziehung ist es ganz wesentlich
zuzumessen, dass die von ihm verfochtene Idee von der
Nothwendigkeit der Klinik zunächst bei seinen von
ihm begeisterten Schülern, weiterhin aber durch einige
derselben auch bei den eigentlich maassgebenden Kreisen
Eingang fand. Und zwar ist als der weitaus wichtigste
dieser secundären Impulse wohl zweifellos der von Boerhaave's
grösstem und treuestem Schüler Gerhardt van
Swieten, ausgegangene anzusehen, — dem Leibarzte und
Vertrauten der Kaiserin Maria Theresia, dem kühnen
und rücksichtslosen Reformator des österreichischen Medicinalwesens,
— dem Begründer der Universitätsklinik
zu Wien 20)! Denn nach Erringung dieses dominirenden
Postens und nachdem einmal hier, auf dem Boden einer
Weltstadt, die academische Klinik (seit 1753) feste
Wurzeln geschlagen hatte, stand die Institution, als
solche, auch anderswo immer im Vordergrunde der
 Ueberlegungen, so oft man seitdem die Regeneration.
oder neue Stiftung medicinischer Facultäten an Hochschulen
ernstlich betrieb. Die Klinik gilt, lassen Sie
mich hiermit die historische Uebersicht schliessen, heutzutage
allgemein auf civilisirtem Boden als »Conditio
sine qua non« des ärztlichen Universitätsunterrichtes
und es sind lediglich Fragen untergeordneter Art, Erwägungen
socialer und namentlich financieller Natur gewesen,
ob man sie an den einzelnen Hochschulen im
Laufe der letzten hundert Jahre zuerst nur als bescheidenere
öffentliche Poliklinik, oder zuerst als vornehmere
Spitalklinik, oder endlich auch sofort in beiderlei Form
zugleich eingeführt hat?
Ueberlegungen, so oft man seitdem die Regeneration.
oder neue Stiftung medicinischer Facultäten an Hochschulen
ernstlich betrieb. Die Klinik gilt, lassen Sie
mich hiermit die historische Uebersicht schliessen, heutzutage
allgemein auf civilisirtem Boden als »Conditio
sine qua non« des ärztlichen Universitätsunterrichtes
und es sind lediglich Fragen untergeordneter Art, Erwägungen
socialer und namentlich financieller Natur gewesen,
ob man sie an den einzelnen Hochschulen im
Laufe der letzten hundert Jahre zuerst nur als bescheidenere
öffentliche Poliklinik, oder zuerst als vornehmere
Spitalklinik, oder endlich auch sofort in beiderlei Form
zugleich eingeführt hat?
Und um nun an letzteren Punkt hier unmittelbar anzuknüpfen, so, meine ich, lässt wohl der äusserliche Umstand, dass im Augenblicke selbst die kleinsten Universitäten fast ausnahmslos Beides, stationäre Klinik und Poliklinik besitzen, die Wünschbarkeit der Copulation Beider zu gemeinsamer Arbeit schon von vornherein erahnen. Spitalklinik und Poliklinik schliessen aber auch in der That einander nicht aus, am Allerwenigsten ist ferner letztere, die Poliklinik, ersterer gegenüber etwa nur eine Art Nothbehelf, beziehungsweise eine antiquarische Curiosität, vielmehr sind beide Schwesterinstitute des Entschiedensten auch heute noch dazu berufen, einander wechselseitig zu ergänzen! Denn, obwohl einerlei Stammes und darum im Grunde Eins, stellen sie doch das in sich einheitliche Leben der Klinik, — die Combination von Heilen, Lehren und Forschen — unter verschiedenen äussern Lebensbedingungen als entsprechend modificirte Leistung dar. Vermag die stationäre Klinik des Spitales auf ihrem räumlich-beschränkteren
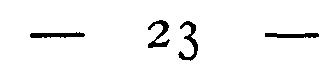 Arbeitsfelde die curative Thätigkeit dem einzelnen
Kranken allerdings wohl systematischer, mit grösserer
Auswahl der Mittel und stricterer Benutzung der Gelegenheit,
angedeihen zu lassen, und ist sie darum vorwiegend
die gewünschte Zufluchtsstätte schwererer und
complicirterer Erkrankungsfalle, so kann umgekehrt, aber
in ebenso erwünschter Weise, die Poliklinik ihr mehr summarisches
therapeutisches Verfahren auf eine weit grössere
Zahl von leidenden Individuen, namentlich leichter Erkrankten
ausdehnen. Und wenn es ferner der Spitalklinik vor
Allem zukommt, auch die beiden anderen Actionen des
klinischen Lebens — Lehre und Forschung — mehr zu
vertiefen und im Einzelnen vollendeter zu gestalten,
so ist dafür die Poliklinik der geeignetere Boden für
solche Unterweisung und Erkenntniss, die sich auf
Massenuntersuchung stützt und durch Massenbeobachtung
gewinnen lässt. Speciell noch was den Unterricht anlangt,
um dessentwillen ja vor allen Dingen beide Institute
gegenwärtig als academisch-medicinische Anstalten
an den Universitäten bestehen und vom Staate subventionirt
werden, so lässt sich freilich nicht leugnen, dass
die methodisch-strenge, mehr classische Schulung der
stationären Klinik dem Jünger der Heilkunde, dem
Studirenden, wohl in erster Reihe frommt; aber eben
deswegen soll die Spitalklinik auch von ihm zuerst besucht
und zugleich am längsten frequentirt werden.
Dann jedoch, wenn bei ihm ein gewisses Fundament der
Kenntniss und des Könnens bereits besteht, soll auch,
wenn möglich, die Poliklinik kommen und das Werk
klinischer Erudition an ihm vollenden helfen, nach ihrer
bisher charakterisirten Richtung hin zunächst, aber weiterhin
auch noch in einer ganz anderen, höchst wesentlichen
Arbeitsfelde die curative Thätigkeit dem einzelnen
Kranken allerdings wohl systematischer, mit grösserer
Auswahl der Mittel und stricterer Benutzung der Gelegenheit,
angedeihen zu lassen, und ist sie darum vorwiegend
die gewünschte Zufluchtsstätte schwererer und
complicirterer Erkrankungsfalle, so kann umgekehrt, aber
in ebenso erwünschter Weise, die Poliklinik ihr mehr summarisches
therapeutisches Verfahren auf eine weit grössere
Zahl von leidenden Individuen, namentlich leichter Erkrankten
ausdehnen. Und wenn es ferner der Spitalklinik vor
Allem zukommt, auch die beiden anderen Actionen des
klinischen Lebens — Lehre und Forschung — mehr zu
vertiefen und im Einzelnen vollendeter zu gestalten,
so ist dafür die Poliklinik der geeignetere Boden für
solche Unterweisung und Erkenntniss, die sich auf
Massenuntersuchung stützt und durch Massenbeobachtung
gewinnen lässt. Speciell noch was den Unterricht anlangt,
um dessentwillen ja vor allen Dingen beide Institute
gegenwärtig als academisch-medicinische Anstalten
an den Universitäten bestehen und vom Staate subventionirt
werden, so lässt sich freilich nicht leugnen, dass
die methodisch-strenge, mehr classische Schulung der
stationären Klinik dem Jünger der Heilkunde, dem
Studirenden, wohl in erster Reihe frommt; aber eben
deswegen soll die Spitalklinik auch von ihm zuerst besucht
und zugleich am längsten frequentirt werden.
Dann jedoch, wenn bei ihm ein gewisses Fundament der
Kenntniss und des Könnens bereits besteht, soll auch,
wenn möglich, die Poliklinik kommen und das Werk
klinischer Erudition an ihm vollenden helfen, nach ihrer
bisher charakterisirten Richtung hin zunächst, aber weiterhin
auch noch in einer ganz anderen, höchst wesentlichen
 Beziehung! Denn endlich, — stellt die stationäre
Klinik des Spitals das klinische Leben, geborgen unter
dem sicheren Dache des wirthlichen und freundlichen
Hauses dar, — so ist dafür die Poliklinik, vor Allem,
wenn sie nicht bbs Sprechstunden ertheilt, sondern die
Armen und Kranken auch in deren eigenen Wohnungen
aufsucht, dieses nämliche klinische Leben als »Medicina
militans«, im Kampfe mit socialem Elende und beschränkten
Mitteln, — mit Unverstand häufig auch und
Indolenz, — im Kampfe also mit allerlei feindlichen und
finsteren Mächten, an denen aber der künftige Arzt
schon während seiner Lehrzeit gut thut, seine Kraft
und seine Gelenkigkeit recht fleissig zu üben!
Beziehung! Denn endlich, — stellt die stationäre
Klinik des Spitals das klinische Leben, geborgen unter
dem sicheren Dache des wirthlichen und freundlichen
Hauses dar, — so ist dafür die Poliklinik, vor Allem,
wenn sie nicht bbs Sprechstunden ertheilt, sondern die
Armen und Kranken auch in deren eigenen Wohnungen
aufsucht, dieses nämliche klinische Leben als »Medicina
militans«, im Kampfe mit socialem Elende und beschränkten
Mitteln, — mit Unverstand häufig auch und
Indolenz, — im Kampfe also mit allerlei feindlichen und
finsteren Mächten, an denen aber der künftige Arzt
schon während seiner Lehrzeit gut thut, seine Kraft
und seine Gelenkigkeit recht fleissig zu üben!
»Theuer ist mir der Freund, — doch auch den Feind / kann ich nützen; Zeigt mir der Freund, was ich kann, — lehrt mich der Feind, was ich soll!«21)
Es liegt mir nunmehr noch ob, in Kürze auf die drei Lebensfunctionen der Klinik: Therapeutik als solche, klinische Lehre und klinische Forschung, der Reihe nach einzeln einzugehen, zugleich aber allerdings auch, dieselben in ihren gegenseitigen Beziehungen zu einander allgemein zu kennzeichnen. Da diese drei Thätigkeiten vermöge der harmonischeren Lebensbedingungen, unter denen die Spitalklinik arbeitet, auch in ihr zu einer mehr harmonischen Ausbildung gelangen, überdies ferner das Bild jener das übersichtlichere ist, so lege ich meiner weiteren Besprechung vornehmlich sie, — die stationäre Klinik, oder »Klinik« schlechthin, — zu Grunde:
Die curative Thätigkeit der Klinik, oder die klinische Therapeutik, ist das lebendige Substrat klinischen
 Wesens, die Voraussetzung sonstiger klinischer
Action überhaupt, wenn schon nicht in gleichem Maasse,
wie zum Beispiele der Unterricht, das unterscheidende
Merkmal der Klinik! Als Grundsätze der klinischen
Therapie gelten nämlich ganz die gleichen, welche auch
für das ärztliche Handeln sonst die maassgebenden sein
sollen, im Allgemeinen also folgende:
Wesens, die Voraussetzung sonstiger klinischer
Action überhaupt, wenn schon nicht in gleichem Maasse,
wie zum Beispiele der Unterricht, das unterscheidende
Merkmal der Klinik! Als Grundsätze der klinischen
Therapie gelten nämlich ganz die gleichen, welche auch
für das ärztliche Handeln sonst die maassgebenden sein
sollen, im Allgemeinen also folgende:
Der neu in die Behandlung aufgenommene Patient wird zuvörderst bezüglich seines physischen Verhaltens sorgfältig ausgefragt und thunlichst genau untersucht. Die mündliche Nachfrage, oder Anamnese, erstreckt sich nicht allein auf das unmittelbar. Vorliegende, die Krankheit mit ihren Ursachen und bisherigem Verlaufe, sondern auch auf die gesammten Antecedentien und Accidentien des Falles; — die objective Untersuchung, oder Aufnahme des Status praesens, befasst sich desgleichen nicht allein mit dem muthmaasslich afficirten Theile, sondern, so weit dies irgend ausführbar, mit dem gesammten Individuum in allen dessen einzelnen Theilen; die Untersuchung selbst endlich geschieht mit Zuhilfenahme aller derjenigen Technicismen, die die neuere Medicin dem Arzte hierzu bekanntlich in so reicher Menge zur Verfügung stellt. Erst auf diesem Fundamente, gestützt ferner noch von Diagnose und prognostischer Erwägung, soll und kann in. der Regel überhaupt auch nur das intellectuelle Bauwerk der Therapie erstehen, als dessen leitende Ideen, oder Indicationen namentlich zu gelten haben: erstens, Bekämpfung der. erkannten Krankheitsursachen und Erhöhung der Widerständigkeit des Patienten gegenüber diesen Ursachen — »Indicatio causalis;« — zweitens, directe Ausgleichung der erkannten krankhaften Störung als solcher
 und in ihrer Totalität — »Indicatio morbi;« —.
lich drittens, Bekämpfung einzelner, besonders lästiger,
oder besonders gefährlicher Krankheitssymptome
— »Indicatio symptomatica,« »Indicatio vitalis.« Welchen
von diesen Indicationen sodann im einzelnen Falle
vornehmlich genügt werden muss, oder aber auch nur
noch genügt werden kann, richtet sich begreiflicherweise
ganz nach Form und Schwere der zu behandelnden
Störung, ebenso auch die Wahl und die Zahl der
zum Bau der Therapie aufzubietenden Mittel und Eingriffe,
die in ihrer einsichtig gewählten Combination den
concreten Curplan, in ihrer methodischen Anwendung
aber die Cur ausmachen. Und was dann endlich noch
diese Bausteine selbst, die einzelnen Heilagentien, anlangt,
so beruht ihre Brauchbarkeit, oder ihr therapeutischer
Werth, in letzter Instanz natürlich immer auf ihren natürlichen,
das heisst: physicalischen, chemischen oder
physiologischen Eigenschaften und Besonderheiten;
eine andere Frage ist jedoch die, ob auch die Art des
Zusammenhanges zwischen Ursache und Wirkung, zwischen
Anwendung des Heilagens und beobachtetem, beziehungsweise
erhofftem Heileffecte, aus der sonstigen
Natur des Mittels oder Eingriffes auf naturwissenschaftlichem
Wege erklärbar, —oder die Heilwirkung als solche
bis auf Weiteres rein nur Sache äusserlicher Erfahrung
ist? Man unterscheidet hiernach rationelle und empirische
Verordnungen, von denen die ersteren vor den
letzteren den unbestreitbaren Vorzug besitzen, dass
eben auch das »Wie?« und das »Warum?« der Wirkung
bei jenen dem physicalischen, chemischen oder physiologischen
Verständnisse bereits erschlossen ist, darum
aber auch diese Wirkung selbst im Ganzen weit besser
und in ihrer Totalität — »Indicatio morbi;« —.
lich drittens, Bekämpfung einzelner, besonders lästiger,
oder besonders gefährlicher Krankheitssymptome
— »Indicatio symptomatica,« »Indicatio vitalis.« Welchen
von diesen Indicationen sodann im einzelnen Falle
vornehmlich genügt werden muss, oder aber auch nur
noch genügt werden kann, richtet sich begreiflicherweise
ganz nach Form und Schwere der zu behandelnden
Störung, ebenso auch die Wahl und die Zahl der
zum Bau der Therapie aufzubietenden Mittel und Eingriffe,
die in ihrer einsichtig gewählten Combination den
concreten Curplan, in ihrer methodischen Anwendung
aber die Cur ausmachen. Und was dann endlich noch
diese Bausteine selbst, die einzelnen Heilagentien, anlangt,
so beruht ihre Brauchbarkeit, oder ihr therapeutischer
Werth, in letzter Instanz natürlich immer auf ihren natürlichen,
das heisst: physicalischen, chemischen oder
physiologischen Eigenschaften und Besonderheiten;
eine andere Frage ist jedoch die, ob auch die Art des
Zusammenhanges zwischen Ursache und Wirkung, zwischen
Anwendung des Heilagens und beobachtetem, beziehungsweise
erhofftem Heileffecte, aus der sonstigen
Natur des Mittels oder Eingriffes auf naturwissenschaftlichem
Wege erklärbar, —oder die Heilwirkung als solche
bis auf Weiteres rein nur Sache äusserlicher Erfahrung
ist? Man unterscheidet hiernach rationelle und empirische
Verordnungen, von denen die ersteren vor den
letzteren den unbestreitbaren Vorzug besitzen, dass
eben auch das »Wie?« und das »Warum?« der Wirkung
bei jenen dem physicalischen, chemischen oder physiologischen
Verständnisse bereits erschlossen ist, darum
aber auch diese Wirkung selbst im Ganzen weit besser
für den Einzelfall zweckentsprechend modulirt werden kann. Bei den lediglich empirisch-erprobten Mitteln und Ordinationen hingegen ist nur die Thatsache des guten Effectes in häufigen und analogen Fällen, nicht jedoch der Modus und der Grund der Wirksamkeit festgestellt; die Empfehlung und der weitere Gebrauch solcher Agentien geschieht demnach vorläufig allein auf die Schlussfolgerung des: »Post hoc, propter hoc!« hin, und findet vorderhand auch nur eine gewisse logische, oder genauer gesagt, mathematische Rechtfertigung, nämlich in dem günstigen Facit des »Ad hoc« angestellten Wahrscheinlichkeitscalculs! Dass übrigens, wenn die mathematische Wahrscheinlichkeit des Heileffectes sehr gross ist, der sogenannte »reine Zufall« also für die Erklärung des Sachverhaltes ausgeschlossen werden darf, auch die einfach-empirischen Mittel ihren sehr positiven therapeutischen Werth haben, bedarf wohl nicht der Erwähnung; anderseits erhellt nicht minder, dass auch der Werth rationeller Verordnungen nach positiver Richtung hin stets gewinnt, wenn sie auch zugleich die Feuerprobe der methodischen Statistik mit Erfolg bestehen.
Insofern nun die Klinik thatsächlich meist einen sehr ansehnlichen Bruchtheil ihrer täglichen Arbeit den singulären Lösungen der vorhin kurz skizzirten therapeutischen Aufgaben zuwendet, ist sie auch thatsächlich Heilanstalt, gerade so gut, wie das einfache, nicht klinische Sanatorium, und der mitunter gehörte Vorwurf, es werde an den Kliniken der Gegenwart zwar sehr viel docirt und leider noch viel mehr geforscht, aber zu wenig an's Curiren gedacht, erscheint, in dieser Allgemeinheit ausgesprochen, völlig unzutreffend. Denn wenn auch Lehre und Forschung die Krankenanstalt an sich erst
zur Klinik erheben und ihr die entscheidenden Merkmale der letzteren aufdrücken, so ist doch von einer eigentlichen Verdrängung der Therapie durch Unterricht und Forschen schon um deswillen kaum die Rede, weil beide, direct oder wenigstens indirect, immer die Therapie zum Gegenstande und vor Augen behalten. Denn während am Krankenbette gelehrt und auseinander gesetzt wird, was curirt, und wie curirt werden soll, wird auch daneben stets gezeigt, dass und mit welchem Erfolge die Cur des Patienten wirklich betrieben wird! Und wenn anderseits die klinische Forschung auf Verbesserungen der Therapie sinnt und das Ergebniss grübelnder Speculation umsichtig am Krankenbette verwerthet, so thut sie das aus Erkenntniss der Mängel, die den bisherigen Curen anhafteten, arbeitet sie also gleichfalls auf therapeutisch-durchpflügtem Ackerfelde! Freilich dient nicht jede klinische Lehre und jede klinische Forschung unmittelbar der Therapie, insofern auch ein nicht geringer Theil dieser klinischen Arbeit auf Erörterung oder Ergründung der Krankheitsursachen und Krankheitsvorgänge verwendet wird; aber jede also geleistete Arbeit hat doch schliesslich die Therapie zum Endzwecke, insofern die Heilung oder Besserung der Störung das Wissen von ihren Ursachen und das Begreifen des Processes zu ihren jedenfalls höchst wünschbaren Praemissen zählt. Nur dann, und der Fall wäre ja allerdings auch denkbar, würde jener Vorwurf die Klinik mit Recht treffen, der Kliniker aber damit auch zugleich aufhören, Kliniker zu sein, wenn letzterer mit seiner Lehre und mit seiner Forschung sich dauernd der Therapeutik ganz entfremdete, um irgendwie sonst sich ein phantastisches Wolkenkukuksheim zu gründen. Er
 gliche dann aber auch in der thörichten Vermessenheit
seines Beginnens nicht einmal dem Ikarus der Sage,
der in genialem Auffluge der Sonne zu nahe kam und
jählings stürzte, sondern weit eher jenem sonderbaren
Schwärmer und Ritter von der fragwürdigen Gestalt, der,
auf hohem Baumaste reitend, diesen seinen eigenen
Träger mit geschäftiger Hand und — mit bekanntem Erfolge
vom Stamme loszusägen bemüht ist!
gliche dann aber auch in der thörichten Vermessenheit
seines Beginnens nicht einmal dem Ikarus der Sage,
der in genialem Auffluge der Sonne zu nahe kam und
jählings stürzte, sondern weit eher jenem sonderbaren
Schwärmer und Ritter von der fragwürdigen Gestalt, der,
auf hohem Baumaste reitend, diesen seinen eigenen
Träger mit geschäftiger Hand und — mit bekanntem Erfolge
vom Stamme loszusägen bemüht ist!
Ob freilich die Heilerfolge einer Klinik trotz richtiger Einsicht ihres Leiters und redlichster Bemühungen seiner Gehilfen grosse oder vielleicht doch nur kleine sind, ist eine völlig andere Frage. Denn die Grösse des überhaupt auf therapeutischem Wege Erreichbaren hängt natürlich nicht nur ab von der Güte der Behandlung und dem Verstande der Verständigen, sondern weit mehr leider noch von der Heilbarkeit des Heilobjectes, und wenn also zum Beispiele eine bestimmte Klinik vielleicht zeitweilig, oder dauernd der bevorzugte Sammelplatz desperater, oder wenigstens misslicher Fälle ist, so können auch ihre Heilerfolge nach Aussen hin keine besonders glänzenden sein. In eben dieser Situation befinden sich nun aber in Wahrheit dauernd recht viele Kliniken, namentlich viele Spitalkliniken, und zwar letztere zum Theile schon aus jenen allgemeinen Gründen ärztlicher Politik sowohl, wie, häufiger noch, völlig selbstloser ärztlicher Ueberlegung, vermöge welcher schlimme, complicirte, — namentlich aber von ihrer Umgebung vernachlässigte Erkrankungsfalle, — kurz Fälle mit schlechter oder dubiöser Prognose aus der Privatclientel und Poliklinik gar gern und oft zur weiteren Cur den Spitälern überwiesen werden! Es kommt aber noch ein durchaus anderer Grund hinzu, um diese Sachlage
 zu schaffen, ein Grund, der nicht sowohl das Krankenhaus
als therapeutisches Institut, vielmehr speciell die
Klinik als Klinik angeht und mit den übrigen Aufgaben
dieser letzteren innig zusammenhängt. Ist nämlich die
Krankenanstalt zugleich Klinik, das heisst: Stätte des
Unterrichts und der wissenschaftlichen Forschung, so
darf sie die Zuweisung solcher Fälle mit schlechter
Prognose nicht nur nicht beklagen, sondern muss sie
sogar, innerhalb gewisser Grenzen wenigstens, bisweilen
direct herbeizuführen suchen. Denn es soll ja, was zunächst
den Unterricht betrifft, der junge Mediciner nicht
allein die leichten und mühelos-heilbaren, sondern mindestens
ebenso sehr auch die schweren und schwer-heilbaren
Erkrankungen, ja endlich auch die vorläufig unheilbaren
Störungen in der Klinik aus Erfahrung kennen
lernen; es müssen demnach auch solche Fälle in der
Klinik angemessen vertreten sein und gehörig zur Demonstration
gelangen! — Und weiter endlich, wenn es
als letzte Aufgabe academisch-klinischer Thätigkeit noch
gilt und gelten muss, zu forschen, sowie die Hörer zur
Forschung anzuregen, wo fänden sich wohl würdigere
Reviere der Forschung, als jene, auf denen die bisherige
Therapie noch keine Lorbeeren zu finden wusste? Solche
Ueberlegungen stellen die bedingte Wünschbarkeit der
Aufnahme so erkrankter Patienten in die Klinik wohl
ausser jeden Zweifel; doch darf der hiermit angedeutete
Satz natürlich nicht einfach verallgemeinert, oder die
Unheilbarkeit eines Falles ohne Weiteres als wünschbare
Vorbedingung für dessen Ueberweisung an eine
Klinik — zu Unterrichts- und Forschungszwecken —
proclamirt werden!
zu schaffen, ein Grund, der nicht sowohl das Krankenhaus
als therapeutisches Institut, vielmehr speciell die
Klinik als Klinik angeht und mit den übrigen Aufgaben
dieser letzteren innig zusammenhängt. Ist nämlich die
Krankenanstalt zugleich Klinik, das heisst: Stätte des
Unterrichts und der wissenschaftlichen Forschung, so
darf sie die Zuweisung solcher Fälle mit schlechter
Prognose nicht nur nicht beklagen, sondern muss sie
sogar, innerhalb gewisser Grenzen wenigstens, bisweilen
direct herbeizuführen suchen. Denn es soll ja, was zunächst
den Unterricht betrifft, der junge Mediciner nicht
allein die leichten und mühelos-heilbaren, sondern mindestens
ebenso sehr auch die schweren und schwer-heilbaren
Erkrankungen, ja endlich auch die vorläufig unheilbaren
Störungen in der Klinik aus Erfahrung kennen
lernen; es müssen demnach auch solche Fälle in der
Klinik angemessen vertreten sein und gehörig zur Demonstration
gelangen! — Und weiter endlich, wenn es
als letzte Aufgabe academisch-klinischer Thätigkeit noch
gilt und gelten muss, zu forschen, sowie die Hörer zur
Forschung anzuregen, wo fänden sich wohl würdigere
Reviere der Forschung, als jene, auf denen die bisherige
Therapie noch keine Lorbeeren zu finden wusste? Solche
Ueberlegungen stellen die bedingte Wünschbarkeit der
Aufnahme so erkrankter Patienten in die Klinik wohl
ausser jeden Zweifel; doch darf der hiermit angedeutete
Satz natürlich nicht einfach verallgemeinert, oder die
Unheilbarkeit eines Falles ohne Weiteres als wünschbare
Vorbedingung für dessen Ueberweisung an eine
Klinik — zu Unterrichts- und Forschungszwecken —
proclamirt werden!
Ich komme hiermit zugleich noch direct zur
kurzen Beleuchtung dieser beiden anderen klinischen Functionen selbst, — Lehre und Forschung — zuvörderst zur Frage des klinischen Unterrichtes:
Dass der Lehrinhalt der Klinik kein anderer sein könne als der, an einzelnen Fällen fort und fort zu zeigen, wie man einen Kranken untersuchen müsse, um zu Diagnose und Prognose zu gelangen, wie ferner auf Grund des so gewonnenen Gesammteindruckes die passende Therapie des Falles theoretisch zu construiren sei, und wie man endlich ihre practische Durchführung zu betreiben habe, um zum Ziele zu gelangen, begreift sich von selbst! Soll indessen der Unterricht wirklich fruchtbringend sein, so bedarf er noch gewisser Vorbedingungen und Eigenschaften, als da namentlich sind: eines passend gewählten Krankenstandes erstens, — zweitens: einer zureichenden Vorbildung der klinischen Schüler oder Klinicisten, —endlich drittens: einer guten Unterrichtsmethode Seitens des klinischen Lehrers. Gestatten Sie mir über diese drei Punkte der Reihe nach einige erläuternde Bemerkungen:
Der klinische Krankenstand, oder das Material der Klinik, darf nicht zu spärlich, auch nicht zu monoton sein; denn Zweck der Klinik ist, dass in ihr der Klinicist während des üblichen Turnus der Semester seine Befähigung zum Arzte durch practische Einschulung an hinlänglich vielen und hinlänglich verschiedenartigen Erkrankungsfällen erwerbe. Es pflegen darum auch, in Hinblick auf diesen Zweck, dem klinischen Lehrer Seitens derjenigen Behörden, in deren Machtsphäre der klinische Unterricht sich abspielt, gewisse Freiheiten und Befugnisse eingeräumt zu sein, durch Vergabung von klinischen Freibetten zum Beispiele Patienten für den
 Unterricht heranzuziehen und so den Krankenstand im
Interesse der Lehre grösser und vielseitiger zu gestalten.
Wunsch nur ist, dass diese dem Kliniker eingeräumten
Rechte nicht zu kleine seien, dass er selbst sie ferner
auch immer ausgiebig und zugleich wirklich verständig
benutze, das heisst, was letzteren Punkt anbetrifft, bei
der Auswahl der Fälle für die Klinik nicht allzu sehr
von seinen persönlichen Liebhabereien sich treiben lasse!
Anomal wäre es zum Beispiel, wenn auf einer internen
Klinik, die das grosse Gebiet der sogenannten inneren
Affectionen voll und ganz repräsentiren soll, vorwiegend
nur Magenkrankheiten, oder aber Nervenkrankheiten vorgestellt
würden, blos deswegen, weil sie etwa das Hauptstudium
und therapeutische Steckenpferd des betreffenden
klinischen Lehrers bildeten, — oder wenn auf einer
chirurgischen, einer gynaecologischen Klinik mit einer
sonst schwer-erklärlichen Consequenz nur ganz bestimmte
Operationen müde geritten würden, — diejenigen nämlich,
bei denen etwa der specielle klinische Operateur
immer von Neuem wieder seine ganz besondere Virtuosität
zu entfalten vermöchte! Solche und ähnliche
kleine Schwächen und willkürliche Beschränkungen des
zugewiesenen Machtgebietes sollen natürlich in der einzelnen
Klinik nicht Platz greifen; eine jede soll vielmehr
in der Wahl ihrer Fälle und in dem, was sie dem
Schüler der Reihe nach bietet, sich möglichster Unparteilichkeit
befleissigen, auf dass sie wenigstens dem
Ausschnitte aus dem Gesammtgebiete der Heilkunde,
dessen Namen sie selbst an ihrer Stirne trägt, einigermaassen
vollständig und würdig zum Ausdrucke verhelfe!
Unterricht heranzuziehen und so den Krankenstand im
Interesse der Lehre grösser und vielseitiger zu gestalten.
Wunsch nur ist, dass diese dem Kliniker eingeräumten
Rechte nicht zu kleine seien, dass er selbst sie ferner
auch immer ausgiebig und zugleich wirklich verständig
benutze, das heisst, was letzteren Punkt anbetrifft, bei
der Auswahl der Fälle für die Klinik nicht allzu sehr
von seinen persönlichen Liebhabereien sich treiben lasse!
Anomal wäre es zum Beispiel, wenn auf einer internen
Klinik, die das grosse Gebiet der sogenannten inneren
Affectionen voll und ganz repräsentiren soll, vorwiegend
nur Magenkrankheiten, oder aber Nervenkrankheiten vorgestellt
würden, blos deswegen, weil sie etwa das Hauptstudium
und therapeutische Steckenpferd des betreffenden
klinischen Lehrers bildeten, — oder wenn auf einer
chirurgischen, einer gynaecologischen Klinik mit einer
sonst schwer-erklärlichen Consequenz nur ganz bestimmte
Operationen müde geritten würden, — diejenigen nämlich,
bei denen etwa der specielle klinische Operateur
immer von Neuem wieder seine ganz besondere Virtuosität
zu entfalten vermöchte! Solche und ähnliche
kleine Schwächen und willkürliche Beschränkungen des
zugewiesenen Machtgebietes sollen natürlich in der einzelnen
Klinik nicht Platz greifen; eine jede soll vielmehr
in der Wahl ihrer Fälle und in dem, was sie dem
Schüler der Reihe nach bietet, sich möglichster Unparteilichkeit
befleissigen, auf dass sie wenigstens dem
Ausschnitte aus dem Gesammtgebiete der Heilkunde,
dessen Namen sie selbst an ihrer Stirne trägt, einigermaassen
vollständig und würdig zum Ausdrucke verhelfe!
Ein weiterer Wunsch endlich noch, der sich an den klinischen Krankenstand knüpft, ist der, dass die klinischen
 Patienten den Klinicisten hinlänglich zugänglich,
namentlich auch noch ausserhalb der klinischen Stunde
zugänglich seien. Dieses Desiderat lässt sich am Allgemeinsten
in der Poliklinik verwirklichen, dann nämlich,
wenn die poliklinischen Practicanten nicht nur dem Ambulatorium
beiwohnen, sondern angewiesen sind, für sich
allein die ihnen speciell zugewiesenen Patienten auch
noch in deren Wohnungen regelmässig, nach Arztes
Art, zu besuchen. Vollkommener noch ermöglicht in
den Spitalkliniken es das Institut der sogenannten Hilfsassistenten
oder Famuli, einzelnen, aber immer nur
wenigen Studirenden, für eine gewisse Zeit (gewöhnlich
diejenige eines Semesters) ihre Thätigkeit ganz einer
bestimmten Klinik zu widmen und in dieser Stellung
das zu erringen, was den spätem Arzt so sehr empfiehlt:
das absolute Vertrautsein mit den Intimitäten der Krankenuntersuchung
und Krankenbehandlung. Aber freilich,
diese Vergünstigung kann nicht Vielen zu Theil werden,
und diesen gegenüber geht die Mehrzahl der Klinicisten
aus der Spitalklinik fort und fort relativ leer aus, da im
Uebrigen die Verhältnisse bezüglich der Zugänglichkeit
klinischer Patienten auf den Krankenhäusern ziemlich
schwierig liegen! Man befürchtet von einer allzu grossen
Liberalität, nicht ganz mit Unrecht, allerlei Unzukömmlichkeiten,
namentlich eine Uebervölkerung der Krankensäle
durch untersuchungseifrige Practicanten, welche als
störend für die Patienten, störend für die Hausordnung,
— mit einem Worte, als inopportun bezeichnet wird, und
es auch, bei unvorsichtig-gewährter Licenz, thatsächlich
gar leicht sein würde. Hingegen glaube ich, dass der
mehreren Orts gewagte Versuch, die klinischen Practicanten
ausser zur Klinik, auch noch regelmässig, oder
Patienten den Klinicisten hinlänglich zugänglich,
namentlich auch noch ausserhalb der klinischen Stunde
zugänglich seien. Dieses Desiderat lässt sich am Allgemeinsten
in der Poliklinik verwirklichen, dann nämlich,
wenn die poliklinischen Practicanten nicht nur dem Ambulatorium
beiwohnen, sondern angewiesen sind, für sich
allein die ihnen speciell zugewiesenen Patienten auch
noch in deren Wohnungen regelmässig, nach Arztes
Art, zu besuchen. Vollkommener noch ermöglicht in
den Spitalkliniken es das Institut der sogenannten Hilfsassistenten
oder Famuli, einzelnen, aber immer nur
wenigen Studirenden, für eine gewisse Zeit (gewöhnlich
diejenige eines Semesters) ihre Thätigkeit ganz einer
bestimmten Klinik zu widmen und in dieser Stellung
das zu erringen, was den spätem Arzt so sehr empfiehlt:
das absolute Vertrautsein mit den Intimitäten der Krankenuntersuchung
und Krankenbehandlung. Aber freilich,
diese Vergünstigung kann nicht Vielen zu Theil werden,
und diesen gegenüber geht die Mehrzahl der Klinicisten
aus der Spitalklinik fort und fort relativ leer aus, da im
Uebrigen die Verhältnisse bezüglich der Zugänglichkeit
klinischer Patienten auf den Krankenhäusern ziemlich
schwierig liegen! Man befürchtet von einer allzu grossen
Liberalität, nicht ganz mit Unrecht, allerlei Unzukömmlichkeiten,
namentlich eine Uebervölkerung der Krankensäle
durch untersuchungseifrige Practicanten, welche als
störend für die Patienten, störend für die Hausordnung,
— mit einem Worte, als inopportun bezeichnet wird, und
es auch, bei unvorsichtig-gewährter Licenz, thatsächlich
gar leicht sein würde. Hingegen glaube ich, dass der
mehreren Orts gewagte Versuch, die klinischen Practicanten
ausser zur Klinik, auch noch regelmässig, oder
 wenigstens in gewissem Turnus, zu den abendlichen
Visiten der Aerzte auf den Spitalabtheilungen zuzulassen,
allgemeinere Beachtung verdient, da so die practische
Durchbildung einer grösseren Anzahl jüngerer Mediciner
zweifellos zu fördern wäre, ohne dass doch die Spitalordnung
deswegen gross darunter Noth litte.
wenigstens in gewissem Turnus, zu den abendlichen
Visiten der Aerzte auf den Spitalabtheilungen zuzulassen,
allgemeinere Beachtung verdient, da so die practische
Durchbildung einer grösseren Anzahl jüngerer Mediciner
zweifellos zu fördern wäre, ohne dass doch die Spitalordnung
deswegen gross darunter Noth litte.
Aber selbst bei vollendeter Beschaffenheit und grösster Zugänglichkeit des klinischen Krankenstandes besteht doch nur dann die Möglichkeit eines erfolgreichen Unterrichtes, wenn es den Klinicisten nicht an der nöthigen allgemeinen und speciell-medicinischen Vorbildung gebricht. — Betreffs der allgemeinen Vorbildung des Mediciners geht meine persönliche Ansicht, conform übrigens derjenigen der Mehrzahl meiner ärztlichen Standesgenossen, des Entschiedensten dahin, dass, weil die Ueberwindung des medicinischen Studiums keine geringeren Ansprüche an die Gymnastik des Geistes und die seelische Energie erhebt, als diejenige zum Beispiele des juridischen oder theologischen, auch die Vorbildung des Mediciners keine mindere und keine andere sein dürfe, als die des Juristen oder Theologen, — mit anderen Worten also, dass sie, wie diese, für's Erste immer noch am Besten auf dem humanistischen Gymnasium zu suchen und bis zur vollendeten Maturität daselbst zu erholen sei! Für diese Forderung spricht am wenigsten der rein-äusserliche Nutzen, den die Kenntniss des Lateinischen und namentlich des Griechischen für das Verständniss der zahllosen medicinischen Kunstausdrücke dem Studirenden der Heilkunde gewährt, sondern weit mehr zunächst die lediglich ideale Mitgift, welche die also gebildete Seele des Knaben und Jünglings für das kommende Leben durch den Hauch der Antike empfängt, und die auch dem
 Arzte, als Gegengewicht gegen die Realien seines Berufes,
wahrlich nicht fehlen soll! Am meisten aber empfiehlt
sich, meiner Meinung nach, die humanistische Art
der Vorbildung für den künftigen Mediciner um der so
eminent-gymnastischen Bedeutung willen, welche die
gründliche grammatische Schulung in den beiden
classischen Sprachen für den Geist des Heranwachsenden
besitzt, und die, in gleicher Vollkommenheit und Handlichkeit,
glaube ich, keinem anderen Pädagogicum innewohnt.
Der nämliche Grad dieser Art geistiger Gymnastik
liesse sich aber, — glaube ich ebenfalls — auf
humanistischen Gymnasien auch erreichen mit etwas geringerem
Zeitaufwande auf die Classenlectüre der antiken
Schriftsteller, und es ergäbe sich dann die Möglichkeit,
die so gewonnene Zeit in höchst erwünschter Weise auf
die Completirung des Unterrichts in den Realfächern —
vor Allem der Mathematik zu verwenden. Denn es
unterliegt wohl keinem Zweifel, dass, nächst den alten
Sprachen, die Mathematik weitaus das wirksamste Gymnasticum
des Intellectes ist; die durch sie erwerbbare Behendigkeit
des Denkapparates ist aber zudem noch eine
merklich andere, als die grammatische, darum aber auch
in ihrer Besonderheit durch letztere nicht schlechthin zu ersetzen.
Es will mir nun scheinen, als sei, speciell für den
Mediciner, indessen wohl auch für den Juristen, den Nationaloeconomen
und reinen Philosophen der mathematische
Unterricht humanistischer Gymnasien nach heutigem Zuschnitte
nicht völlig zureichend, aber als brauche derselbe
an ihnen nur noch um ein Weniges weiter zu
gedeihen, als jetzt, — nur noch die Elemente der Differentialrechnung,
den Begriff des Integrales und den Wahrscheinlichkeitsbegriff
in sich aufzunehmen, um der Mathematik
Arzte, als Gegengewicht gegen die Realien seines Berufes,
wahrlich nicht fehlen soll! Am meisten aber empfiehlt
sich, meiner Meinung nach, die humanistische Art
der Vorbildung für den künftigen Mediciner um der so
eminent-gymnastischen Bedeutung willen, welche die
gründliche grammatische Schulung in den beiden
classischen Sprachen für den Geist des Heranwachsenden
besitzt, und die, in gleicher Vollkommenheit und Handlichkeit,
glaube ich, keinem anderen Pädagogicum innewohnt.
Der nämliche Grad dieser Art geistiger Gymnastik
liesse sich aber, — glaube ich ebenfalls — auf
humanistischen Gymnasien auch erreichen mit etwas geringerem
Zeitaufwande auf die Classenlectüre der antiken
Schriftsteller, und es ergäbe sich dann die Möglichkeit,
die so gewonnene Zeit in höchst erwünschter Weise auf
die Completirung des Unterrichts in den Realfächern —
vor Allem der Mathematik zu verwenden. Denn es
unterliegt wohl keinem Zweifel, dass, nächst den alten
Sprachen, die Mathematik weitaus das wirksamste Gymnasticum
des Intellectes ist; die durch sie erwerbbare Behendigkeit
des Denkapparates ist aber zudem noch eine
merklich andere, als die grammatische, darum aber auch
in ihrer Besonderheit durch letztere nicht schlechthin zu ersetzen.
Es will mir nun scheinen, als sei, speciell für den
Mediciner, indessen wohl auch für den Juristen, den Nationaloeconomen
und reinen Philosophen der mathematische
Unterricht humanistischer Gymnasien nach heutigem Zuschnitte
nicht völlig zureichend, aber als brauche derselbe
an ihnen nur noch um ein Weniges weiter zu
gedeihen, als jetzt, — nur noch die Elemente der Differentialrechnung,
den Begriff des Integrales und den Wahrscheinlichkeitsbegriff
in sich aufzunehmen, um der Mathematik
 selbst sofort einen viel höheren und bleibenderen
Werth für das Leben, als Hebel künftiger Denkarbeit
und als Richtschnur practischer Entschliessung zu sichern!
Zur näheren Begründung dieses Satzes gebricht es mir
leider augenblicklich an Zeit; hingegen hielt ich es doch
für Pflicht, auf jenen, wie ich meine, etwas wunden
Punkt der allgemeinen Vorbildung zu gelehrten Berufsarten
nach humanistischern Systeme hier wenigstens ganz
ausdrücklich hinzuweisen.
selbst sofort einen viel höheren und bleibenderen
Werth für das Leben, als Hebel künftiger Denkarbeit
und als Richtschnur practischer Entschliessung zu sichern!
Zur näheren Begründung dieses Satzes gebricht es mir
leider augenblicklich an Zeit; hingegen hielt ich es doch
für Pflicht, auf jenen, wie ich meine, etwas wunden
Punkt der allgemeinen Vorbildung zu gelehrten Berufsarten
nach humanistischern Systeme hier wenigstens ganz
ausdrücklich hinzuweisen.
Was sodann die speciell-medicinische Vorbildung des Klinicisten anlangt, so will ich mit den Einzelheiten Sie ebenfalls nicht behelligen. Als Hauptdesiderat gilt, dass die Klinik von dem Mediciner nicht zu früh, vielmehr erst dann betreten werde, wenn erstlich die naturwissenschaftlich-propaedeutischen Fächer, ferner zweitens die anatomischen und physiologischen Disciplinen theoretisch, wie practisch von ihm absolvirt sind, und wenn der Studirende endlich auch drittens noch dazu die pathologisch-therapeutischen Theoretica und die diagnostischen Practica bereits mit einigem Erfolge frequentirt hat. Nichts ist weniger angebracht, als jene Sucht, welche bisweilen junge Mediciner schon im vierten, oder gar im dritten Semester in die Kliniken treibt, nichts aber meistentheils zugleich ominöser für den gesammten späteren Studiengang dieser nämlichen Leute; denn es handelt sich bei ihnen in der Regel nicht (man verzeihe mir die Deutlichkeit der Ausdrücke) um ungewöhnliche Wissbegierde, oder auch nur um gewöhnliche Neugierde, sondern einfach um jene Art von völliger Verkennung der Verhältnisse, welche der Franzose sehr treffend als: »Mettre la charrue devant les boeufs!« bezeichnet!

Hat aber gegentheilig ein Studirender die erwähnten Präliminarien der Reihe nach und redlich erfüllt, und ist er demnach für den Eintritt in die Klinik reif, so soll er nunmehr auch nicht länger mit diesem Eintritte säumen, sich ferner namentlich auch nicht mehr lange damit begnügen, einfach nur Auscultant der Klinik zu sein. Je bälder er vielmehr jetzt ein Herz sich fasst und mit dem Practiciren beginnt, desto längere Zeit kann er es fortsetzen und desto besser für ihn. Hiess es früher, nicht unbedachtsam, so heisst es jetzt, nicht allzu bedenklich sein und den lebhaften Trieb empfinden, aus der klinischen Raupe baldmöglichst ein Schmetterling zu werden!
Und nun weiter noch der klinische Unterricht selbst, wie soll er auf Grund aller dieser Voraussetzungen vom Lehrer abgehalten werden? Dass letzterer das Fach, welches seiner Klinik ihren besonderen Namen gibt, mit seinem eigenen Wissen und Können ausfüllen müsse, versteht sich von selbst — ebenso auch, dass er mit dem Gesammtinhalte der Medicin fort und fort soweit in lebendiger Fühlung verbleiben solle, um nie den Namen eines bornirten Specialisten zu verdienen. Aber Alles dieses macht den klinischen Lehrer noch nicht aus; denn höchste Gelehrsamkeit und ausgezeichnete ärztliche Tüchtigkeit des Vorstandes machen die Klinik noch längst nicht instructiv! Dazu gehört eben noch Anderes, was unter Umständen umgekehrt sogar das Licht bescheidenerer wissenschaftlicher und technischer Potenz noch recht hell strahlen machen kann, — dazu gehört vor Allem die Lust am Lehren selbst, — ferner die Gabe und das künstlerisch-ausgebildete Geschick des geistigen Wehevaters, — das heisst: die souveräne Beherrschung
 der maeeutischen, oder sokratischen Methode des
Unterrichts! Es gilt, bei der Krankenuntersuchung sowohl,
wie bei der Feststellung der Diagnose und schliesslich
des Curplanes den klinischen Practicanten durch
ein geschickt-geleitetes Frage- und Antwortspiel fort
und fort in geistiger und manueller Activität zu erhalten,
ihm in der zwanglosen Form des Dialoges und
des gemeinsam mit ihm betriebenen Handwerkes sein
Wissen und sein Können, soweit beide existiren, zu entlocken,
und ihn daneben zwingen, ohne dass er es übel
vermerkt oder eingeschüchtert wird, die Lücken dieses
Wissens und Könnens selber aufzudecken. Es gilt ferner,
fort und fort zugleich dem Schüler bei diesem Geburtsgeschäfte
helfend und treibend mit dem eigenen Wissen
und Können zur Seite zu stehen, Hindernisse behend
hinwegzuräumen, die etwa momentan die weitere Entwickelung
jenes Processes bei ihm hemmen, um sodann
doch sofort wieder ihm, dem Schüler, scheinbar die
Hauptrolle und die Handlung zu überlassen! So wird
nicht nur der jeweilige Practicant, sondern mehr oder
minder auch die ganze Hörerschaft in Spannung erhalten,
ein jeder indirect zum Selbstdenken, zur privaten Beantwortung
der gestellten Fragen und beständigen Controlle
seines geistigen Machtbesitzes veranlasst, — und so der.
klinische Unterricht belebt! — Weit weniger angebracht
für die Klinik sind hingegen längere zusammenhängende
Expectorationen des klinischen Lehrers allein,
bei welchen letzterer für seiner Rede Silber das stumme
Schweigen des Practicanten und der übrigen Hörer eintauscht,
— ein Schweigen, das bei diesem Handel denn
doch ganz gewiss nicht immer Goldes Werth besitzt! Solche
sogenannte »klinische Vorträge«lesen sich im Allgemeinen
der maeeutischen, oder sokratischen Methode des
Unterrichts! Es gilt, bei der Krankenuntersuchung sowohl,
wie bei der Feststellung der Diagnose und schliesslich
des Curplanes den klinischen Practicanten durch
ein geschickt-geleitetes Frage- und Antwortspiel fort
und fort in geistiger und manueller Activität zu erhalten,
ihm in der zwanglosen Form des Dialoges und
des gemeinsam mit ihm betriebenen Handwerkes sein
Wissen und sein Können, soweit beide existiren, zu entlocken,
und ihn daneben zwingen, ohne dass er es übel
vermerkt oder eingeschüchtert wird, die Lücken dieses
Wissens und Könnens selber aufzudecken. Es gilt ferner,
fort und fort zugleich dem Schüler bei diesem Geburtsgeschäfte
helfend und treibend mit dem eigenen Wissen
und Können zur Seite zu stehen, Hindernisse behend
hinwegzuräumen, die etwa momentan die weitere Entwickelung
jenes Processes bei ihm hemmen, um sodann
doch sofort wieder ihm, dem Schüler, scheinbar die
Hauptrolle und die Handlung zu überlassen! So wird
nicht nur der jeweilige Practicant, sondern mehr oder
minder auch die ganze Hörerschaft in Spannung erhalten,
ein jeder indirect zum Selbstdenken, zur privaten Beantwortung
der gestellten Fragen und beständigen Controlle
seines geistigen Machtbesitzes veranlasst, — und so der.
klinische Unterricht belebt! — Weit weniger angebracht
für die Klinik sind hingegen längere zusammenhängende
Expectorationen des klinischen Lehrers allein,
bei welchen letzterer für seiner Rede Silber das stumme
Schweigen des Practicanten und der übrigen Hörer eintauscht,
— ein Schweigen, das bei diesem Handel denn
doch ganz gewiss nicht immer Goldes Werth besitzt! Solche
sogenannte »klinische Vorträge«lesen sich im Allgemeinen
 besser gedruckt, als dass sie in der Klinik selbst mündlich
und allzu oft gehalten würden; sie passen für letztere
nur dann, wenn ein ungewöhnlich complicirter oder
schwieriger Fall einmal in allen seinen Einzelheiten
klar und übersichtlich auseinander gelegt werden soll, —
oder wenn gerade eine brennende Tagesfrage der practischen
Medicin ihrer klinischen Erledigung harrt, die.
gelegentlich einer concreten Demonstration bequem im
Zusammenhange erörtert werden kann. Allzu ausgedehnt
ist übrigens auch ein solcher, an sich völlig zeitgemässer
Monolog des Lehrers immer misslich für die
momentane Geistesfrische der Klinik, — denn dass eine
jede Rede, auch die beste nicht ausgenommen, wenn
sie bandwurmartig sich in die Länge zieht, auf das
Auditorium schliesslich leicht als gelindes Narkoticum
wirkt, gilt unter gebildeten Leuten bekanntlich stillschweigend
als ausgemacht!
besser gedruckt, als dass sie in der Klinik selbst mündlich
und allzu oft gehalten würden; sie passen für letztere
nur dann, wenn ein ungewöhnlich complicirter oder
schwieriger Fall einmal in allen seinen Einzelheiten
klar und übersichtlich auseinander gelegt werden soll, —
oder wenn gerade eine brennende Tagesfrage der practischen
Medicin ihrer klinischen Erledigung harrt, die.
gelegentlich einer concreten Demonstration bequem im
Zusammenhange erörtert werden kann. Allzu ausgedehnt
ist übrigens auch ein solcher, an sich völlig zeitgemässer
Monolog des Lehrers immer misslich für die
momentane Geistesfrische der Klinik, — denn dass eine
jede Rede, auch die beste nicht ausgenommen, wenn
sie bandwurmartig sich in die Länge zieht, auf das
Auditorium schliesslich leicht als gelindes Narkoticum
wirkt, gilt unter gebildeten Leuten bekanntlich stillschweigend
als ausgemacht!
Um so mehr wird es natürlich jetzt auch für mich Zeit, an den Schluss zu denken; denn es erübrigt mir ja noch immer, auch von der dritten klinischen Thätigkeit —der forschenden — zu Ihnen zu reden! Lassen Sie mich ganz kurz sein und vor Allem constatiren, dass diese Aeusserung des klinischen Lebens sich unter allen dreien der geringsten Popularität erfreut. Dass an den armen Kranken in der Klinik das Curiren betrieben wird, ist Allen erwünscht und Allen genehm, — dass man sie zum Zwecke des Unterrichtes benutzt, gilt als ein nothwendiges Uebel, — dass sie aber eventuell dem Kliniker, oder seinen Assistenten auch gar noch zu Forschungszwecken als Objecte dienen sollen, erscheint Vielen als überflüssig, Manchen als unerlaubt! Zu betonen ist nun zunächst, dass, wie schon der klinische
 Unterricht am Krankenbette stets in schonender Form
und unter thunlichster Berücksichtigung berechtigter
Eigenthümlichkeiten der Patienten abzuhalten ist, diese
Rücksichten auch ebenso sehr von der Forschung innezuhalten
sind. Diese Rücksichtsnahme soll freilich nicht
so weit gehen, dass, wenn einmal gerade eine an sich
seltene, aber zufällig gegebene Gelegenheit existirt, eine
wichtige pathologisch-therapeutische Frage ihrer endgültigen
Entscheidung um einen Schritt näher zu bringen,
nicht dann und wann einmal auch eine Schrulle
besiegt oder eine gewisse Beharrlichkeit gezeigt werden
dürfte! Nur darf diese Rücksichtslosigkeit, wenn man
»Festhalten am Project« so nennen will, ihrerseits auch
wieder niemals so weit gehen, dass der Patient bei derselben
irgendwie direct Schaden erlitte, oder auch nur die
Last unverhältnissmässiger Unbequemlichkeiten auf sich
nehmen müsste; sondern es muss im Gegentheil bei
solchen Versuchen und Beobachtungen der klinische
Forscher zuvor mit sich selbst des Genauesten darüber
zu Rathe gehen, ob das Minimum des für die menschliche
Gesellschaft zu erhoffenden Nutzens das Maximum
des von dem einzelnen Patienten zu fordernden Einsatzes,
nach ethischem Maasse gemessen, voraussichtlich
erreicht, oder nicht? Ist nun aber bei einer solchen
nüchternen Vorausberechnung das wahrscheinliche Facit
für die Vornahme des Versuches, so ist das klinische
Experiment ganz gewiss ebenso erlaubt, wie im analogen
Falle das volkswirthschaftliche oder politische, ja wie
das naturwissenschaftliche Experiment überhaupt, und
es wäre unmännlich. und feige sogar, dasselbe wieder
und immer wieder gegen bessere Einsicht aus blosser
Furcht vor äusserlichen Conflicten zu unterlassen! Denn
Unterricht am Krankenbette stets in schonender Form
und unter thunlichster Berücksichtigung berechtigter
Eigenthümlichkeiten der Patienten abzuhalten ist, diese
Rücksichten auch ebenso sehr von der Forschung innezuhalten
sind. Diese Rücksichtsnahme soll freilich nicht
so weit gehen, dass, wenn einmal gerade eine an sich
seltene, aber zufällig gegebene Gelegenheit existirt, eine
wichtige pathologisch-therapeutische Frage ihrer endgültigen
Entscheidung um einen Schritt näher zu bringen,
nicht dann und wann einmal auch eine Schrulle
besiegt oder eine gewisse Beharrlichkeit gezeigt werden
dürfte! Nur darf diese Rücksichtslosigkeit, wenn man
»Festhalten am Project« so nennen will, ihrerseits auch
wieder niemals so weit gehen, dass der Patient bei derselben
irgendwie direct Schaden erlitte, oder auch nur die
Last unverhältnissmässiger Unbequemlichkeiten auf sich
nehmen müsste; sondern es muss im Gegentheil bei
solchen Versuchen und Beobachtungen der klinische
Forscher zuvor mit sich selbst des Genauesten darüber
zu Rathe gehen, ob das Minimum des für die menschliche
Gesellschaft zu erhoffenden Nutzens das Maximum
des von dem einzelnen Patienten zu fordernden Einsatzes,
nach ethischem Maasse gemessen, voraussichtlich
erreicht, oder nicht? Ist nun aber bei einer solchen
nüchternen Vorausberechnung das wahrscheinliche Facit
für die Vornahme des Versuches, so ist das klinische
Experiment ganz gewiss ebenso erlaubt, wie im analogen
Falle das volkswirthschaftliche oder politische, ja wie
das naturwissenschaftliche Experiment überhaupt, und
es wäre unmännlich. und feige sogar, dasselbe wieder
und immer wieder gegen bessere Einsicht aus blosser
Furcht vor äusserlichen Conflicten zu unterlassen! Denn
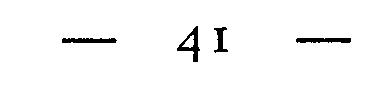 wo gäbe es wohl noch mehr zum Wohle der Menschheit
zu erforschen, als gerade auf dem so vielfach bescholtenen
Gebiet der Heilkunde, und wem läge dementsprechend
das der menschlichen Natur überhaupt so
tief eingewurzelte, darum durchaus natürliche Bedürfniss
zur Forschung an sich wohl näher, als gerade den Aerzten
— unter diesen aber wiederum den Klinikern, als den
wissenschaftlichen Vorposten des ärztlichen Standes?
Es geht also einfach nicht an, zu wünschen oder gar
zu verlangen, die Klinik solle sich mit ihrer heilenden
und ihrer lehrenden Thätigkeit begnügen, auf das Experiment
hingegen und auf methodische therapeutische
Forschung aus Gründen schaaler Convenienz womöglich
verzichten; — lächerlich aber wäre es vollends, wenn
der Kliniker und seine Gehilfen etwa von vornherein
freiwillig, oder auf solches Andringen hin sofort gutwillig
sich in die höchst zweifelhafte Rolle fänden, simple
Wächter des Harems der Tradition zu sein, — das heisst:
sich schmucklos zu geistigen Eunuchen degradirten! Des
Vorwurfes endlich noch, den man wohl hier und da
hört: das klinische Forschen geschehe weniger aus der
lautem Absicht, das gesundheitliche Wohl der Menschheit
zu fördern, wie vielmehr meistens nur aus Motiven
persönlicher Eitelkeit, — erwähne ich nur als eines Beispiel
tugendsamer Extravaganz; — denn wer, ich frage,
der solchen pharisäischen Tadel leichten Herzens ausspricht
und unter die Leute bringt, weiss sich wohl, als
Mensch, bei eigenem gutem Werke, eigener löblicher
Stiftung von jeder, auch der kleinsten Dosis menschlicher
Eitelkeit frei?
wo gäbe es wohl noch mehr zum Wohle der Menschheit
zu erforschen, als gerade auf dem so vielfach bescholtenen
Gebiet der Heilkunde, und wem läge dementsprechend
das der menschlichen Natur überhaupt so
tief eingewurzelte, darum durchaus natürliche Bedürfniss
zur Forschung an sich wohl näher, als gerade den Aerzten
— unter diesen aber wiederum den Klinikern, als den
wissenschaftlichen Vorposten des ärztlichen Standes?
Es geht also einfach nicht an, zu wünschen oder gar
zu verlangen, die Klinik solle sich mit ihrer heilenden
und ihrer lehrenden Thätigkeit begnügen, auf das Experiment
hingegen und auf methodische therapeutische
Forschung aus Gründen schaaler Convenienz womöglich
verzichten; — lächerlich aber wäre es vollends, wenn
der Kliniker und seine Gehilfen etwa von vornherein
freiwillig, oder auf solches Andringen hin sofort gutwillig
sich in die höchst zweifelhafte Rolle fänden, simple
Wächter des Harems der Tradition zu sein, — das heisst:
sich schmucklos zu geistigen Eunuchen degradirten! Des
Vorwurfes endlich noch, den man wohl hier und da
hört: das klinische Forschen geschehe weniger aus der
lautem Absicht, das gesundheitliche Wohl der Menschheit
zu fördern, wie vielmehr meistens nur aus Motiven
persönlicher Eitelkeit, — erwähne ich nur als eines Beispiel
tugendsamer Extravaganz; — denn wer, ich frage,
der solchen pharisäischen Tadel leichten Herzens ausspricht
und unter die Leute bringt, weiss sich wohl, als
Mensch, bei eigenem gutem Werke, eigener löblicher
Stiftung von jeder, auch der kleinsten Dosis menschlicher
Eitelkeit frei?
»Wer unter Euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie!«

Dieses erhabene Wort der Schrift 22) — erhaben. über jeglicher menschlicher Splitterrichterei — passt sicherlich auch hier, — und soviel über die Ethik klinischer Forschung!
Die Zwecke klinischer Forschung. sind Erweiterung oder Befestigung des pathologisch-therapeutischen Machtbesitzes, je nachdem sie einfach auf neue Entdeckungen ausgeht, oder das angeblich anderswo Entdeckte auf seine reale Existenz prüft. — Der Mittel und Wege zu Beidem gibt es vorderhand drei, — der pathologisch-therapeutische Thierversuch, — der therapeutische Versuch am Menschen, — und die gehäufte klinische Beobachtung. Von diesen dreien fallen nur die letztem beide in das Bereich der Klinik; denn die erstgenannte Methode, der Thierversuch, gehört der Experimentalpathologie und -therapie an, — steht freilich dem Kliniker ebenfalls offen, soll ferner von ihm, wo ihn der Mensch zu kostbar dünkt, gleicher Weise ohne Bänglichkeit betreten werden, — ist aber nicht unmittelbar seines Amtes! Das Wesen des zweiten Modus klinischer Forschung, nämlich des klinisch-therapeutischen Versuches, lässt sich allgemein sehr leicht dahin definiren, dass, nach sorgfältigster Ausschaltung störender Nebenbedingungen, bald durch die Application eines therapeutischen Agens auf einen Kranken allein, — bald durch die parallele Application verschiedener Agentien auf mehrere Kranke gleicherlei Art, — bald endlich durch die parallele Application eines und desselben Agens auf Kranke verschiedener Art, — oder auf Kranke und Gesunde — der positive, negative oder indifferente Heileffect dieses, oder dieser Heilagentien so genau als möglich festgestellt werden soll! — Die dritte der genannten
 Methoden, die der gehäuften Beobachtungen, ist synonym
mit der streng-statistischen Methode überhaupt und
bedarf demnach hier keiner genaueren Erläuterung; ihre
Verwerthbarkeit zur Erzielung brauchbarer therapeutischer
Schlüsse setzt zuvörderst eine sorgfältige klinische
Analyse der in Frage kommenden Reihen homolog-behandelter
Beobachtungsfälle voraus, — im Uebrigen ist
sie eine mathematische Angelegenheit, nämlich Sache
der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 28) — Bedenkt man
einerseits die Schwierigkeit, die für jede der beiden zuletzt
genannten Methoden darin besteht, störende Einwirkungen
von einem so complicirten Versuchs- oder Beobachtungsobjecte,
wie dem kranken und gesunden Menschen,
bei der Versuchsanordnung oder der fortlaufenden methodischen
Beobachtung auch nur einigermaassen auszuschalten,
— bedenkt man anderseits den transcendenten
Werth dieses Objectes selbst, so erhellt ohne Weiteres,
dass die klinische Forschung kein leichter, sondern
ein dornenvoller Pfad ist, der zum Beispiele mit dem
ebeneren Wege physikalischer oder chemischer Forschung
hinsichtlich seiner Mühen, seiner ethischen Scrupel und
seiner getäuschten Hoffnungen sich nur schwer vergleichen
lässt! — Darum stimmt aber auch die klinische Forschung,
ganz entgegen landläufiger Auffassung, weit eher bescheiden,
als eitel oder übermüthig, — um so bescheidener
und resignirter ferner, je länger sie betrieben
wird, und je mehr sie, trotz aller Schmerzen, die sie
ihm bringt, dennoch zur Herzenssache des klinischen
Mannes wird. Denn mehr als auf jede andere Aeusserung
klinischen Lebens passt auf sie der tiefe Ernst
jener Quintessenz hippokratischer Weisheit, die sich
ausgesprochen findet in dem ersten Aphorismus des ärztlichen
Methoden, die der gehäuften Beobachtungen, ist synonym
mit der streng-statistischen Methode überhaupt und
bedarf demnach hier keiner genaueren Erläuterung; ihre
Verwerthbarkeit zur Erzielung brauchbarer therapeutischer
Schlüsse setzt zuvörderst eine sorgfältige klinische
Analyse der in Frage kommenden Reihen homolog-behandelter
Beobachtungsfälle voraus, — im Uebrigen ist
sie eine mathematische Angelegenheit, nämlich Sache
der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 28) — Bedenkt man
einerseits die Schwierigkeit, die für jede der beiden zuletzt
genannten Methoden darin besteht, störende Einwirkungen
von einem so complicirten Versuchs- oder Beobachtungsobjecte,
wie dem kranken und gesunden Menschen,
bei der Versuchsanordnung oder der fortlaufenden methodischen
Beobachtung auch nur einigermaassen auszuschalten,
— bedenkt man anderseits den transcendenten
Werth dieses Objectes selbst, so erhellt ohne Weiteres,
dass die klinische Forschung kein leichter, sondern
ein dornenvoller Pfad ist, der zum Beispiele mit dem
ebeneren Wege physikalischer oder chemischer Forschung
hinsichtlich seiner Mühen, seiner ethischen Scrupel und
seiner getäuschten Hoffnungen sich nur schwer vergleichen
lässt! — Darum stimmt aber auch die klinische Forschung,
ganz entgegen landläufiger Auffassung, weit eher bescheiden,
als eitel oder übermüthig, — um so bescheidener
und resignirter ferner, je länger sie betrieben
wird, und je mehr sie, trotz aller Schmerzen, die sie
ihm bringt, dennoch zur Herzenssache des klinischen
Mannes wird. Denn mehr als auf jede andere Aeusserung
klinischen Lebens passt auf sie der tiefe Ernst
jener Quintessenz hippokratischer Weisheit, die sich
ausgesprochen findet in dem ersten Aphorismus des ärztlichen
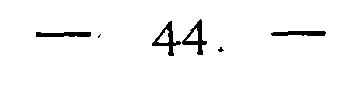 Patriarchen von Kos, — jenem Wahrspruche klinischer
Medicin, der da handelt:
Patriarchen von Kos, — jenem Wahrspruche klinischer
Medicin, der da handelt:
»von der Länge der Kunst, und der Kürze unseres
Lebens, — von dem Fluge der Gelegenheit, der Trüglichkeit
des Versuches und der Schwere der Entscheidung!«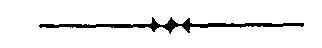
Anmerkungen.:








