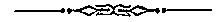Christentum und Weltverneinung.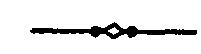
Rektoratsrede
von
Basel.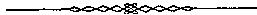
BENNO SCHWABE. Schweighauserische Verlagsbuchhandlung. Basel 1888.
Schweighauserische Buchdruckerei.
Es ist eine verbreitete und begreifliche, aber irrige Ansicht, dass die inneren Schwierigkeiten und Gefahren für das Christentum von heute vorzugsweise auf dem Gebiet des Dogmas zu suchen seien. Allerdings sind die äusserlichen Normen, welche die altprotestantische Dogmatik zusammenhielten, nunmehr auf der ganzen Linie der wissenschaftlich arbeitenden Theologie, obschon nicht immer mit dem vollen Bewusstsein von der Tragweite dieses Schritts, endgiltig und allgemein aufgegeben worden: zuerst die Norm des Buchstabens der symbolischen Bücher, dann auch die Norm des biblischen Buchstabens oder des missverstandenen reformatorischen Schriftprinzips. Und sowohl die grosse Verschiedenheit des Tempos, in welchem sich die einzelnen theologischen Denkweisen zu diesem, seit den Tagen Semlers und Lessings geforderten Verzicht entschlossen, als auch die noch grössere Verschiedenheit des Eifers, mit welchem sie sich, an dem Suchen nach immanenten sachlichen Normen der christlichen Lehre beteiligten, hat für unsere systematische Theologie eine verworrene Situation geschaffen, deren Schwierigkeiten durch. die vielstimmigen dogmatischen Beiträge und Einreden der Laienwelt kaum gemindert werden.
Immerhin sollen ja auch andere Wissenschaften und zwar gerade auch solche, deren Ertrag ebenso unmittelbar wie derjenige der theologischen Arbeit von den Bedürfnissen der Praxis in Anspruch genommen wird, von den Nöten
 zu erzählen wissen, welche das Wanken bisher anerkannter
Normen und die Erschütterung hergebrachter Methoden
mit sich bringt.
zu erzählen wissen, welche das Wanken bisher anerkannter
Normen und die Erschütterung hergebrachter Methoden
mit sich bringt.
Vor allem aber sind ja die theoretischen Vorstellungen, um die es sich in dem Lehrstreit handelt, niemals das wesentliche einer Religion. Auch der christliche Geist bedarf ihrer zu seiner Selbstdarstellung, zu Verteidigung und Angriff. Doch sie sind wandelbar in sich selbst, wandelbar nach dem vielgestaltigen Zeugnis der Geschichte. Gehörten sie zur Substanz der Religion, so müssten doch ihre Veränderungen gleichzeitig mit den grossen Entwicklungs-Perioden derjenigen Religion vor sich gehen, welcher sie dienen. Das ist durchaus nicht der Fall. Man denke nur an das sechzehnte Jahrhundert. Die Reformation hat die Theologie der ökumenischen Konzilen nicht einmal revidirt, sondern einfach in ihre symbolischen Bücher hinübergenommen. Was sie verneinte und was sie schuf, das betraf gleichermassen die Frage: was der christliche Glaube für das religiöse und sittliche Leben des Menschen und der Gesellschaft bedeute.
Die Theologie nun, welche auf dem Grunde dieser Frage und ihrer evangelischen Beantwortung erwachsen ist, sollte daher auch nicht zweifeln, auf welchem Gebiete die Artikel der stehenden oder fallenden evangelischen Kirche und damit die entscheidenden Instanzen für ihren eigenen Bestand oder Niedergang zu suchen sind. Die Häresie hat sie je und je nicht nur ohne Fährde für ihr eigenes Dasein durchgekämpft, sie hat ihrer bedurft als einer "Sollizitation der fortschreitenden Wahrheit". Aber verlöre unsere Theologie das klare Bewusstsein von dem Wesen der von ihr zu vertretenden Lebensansicht und von dem vernünftigen und geschichtlichen Rechte derselben — so stände sie als
 wissenschaftliche Disziplin trotz aller exegetischen und
kirchengeschichtlichen Mühwaltung ebenso haltlos da, wie
im praktischen Weltgetriebe diejenige christliche Gemeinschaft
dastände, deren Mitglieder unbeschadet ihrer Kirchlichkeit
sich daran gewöhnt hätten, ihr tägliches wirkliches
Leben ohne Rücksicht auf das Christentum zu ordnen.
wissenschaftliche Disziplin trotz aller exegetischen und
kirchengeschichtlichen Mühwaltung ebenso haltlos da, wie
im praktischen Weltgetriebe diejenige christliche Gemeinschaft
dastände, deren Mitglieder unbeschadet ihrer Kirchlichkeit
sich daran gewöhnt hätten, ihr tägliches wirkliches
Leben ohne Rücksicht auf das Christentum zu ordnen.
Die verschwenderische Fülle innerkirchlicher Kämpfe, deren Zeugen wir sind, lässt notwendig vermuten, dass die Kirche sich auf dem bezeichneten Gebiete sicher fühlt. In der That, dass der Grossteil der sogenannten christlichen Welt heute schon dem christlichen Lebensideal entwachsen sei oder hier bewusst, dort unbewusst zu entwachsen drohe, noch ehe das Christentum sich auch nur ein Dritteil des Menschengeschlechts äusserlich unterworfen, das wäre eine grausame Annahme, für deren blosse Konzeption der vielgeschäftige Streit der falschberühmten kirchlichen "Richtungen" ohnehin keine Musse lässt. Lassen wir also die praktische Seite der Frage und halten wir uns ausschliesslich an ein hierhergehöriges theologisches Problem, dessen Erwägung durch neuere und neueste Arbeiten zur Geschichte der christlichen Sitte und Sittenlehre besonders nahegelegt wird. Von allem, was die wissenschaftliche Verteidigung der christlichen Religion in den letzten Jahrzehnten Ernstes betroffen hat, ist nichts so schwerwiegend und nichts bisher so leichthin beantwortet worden, als die Erneuerung des altheidnischen Einwurfs, der einst in mannichfacher Variation gegen das junge Christentum erhoben wurde: es sei in sich selbst eine Lehre der träumenden Jenseitigkeit, ohne Sinn für die Werte dieser Welt, ohne Herz für Staat, Wissenschaft,. Kunst, ohne Frucht für das öffentliche Leben. Heute wird das so ausgedrückt: das Christentum sei seinem Wesen nach reine Weltverneinung
 und habe mit jener runden Abkehr von den Weltinteressen
in den ersten Jahrhunderten seiner Geschichte nur sich
selbst redlich dargestellt, während das heutige Christentum,
das sich mit der Welt tief und tiefer einlasse, eben keines
mehr sei.
und habe mit jener runden Abkehr von den Weltinteressen
in den ersten Jahrhunderten seiner Geschichte nur sich
selbst redlich dargestellt, während das heutige Christentum,
das sich mit der Welt tief und tiefer einlasse, eben keines
mehr sei.
So stellen denn die Kulturhistoriker und die einzelnen Theologen, welche dieser Meinung sind, ihre Behauptung nicht mehr im Sinn eines gehässigen Widerchristentums auf; vielmehr hier und da sogar mit dem verbindlichen Ausdruck besonderer Hochschätzung für den Pietismus als den eigentlichen Konservator der sonst verblichenen urchristlichen Lebensansicht. Aber immer erheben sie den doppelten Anspruch: das heutige Christentum mit seiner intimen Welt- und Kulturverflochtenheit als eine Selbsttäuschung zu erweisen und zugleich allen historisch unterrichteten und folgerichtig denkenden Geistern die stille Abwendung vom Christentum überhaupt nahezulegen, vom asketischen, ächten so gut wie vom nachgemachten, kulturfreundlichen.
Hochansehnliche Versammlung! Wenn der Senat und. das Volk von Basel, unter deren Auspizien diese Universität lernt und lehrt, bei einer akademischen Feier vertreten sein wollen, in welcher ein Mitglied der theologischen Fakultät das Wort zu führen verpflichtet ist, dann liegt wohl kein 'Thema so nahe, als eben diese Frage nach der christlichen Lebensansicht. Ihr gilt ja doch im letzten Grunde auch die wissenschaftlich-theologische Arbeit, die exegetische sowohl, wie die historische und systematische; und sie soll den Kommilitonen als zukünftigen Dienern der evangelischen Kirche vor allem andern wissenschaftlich begründet werden. Wäre nun jener Satz von dem weltflüchtigen Wesen des Christentums theologisch richtig, wie
 könnte ein Gemeinwesen seinen Schutz einer Disziplin
dauernd erhalten wollen, deren Zöglinge nur dann als praktisch
brauchbare Männer in ihr besonderes Amt einträten,
wenn sie von ihrer Wissenschaft nichts kapirt hätten oder
aber entschlossen wären, die gewonnenen Erkenntnisse ein
Leben hindurch zu verleugnen? Umgekehrt aber könnte —
und darauf soll hier der Hauptton gelegt werden — jene
Thesis nicht so eindrucksvoll auftreten, wie sie es bei
Ernstgesinnten thut, wenn nicht sehr viel mehr für sie spräche,
als ihre Gegner gemeinhin wissen oder zugeben wollen.
könnte ein Gemeinwesen seinen Schutz einer Disziplin
dauernd erhalten wollen, deren Zöglinge nur dann als praktisch
brauchbare Männer in ihr besonderes Amt einträten,
wenn sie von ihrer Wissenschaft nichts kapirt hätten oder
aber entschlossen wären, die gewonnenen Erkenntnisse ein
Leben hindurch zu verleugnen? Umgekehrt aber könnte —
und darauf soll hier der Hauptton gelegt werden — jene
Thesis nicht so eindrucksvoll auftreten, wie sie es bei
Ernstgesinnten thut, wenn nicht sehr viel mehr für sie spräche,
als ihre Gegner gemeinhin wissen oder zugeben wollen.
I.
Christentum gleich Weltverneinung — dieser Satz begründet sich besonders leicht, wenn die Probe auf seine Wahrheit an der Geschichte der werdenden Kirche gemacht wird, also an der Wendezeit des zweiten und dritten christlichen Jahrhunderts. Tertullian, dieser eine Name sagt alles. Wenn auch das geschichtliche. Bild dieses "Antignostikus" bei der Rückständigkeit der tertullianischen Textforschung in vielem Einzelnen noch nicht zu fixiren ist, der Grundcharakter seiner Lehre, welche repräsentativ für eine ganze Epoche ist, steht mit ziemlicher Deutlichkeit vor unsern Augen und ist auch in den verschiedenen Stadien seiner unruhig stürmenden und drängenden Entwicklung ziemlich derselbe geblieben. Man kann ihn als die reine Verneinung des heidnischen Staats mitsammt seiner Kultur und als die denkbar schärfste Antithese gegen denselben bezeichnen.
Seitdem, Plinius an Trajan seinen Bericht über die christliche Sekte erstattet hat, ist die römische Staatsraison genötigt, grundsätzliche Stellung zu der, bisher bei den Bagatellsachen vorgemerkten neuen Religion zu nehmen.
 Wohl bewährt der römische Geist, zumal in der ehrwürdigen
Vertretung, die er bei den grossen Cäsaren des zweiten
Jahrhunderts findet, seine innere Vornehmheit in einem
anerkannt hohen Mass von Weitherzigkeit und Gastfreundlichkeit
gegen alle möglichen fremden Kulte, sofern sie
eben nichts als freie Niederlassung begehren. Aber die
neue Art von Aberglauben, welche einen Weltenkönig am
Schandpfahl verherrlicht, ist aggressiv und erscheint vor
dem römischen Forum als aufrührerisch aus Fanatismus,
Beschränktheit und Uebermut. So muss sie denn die weltbekannte
eiserne Hand fühlen. Auch des Antoninus Pius
würdiger Nachfolger stellt sich gegen dieselbe ebenso feindselig
aus Pflichtgefühl in seinen Thaten als wortkarg aus Verachtung
in seinen Schriften. "Von Servus", so bekennt
Marc Aurel in seinen Monologen, "wurde ich zu dem Begriff
eines Staats geführt, in welchem alle Bürger gleich
sind und zu dem einer Regierung, die nichts so hoch hält,
als die bürgerliche Freiheit." An seinem Vorgänger aber, so
schreibt er weiter, imponirte ihm, neben den Tugenden der
Sanftmut, "eine unerschütterliche Festigkeit in dem, was
gründlich erwogen ist." Im siebenten Buch seiner Selbstgespräche
hat derselbe "Stoiker auf dem Thron der Cäsaren"
einen Spruch des Antisthenes angemerkt: "Herrlich
ist es, durch Gutesthun in schlechten Ruf kommen." Durch
Toleranz gegen den herausfordernden Aberglauben der
Christen hätte er sowohl seinen kaiserlichen Namen als auch
sein Gewissen befleckt. — So entstand denn notwendig auf
christlicher Seite der intransigents Gegensatz gegen den
Staat und Alles, was ihn gross machte und herrlich erhielt.
Unerbittlich erklang der Weheruf der jederzeit todesbereiten
christlichen Bekenntnistreue über den Abfall derer, welche
der römischen Inquisition wichen. '
Wohl bewährt der römische Geist, zumal in der ehrwürdigen
Vertretung, die er bei den grossen Cäsaren des zweiten
Jahrhunderts findet, seine innere Vornehmheit in einem
anerkannt hohen Mass von Weitherzigkeit und Gastfreundlichkeit
gegen alle möglichen fremden Kulte, sofern sie
eben nichts als freie Niederlassung begehren. Aber die
neue Art von Aberglauben, welche einen Weltenkönig am
Schandpfahl verherrlicht, ist aggressiv und erscheint vor
dem römischen Forum als aufrührerisch aus Fanatismus,
Beschränktheit und Uebermut. So muss sie denn die weltbekannte
eiserne Hand fühlen. Auch des Antoninus Pius
würdiger Nachfolger stellt sich gegen dieselbe ebenso feindselig
aus Pflichtgefühl in seinen Thaten als wortkarg aus Verachtung
in seinen Schriften. "Von Servus", so bekennt
Marc Aurel in seinen Monologen, "wurde ich zu dem Begriff
eines Staats geführt, in welchem alle Bürger gleich
sind und zu dem einer Regierung, die nichts so hoch hält,
als die bürgerliche Freiheit." An seinem Vorgänger aber, so
schreibt er weiter, imponirte ihm, neben den Tugenden der
Sanftmut, "eine unerschütterliche Festigkeit in dem, was
gründlich erwogen ist." Im siebenten Buch seiner Selbstgespräche
hat derselbe "Stoiker auf dem Thron der Cäsaren"
einen Spruch des Antisthenes angemerkt: "Herrlich
ist es, durch Gutesthun in schlechten Ruf kommen." Durch
Toleranz gegen den herausfordernden Aberglauben der
Christen hätte er sowohl seinen kaiserlichen Namen als auch
sein Gewissen befleckt. — So entstand denn notwendig auf
christlicher Seite der intransigents Gegensatz gegen den
Staat und Alles, was ihn gross machte und herrlich erhielt.
Unerbittlich erklang der Weheruf der jederzeit todesbereiten
christlichen Bekenntnistreue über den Abfall derer, welche
der römischen Inquisition wichen. '

In derselben Richtung wirkten die Reste des alten christlichen Gemeindeglaubens an die baldige sichtbare Wiederkunft des Gekreuzigten zur Beendigung dieser fleischlich-irdischen Weltökonomie und zur Begründung seines messianischen Reiches.
Allerdings war diese Erwartung durch das Zögern der Erfüllung stark geschwächt und auch vielfach schon ausgeglommen. Aber wie in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts der im Prinzip ebenfalls schon überwundene Streit zwischen Juden- und Heidenchristentum vor seiner wirklichen Beendigung sich in den Osterstreitigkeiten noch eine letzte Satisfaktion verschaffte, so wurde ziemlich gleichzeitig auch die erregende Flamme der Wiederkunfts-Erwartung, vor ihrem einstweilen gänzlichen Erlöschen, durch den Montanismus noch einmal zu hellem Auflodern angefacht; und auch Tertuffian, der lauteste der christlichen Rufer im Streit, stand unter ihrem Bann.
Nehmen wir hinzu, dass dieser Urlateiner unter den Lehrern der alten Christenheit von Hause aus zu seiner Entwicklung einen starken Beisatz von eingeborenem gesetzlichem Rigorismus mitbrachte, der erst in seiner mittleren Lebensperiode vor den Einflüssen eines spezifisch religiösen Erlösungsbegriffes ein weniges zurückwich, so haben wir die Elemente beisammen, aus denen seine eifernde Asketik hervorging — eine Asketik, die, rein äusserlich und ohne Rücksicht auf die letzten Motive angesehen, den heutigen Christen insgesammt fremdartiger gegenübersteht als die antike Moral.
"Das ganze Tugend- und Pflichtgefühl dieses Christentums entwickelte sich unter dem aufregenden Einfluss der — aus den beiden bezeichneten Hauptquellen strömenden —— Welt- und Todesverachtung." "Licht und Finsternis
 scheiden sich, das Leben wird hier zum Gefängnis, dort
zum Kriegsstand und nur die christlichen Verächter des
Todes werden die Sieger sein." Fort also nicht nur mit
aller Unreinheit und den Opfern des eigentlichen Götzendienstes,
mit dem Gepränge und den Lustbarkeiten der
Ringkämpfe und Schauspiele, mit allem Luxus des Lebens,
mit allem Schmuck des äusseren Menschen, auch mit dem
Siegeskranz des Soldaten: fort auch mit allen irdischen
Geistesgütern, die zu geniessen erlaubt wäre, wenn nicht
der Dämonen Bosheit alles verdürbe im Dienste des Satans,
welcher der Regent dieses Aeon ist. Los von der Philosophie;
denn Stoff und dialektische Denkart giebt sie der
Häresie, die zwar auch aus der Kirche heraus entstand,
aber so "wie auch der saure Wildling aus dem Kern des
milden, fetten, süssen Oelbaumes entspriessen kann." Wir
haben nicht nöthig, vorwitzige Fragen zu erforschen, nachdem
Jesus Christus geboren. Wir haben eine Regel des
Glaubens. Was haben Jerusalem und Athen, was die
Kirche und die Akademie gemein? —Los auch vom Handelsverkehr
und Erwerb des Reichtums, die eines Dieners
Gottes nicht würdig sind; "der Glaube hat . den Hunger
wie jede Art des Todes um Gottes willen zu verachten."
Die Ehe kann als die "Gemeinschaft zweier Getreuen auf
gleiche himmlische Hoffnung, gleiche Zucht und Dienstleistung"
gepriesen werden. Aber wie die zweite Ehe Ehebruch,
so bleibt der Ruhm der Virginität als solcher bestehen
— ein heilig Seitenstück zur Disziplin. des Fastens,
das Tertullian dem Essen gelegentlich gegenübersteht wie
Heil dem Unheil. Und alles dieses im Dienste eines Ideals
von christlicher Vollkommenheit, dessen Ueberspannung die
bedenkliche Theorie von verschiedenen Graden christlicher
Heiligkeit hervortrieb, während die christliche Praxis bei
scheiden sich, das Leben wird hier zum Gefängnis, dort
zum Kriegsstand und nur die christlichen Verächter des
Todes werden die Sieger sein." Fort also nicht nur mit
aller Unreinheit und den Opfern des eigentlichen Götzendienstes,
mit dem Gepränge und den Lustbarkeiten der
Ringkämpfe und Schauspiele, mit allem Luxus des Lebens,
mit allem Schmuck des äusseren Menschen, auch mit dem
Siegeskranz des Soldaten: fort auch mit allen irdischen
Geistesgütern, die zu geniessen erlaubt wäre, wenn nicht
der Dämonen Bosheit alles verdürbe im Dienste des Satans,
welcher der Regent dieses Aeon ist. Los von der Philosophie;
denn Stoff und dialektische Denkart giebt sie der
Häresie, die zwar auch aus der Kirche heraus entstand,
aber so "wie auch der saure Wildling aus dem Kern des
milden, fetten, süssen Oelbaumes entspriessen kann." Wir
haben nicht nöthig, vorwitzige Fragen zu erforschen, nachdem
Jesus Christus geboren. Wir haben eine Regel des
Glaubens. Was haben Jerusalem und Athen, was die
Kirche und die Akademie gemein? —Los auch vom Handelsverkehr
und Erwerb des Reichtums, die eines Dieners
Gottes nicht würdig sind; "der Glaube hat . den Hunger
wie jede Art des Todes um Gottes willen zu verachten."
Die Ehe kann als die "Gemeinschaft zweier Getreuen auf
gleiche himmlische Hoffnung, gleiche Zucht und Dienstleistung"
gepriesen werden. Aber wie die zweite Ehe Ehebruch,
so bleibt der Ruhm der Virginität als solcher bestehen
— ein heilig Seitenstück zur Disziplin. des Fastens,
das Tertullian dem Essen gelegentlich gegenübersteht wie
Heil dem Unheil. Und alles dieses im Dienste eines Ideals
von christlicher Vollkommenheit, dessen Ueberspannung die
bedenkliche Theorie von verschiedenen Graden christlicher
Heiligkeit hervortrieb, während die christliche Praxis bei
 Vornehm und. Gering vielfach selbst unter den Tiefpunkt
des Erlaubten hinuntersank.
Vornehm und. Gering vielfach selbst unter den Tiefpunkt
des Erlaubten hinuntersank.
Zwei Thatsachen beschränken nicht unwesentlich die Geltung und Bedeutung dieses düsteren Bildes. Zuerst der propagandistische Eifer, der merkwürdigerweise gerade bei dieser rigoristischen Form des Christentums, wie auch noch bei den sinnverwandten Schismatikern des vierten Jahrhunderts, von ganz besonders stürmischer Art war und. ein widerspruchsvolles Schwanken zwischen Gedanken der Weltflucht und Trieben der Welteroberung erzeugt. Hinter diesem Widerspruch aber steht zweitens als dessen erklärende Ursache das auch hier niemals abhanden gekommene. Bewusstsein: dass im letzten Grunde nicht die Welt als solche, sondern nur die heidnisch infizirte Welt von der Kriegsmannschaft Christi zu bekämpfen ist; ein Satz, den Tertullian . in seinem "Apologeticus" mehrfach betont und in seinen Ausführungen gegen den Gnostiker Marcion zu wiederholen nicht müde wird — eine folgerichtige Analogie zu dem bekannten Wort von dem "Zeugnis der von Natur christlichen Menschenseele".
Richtig bleibt immerhin, dass diese freundlichere Ansicht über das Weltleben auf dem Boden der lateinisch-christlichen Gesinnungen keine durchgreifende, grundsätzliche Bedeutung gewonnen hat. Etwas davon vollzog sich unter den Auspizien des alexandrinischen Geistes auf dem Gebiet des griechischen Christentums. Allerdings sind Naturen wie Origenes und sein Lehrer Clemens nichts weniger als harmonische Einheiten und ihre Lehre nichts weniger als, was sie gern wäre, ein einheitliches System. . Notwendig blieben die ersten bewussten Versuche, die auf dem Boden des Judentums erwachsenen christlichen Grundbegriffe mit den philosophischen Voraussetzungen hellenischen Denkens
 zu verständigen, irgendwie in dem Widerspruch der beiderseitigen
Provenienz hängen. So bekunden auch die genannten
griechischen Väter etwas von jener inneren Zwiespältigkeit,
welche gerade die geistesstärksten und unbefangensten
unter den Vätern überhaupt kennzeichnet und dem eilfertigen
Blick unverständlich macht.
zu verständigen, irgendwie in dem Widerspruch der beiderseitigen
Provenienz hängen. So bekunden auch die genannten
griechischen Väter etwas von jener inneren Zwiespältigkeit,
welche gerade die geistesstärksten und unbefangensten
unter den Vätern überhaupt kennzeichnet und dem eilfertigen
Blick unverständlich macht.
Auch bei Clemens also und noch mehr bei Origenes wird einer weitgehenden Enkratie das Wort geredet. Aber die Askese soll hier nicht mehr Darstellung christlicher Reinheit im Gegensatz gegen eine satanische Welt, sie soll Übung sein zum Vollbesitz der in der Menschenseele vorzeitlich angelegten Willensfreiheit, ein "reinigendes Handeln", wie neuplatonische und christliche Gesichtspunkte es gleichermassen fordern. Und im übrigen gewinnt nun das Vertrauen zu Menschennatur und Weltleben unter der Voraussetzung "christlicher Pädagogie" zusehends an klarer Ruhe und bewusster Begründung. Wenn doch alles am Golde und am Weibe hängt, wenn das gesammte, schon das biblische Urchristentum immer wieder unter diesen beiden Aspekten die heidnische Auffassung des Lebens kennzeichnet und bekämpft, so findet Clemens, bei aller Ängstlichkeit, die sich von der lateinischen Energie offenbar imponiren lässt, für beide Kapitel eine Art der Erledigung, die nunmehr eine pathologische Beurteilung ausschliesst und auch eine mehr als nur geschichtliche Bedeutung hat. Hier ist endlich nach evangelisch-christlichem Begriffe die Ehe in ihre vollen natur- und vernunftgemässen Rechte wieder eingesetzt. Achtung dem Cölibat, das der Keuschheit den Schwur hält; aber Preis der Ehe, der kindergesegneten zumal, um ihrer selbst und um des Staates willen! Und Lob der wackern Hausfrau, dieser Priesterin aller gottgeweihten Tugenden der vorsorglichen Liebe! Dem
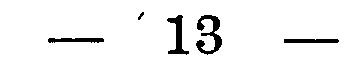 christlichen Vollkommenheitsideal entspricht die zweite Ehe
nicht, aber den Fluch der Sünde trägt auch sie nicht in
sich selber. — Und auch der Reiche kann selig werden,
sagt eine besondere Schrift des Clemens, wofern er nämlich
die sittlichen Gefahren des Besitzes überwindet und die
Seligkeit reichlichen unbedenklichen Gebens kennt. Wie
eine stetige Zucht des Körpers zu Gunsten der sittlichen
Freiheit höher steht als selbst das einmalige bekenntnistreue
Martyrium, so ist der rechte Gebrauch des Erworbenen
mehr wert als die Entsagung von Erwerb und Besitz.
christlichen Vollkommenheitsideal entspricht die zweite Ehe
nicht, aber den Fluch der Sünde trägt auch sie nicht in
sich selber. — Und auch der Reiche kann selig werden,
sagt eine besondere Schrift des Clemens, wofern er nämlich
die sittlichen Gefahren des Besitzes überwindet und die
Seligkeit reichlichen unbedenklichen Gebens kennt. Wie
eine stetige Zucht des Körpers zu Gunsten der sittlichen
Freiheit höher steht als selbst das einmalige bekenntnistreue
Martyrium, so ist der rechte Gebrauch des Erworbenen
mehr wert als die Entsagung von Erwerb und Besitz.
In gleicher Richtung tritt dann Origenes und zwar mit umfassender prinzipieller Begründung für die Rechte und Pflichten des selbstthätigen geistigen Erwerbes ein. Hohe Zeit sei es, das Christentum auf dem Boden der geistig verstandenen heiligen Schriften nach der Denkmethode der Philosophie zu einem System zu erheben, das denen der Griechen "formell ebenbürtig, materiell überlegen" sei. Daraus folgt für den einzelnen Christen die entsprechende Aufgabe, nach besten Kräften das "im Glauben nur aufgethane" Auge stufenweise zu üben und zu schärfen bis zu einem selbständigen Erkennen der religiösen Wahrheit, welches den geschichtlichen Wortsinn der heiligen Schriften entbehren kann, weil es ihren ideellen Gehalt besitzt und davon lebt. — Was Origenes von diesen Grundsätzen aus im einzelnen geleistet, betrifft uns in diesem Zusammenhange nicht. Dass er mit seiner Lehre von der Schriftauslegung die exegetische Zucht gelockert und an ihre Stelle die Exegese der erbaulichen und unerbaulichen Einfälle gesetzt hat, ist eine Thatsache, deren unerfreuliche Nachwirkungen noch die heutige Schrifterklärung vielfach aufhalten. Die Dogmengeschichte verdankt vornehmlich seiner Spekulation das endlose Kapitel von der christologischen
 Wirrsal. Aber sein Wollen war ein ächt wissenschaftliches,
auch dem Zusammenhang der christlichen Erkenntnis
mit der sonstigen litterarischen Zeitbildung entschieden
zugewandt; und der Ertrag seines eigenen, vielseitigen
und unermüdlichen Fleisses war kein geringerer
als, um alles in einem zu sagen, die Begründung einer
christlichen Theologie.
Wirrsal. Aber sein Wollen war ein ächt wissenschaftliches,
auch dem Zusammenhang der christlichen Erkenntnis
mit der sonstigen litterarischen Zeitbildung entschieden
zugewandt; und der Ertrag seines eigenen, vielseitigen
und unermüdlichen Fleisses war kein geringerer
als, um alles in einem zu sagen, die Begründung einer
christlichen Theologie.
II.
Welche von diesen beiden Strömungen ist nun die wesentlich christliche?
Eduard Zeller führt in seinem bekannten Aufsatz über das Urchristentum den Satz durch: als ein epochemachendes geschichtliches Prinzip erschliesse das Christentum sein Wesen auch nur in dem Ganzen seiner geschichtlichen Erscheinung; deshalb könne man, was es sei, nur aus dem abnehmen, was es geworden; das Urchristentum verstehe man nur aus der Kirchengeschichte.
Folgen wir dieser Weisung, übrigens mit allem Vorbehalt gegen die Wahrheitsgrenze dieser Geschichtsbetrachtung, so scheint, rein äusserlich genommen, das Kennzeichen des dritten und vierten Jahrhunderts in einer wesentlich verstärkten und. immer nur wachsenden Zuversicht zu Welt und Leben zu bestehen. Die empfindlich realen Mächte des römischen Imperiums fassen das Christentum zuerst noch einigemal unsanft an und zwingen es in blutiger Fehde, sich tief mit ihnen einzulassen. Dann aber, als es triumphirt, setzt es sich nun auch in der errungenen Weltposition ganz entschlossen fest. Sie ist ihm inzwischen vertraut geworden. Den Glauben an das baldige Eintreffen der erhofften messianischen Reichsherrlichkeit lässt es endgiltig fallen. Die dadurch gebotene Wendung von der
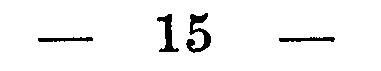 erträumten Welt zur wirklichen wird nur verstärkt durch
den immer zunehmenden irdischen Erfolg, der einstweilen
den denkbar tröstlichsten Ersatz für die dahingesunkene
überirdische Hoffnung bildet.
erträumten Welt zur wirklichen wird nur verstärkt durch
den immer zunehmenden irdischen Erfolg, der einstweilen
den denkbar tröstlichsten Ersatz für die dahingesunkene
überirdische Hoffnung bildet.
Innere Ursachen kommen hinzu, den Siegeszug des Kreuzeszeichens zu beflügeln. Während die römische Geisteswelt in grundsätzliche Skepsis, unpopuläre philosophische Restauration und abergläubischen Dämonenkultus auseinanderstrebt, steht das Christentum in kraftstrotzender Gewissheit des religiös-sittlichen Wahrheitsbesitzes da. Zugleich ist es ja grundsätzlich frei von aller Rücksicht auf die Schranken der Volkstümer und der nationalen Kulte und in dieser Freiheit fähig, "den Riesenleib des römischen Weltreichs gleichmässig zu' beseelen." Und nun wird es überdies, zumal seit Cyprians Einheitsruf, äusserlich zusammengefasst und zusammengehalten, nämlich, durch die Anfänge einer verfassungsmässigen klerikalen Organisation, die ihre Netze immer weiter 'auswirft und ihre Maschen immer enger zieht.
So übersteht es denn mit nur erhöhtem Selbstgefühl die letzten, nun wirklich allgemeinen Verfolgungen. So nimmt es als Sieger die Huldigung des Cäsarenreichs entgegen. So tritt es das Erbe der römisch-heidnischen Kultur an; hier und da wohl mit einigem Zagen vor der Gunst des Glücks und den Gefahren des vielfarbigen neuen Reichtums, stellenweise auch — und nicht im Klerus allein — sehr bald von den schlechten und schlechtesten Künsten der Verweltlichung angefressen, aber im ganzen mit der durchschlagenden Zuversicht, jenes Erbe in den Bestand seiner eigentümlichen sittlichen. Werte und Ideale nach und nach gliedlich einzufügen. Dann giebt es dem unterworfenen Weltstaat eine ganze Wendung zum unmittelbaren
 Dienst an dem "Gottes-Staat", welcher im Bewusstsein der
siegreichen Christenheit immer mehr die Gestalt des ökumenischen
Kirchentums annimmt. Zugleich webt es sich ein
dogmatisches Gewand. Der Zettel ist die katholische Tradition,
wie vornehmlich Athanasius sie christologisch zusammenfasst.
Der Einschlag aber ist ganz und gar griechischer
Herkunft, dem neuerstandenen Platonismus entstammend;
und sowol in Bezug auf das Material der metaphysischen
Begriffe als auch hinsichtlich der dialektischen Methode
lebt das dogmatische Raisonnement im innigen Anschluss
an hellenische Muster. Es sagt sich später von ihnen los,
aber erst, als es dieselben für seine Zwecke gründlich ausgenutzt
hat. —
Dienst an dem "Gottes-Staat", welcher im Bewusstsein der
siegreichen Christenheit immer mehr die Gestalt des ökumenischen
Kirchentums annimmt. Zugleich webt es sich ein
dogmatisches Gewand. Der Zettel ist die katholische Tradition,
wie vornehmlich Athanasius sie christologisch zusammenfasst.
Der Einschlag aber ist ganz und gar griechischer
Herkunft, dem neuerstandenen Platonismus entstammend;
und sowol in Bezug auf das Material der metaphysischen
Begriffe als auch hinsichtlich der dialektischen Methode
lebt das dogmatische Raisonnement im innigen Anschluss
an hellenische Muster. Es sagt sich später von ihnen los,
aber erst, als es dieselben für seine Zwecke gründlich ausgenutzt
hat. —
Auch die bildende Kunst muss die neue Weltstellung des Christentums mit ihrem kostbarsten Schmucke verherrlichen. Was sie vom Christentum her an neuen künstlerischen Motiven überkommt, ist ihr noch zu fremdartig oder in sich selbst zu dürftig, um jetzt schon eine christliche Kunst zu inauguriren. Aber was Schönstes im Dienste der alten Götter geschaffen ward, muss die neuen Mysterien zieren: An christlichem Widerspruch fehlt es nicht. Hatte doch schon im zweiten Jahrhundert Tatian, der Schüler Justins auf seinen Reisen an den erlauchtesten Bildwerken, zumal in Rom, nur das eine erstaunlich gefunden, wie vielen Buhlerinnen, Mördern und Ehebrechern das Heidentum die höchsten Ehren angetan; und ein Athenagoras glaubte einst den Kaiser Marc Aurel in seiner "Fürbitte für die Christen" auch mit der Erwägung unterhalten zu sollen: wie wenig es doch mit diesen, von der Kunst verherrlichten Gottheiten sei, da man ja von allen die Verfertiger kenne. Ganz in demselben Sinne macht sich jetzt im vierten Jahrhundert der Neophyten-Eifer des Arnobius
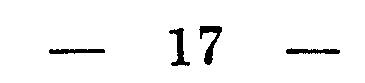 daran, die Götter-Statuen, die er gesehen, deshalb zu verhöhnen,
weil sie hohl seien, wie die von Elfenbein, oder
der hölzernen und eisernen Stützen bedürfen. Und höchst
fanatisch fährt Firmicus Maternus noch die Söhne Konstantins
des Grossen mit bilderstürmerischen Mahnungen
an. Aber im Ganzen lernt die ökumenische Kirche sehr
schnell, die weithin verstreuten Tempelschätze der heidnischen
Kunst zu Gunsten ihrer Sanktuarien zu schätzen und
zu plündern — "was den einigen Gott nun ehrt, Altar und
Geräthe, schmückte zu anderem Dienst einst der Olympier
Haus." Auch das, was christlicher Sinn selbstthätig für den
Schmuck des häuslichen Lebens wie der Gotteshäuser und
Begräbnisstätten in künstlerischer Gestalt zu schaffen versucht,
schliesst sich, wie neuere kunsthistorische Forschung
uns belehrt, vorzugsweise antiken Vorbildern an. Einer der
strengsten bischöflichen Eiferer gegen das Heidentum, der
Dichter Prudentius, nimmt zu dem Streit über die Viktoriastatue
im römischen Senat keineswegs als Böotier Stellung.
Sein Konstantin ladet vielmehr ausdrücklich die Väter ein,
die marmornen Bilder als Werke grosser Künstler zu hüten
und zu ehren; nur heidnischer Missbrauch soll dieselben
nicht mehr entweihen.
daran, die Götter-Statuen, die er gesehen, deshalb zu verhöhnen,
weil sie hohl seien, wie die von Elfenbein, oder
der hölzernen und eisernen Stützen bedürfen. Und höchst
fanatisch fährt Firmicus Maternus noch die Söhne Konstantins
des Grossen mit bilderstürmerischen Mahnungen
an. Aber im Ganzen lernt die ökumenische Kirche sehr
schnell, die weithin verstreuten Tempelschätze der heidnischen
Kunst zu Gunsten ihrer Sanktuarien zu schätzen und
zu plündern — "was den einigen Gott nun ehrt, Altar und
Geräthe, schmückte zu anderem Dienst einst der Olympier
Haus." Auch das, was christlicher Sinn selbstthätig für den
Schmuck des häuslichen Lebens wie der Gotteshäuser und
Begräbnisstätten in künstlerischer Gestalt zu schaffen versucht,
schliesst sich, wie neuere kunsthistorische Forschung
uns belehrt, vorzugsweise antiken Vorbildern an. Einer der
strengsten bischöflichen Eiferer gegen das Heidentum, der
Dichter Prudentius, nimmt zu dem Streit über die Viktoriastatue
im römischen Senat keineswegs als Böotier Stellung.
Sein Konstantin ladet vielmehr ausdrücklich die Väter ein,
die marmornen Bilder als Werke grosser Künstler zu hüten
und zu ehren; nur heidnischer Missbrauch soll dieselben
nicht mehr entweihen.
Es versteht sich von selbst, dass bei alledem die mächtige Strömung, die wir kurz als die tertullianische bezeichneten, auch jetzt sich Geltung und Gestalt verschaffte. Gar vieles spricht dafür, dass einem Teil der Christenheit und nicht dem schlechtesten bei dieser Säkularisirung des christlichen Gottesreichsgedankens nicht wohl war; dass die unheimlich schnell gewordene Staatskirche und der nun langsam werdende Kirchenstaat durchaus nicht überall als die adäquaten Formen gelten, in welchen das Kreuzeszeichen seine Hegemonie in der Welt befestigen
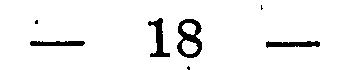 sollte. Aus dem Reichtum der dahin gehörigen Thatsachen
heben wir. nur zwei hervor als die unstreitig bezeichnendsten:
das Mönchtum und das Anathema über Origenes.
sollte. Aus dem Reichtum der dahin gehörigen Thatsachen
heben wir. nur zwei hervor als die unstreitig bezeichnendsten:
das Mönchtum und das Anathema über Origenes.
Was zunächst das Mönchtum angeht, dessen geschichtliche Entstehung und Natur seit einem Jahrzehnt wieder ein bevorzugter Gegenstand kirchengeschichtlicher Diskussion ward, so hätte ja allerdings die altvettelische Ansicht, die, um der Kirche nicht wehe zu thun, die hervorbringenden Kräfte des Mönchtums von ausserchristlichen, jüdisch gesetzlichen oder heidnisch asketischen Einflüssen, ableitete, längst die wohlverdiente Ruhe finden dürfen. Nein, aus den Skrupeln des Christentums selbst über seine Verweltlichung ist das Mönchtum entstanden, eine Weckstimme und Verwarnung des christlichen Gewissens, das Symbol einer Sühne, die der verletzten Gottesreichsidee geschuldet wird. Von der Geschichte des Christentums ist deshalb das Mönchtum wirklich nicht wegzudenken. Aber auch vom Christentum nicht? Giebt das Mönchtum nicht vielmehr durch seine eigene weitere Geschichte unfreiwillig selber zu, ein gebotenes Extrem zu sein als Gegengewicht gegen ein anderes? Oder doch nur eine Art, dem Christentum zu dienen, neben der kirchlichen? Wie hätte es sich sonst in wachsendem Masse der mittelalterlichen Kirche zur Verfügung stellen und so willig entgegenkommen können, als die Kirche ihrerseits nicht nur unbedenklich, sondern geradezu eifersüchtig seine besten Kräfte für ihre Zwecke an sich zog? — Noch lehrreicher ist die Stellung des Mönchtums zur Wissenschaft. Vorab geneigt, die Kirche zu stützen, wird es seinen eigenen ältesten Traditionen untreu und. tritt dem katholischen Traditionalismus im Kampf gegen die Fortwucherungen der theologischen Gnosis zur Seite. Aber man bringe dies vollwertig in Anschlag und
 würdige das Mönchtum nur insofern, als es seinen Namen
mit der Erhaltung aller nur denkbaren Studienmittel auf
geistlichem und weltlichem Gebiet Jahrhunderte lang innigst
verband: als Lebensretter des Christentums kann es nimmermehr
gelten, wenn doch das Christentum von Hause aus aller
Wissenschaft abgeneigt, ja feindlich sein soll. Von diesen
beiden geschichtlichen Urteilen schliesst eines das andere aus.
würdige das Mönchtum nur insofern, als es seinen Namen
mit der Erhaltung aller nur denkbaren Studienmittel auf
geistlichem und weltlichem Gebiet Jahrhunderte lang innigst
verband: als Lebensretter des Christentums kann es nimmermehr
gelten, wenn doch das Christentum von Hause aus aller
Wissenschaft abgeneigt, ja feindlich sein soll. Von diesen
beiden geschichtlichen Urteilen schliesst eines das andere aus.
Verwickelter ist die Frage nach der rechten historischen Wertung der origenistischen Streitigkeiten unter dem Gesichtspunkt der vorliegenden Frage. Zweifellos ist, dass die Verdammung des Origenes bei Gelegenheit der christologischen Kämpfe nicht seiner Christologie als solcher, sondern seiner Theologie überhaupt, besser: seiner Theologik, seiner theologischen Erkenntnislehre galt. Zweifellos ist ferner, dass die sogenannten origenistischen Streitigkeiten nicht mit einigen einzelnen Jahreszahlen zu fixiren sind, sondern zum wesentlichsten Inhalt der Kirchengeschichte dreier Jahrhunderte gehören. Aber eben dieses lange Ringen deutet doch ziemlich bestimmt darauf hin, dass der endlich unterliegende Teil, der übrigens bei den Griechen noch im fünften Jahrhundert vollkommen aufrecht stand, sich seines vollen prinzipiellen Rechtes nicht ohne Grund bewusst war. Und als er endlich im sechsten Jahrhundert im christlichen Orient niedergeworfen ward, da brach dann auch über dasselbe Kirchengebiet für alle Folgezeit die Vergeltung herein in Form eines geistigen Stillstandes und speziell einer dogmatischen Versimpelung, gegen welche weder der dogmatische Sammelfleiss des Damaszeners noch die sporadischen litterarischen Selbstbezeugungen der griechischen Mystik, von Pseudodionys bis Nicolaus Cabasilas aufkommen konnten.
Im Abendland war es vornehmlich unter dem Einfluss des vielgewandten und wandlungsfähigen Hieronymus schon
 früher dahin gekommen, dass Origenes in der Person seines
Übersetzers Rufinus mit dem Bann belegt wurde. Aber
wie wenig das gefruchtet, wurde in lehrreichster Weise
schon wenige Jahrhunderte später offenbar, als unter der
anregenden Gunst karolingischer Könige die niemals erstickten
Keime autonomen theologischen Forschens mächtig
aufgingen und besonders in Johannes Scotus Erigena eine
Kraft ureigenen systematischen Denkens und weit vorausschauender
theologischer Spekulation zum Durchbruch kam,
die dem Geist des Origenes volle Genugtuung verschaffte
und einige Jahrhunderte später wieder verdammt werden
musste, weil sie nicht zu überwinden war.
früher dahin gekommen, dass Origenes in der Person seines
Übersetzers Rufinus mit dem Bann belegt wurde. Aber
wie wenig das gefruchtet, wurde in lehrreichster Weise
schon wenige Jahrhunderte später offenbar, als unter der
anregenden Gunst karolingischer Könige die niemals erstickten
Keime autonomen theologischen Forschens mächtig
aufgingen und besonders in Johannes Scotus Erigena eine
Kraft ureigenen systematischen Denkens und weit vorausschauender
theologischer Spekulation zum Durchbruch kam,
die dem Geist des Origenes volle Genugtuung verschaffte
und einige Jahrhunderte später wieder verdammt werden
musste, weil sie nicht zu überwinden war.
III.
Alles in allem lässt sich nicht eben behaupten, dass der konstantinischen und nachkonstantinischen Zeit sonderlich viel Material zur Begründung der, kurz gesagt, pessimistischen Auffassung des Christentums einwohnte. Aber auch, wenn wir vor die Epoche zurückgehen, von welcher wir unsern Ausgangspunkt nahmen — und dieser regressive Weg ist wohl in jedem Betracht der zuverlässigere — so stehen wir in erster Linie vor einer litterarischen Grösse höchsten Ranges, die schon in ihren ersten Aussagen sich als die recht eigentlich hervorbringende Macht für die spätere christliche Gnosis bekundet, dem Evangelium Johannis; und. stehen zweitens vor der bedeutungsvollen Thatsache einer fast allgemeinen Anerkennung dieses Logosbuches im ganzen Bereich der werdenden Kirche.
Das ist das Evangelium, welches als erstes Zeichen Jesu die Weinspende auf dem Hochzeitsfest zu Kana berichtet und auf seinem ersten Blatte die geschichtliche Erscheinung des hehren Spenders als Fleischwerdung des göttlichen
 Wortes erklärt. Die \alte Streitfrage nach den alexandrinischen
Zusammenhängen dieses Evangeliums muss hier unerörtert
bleiben: das ist sicher, dass die alte philosophische
Tradition über die unvereinbare Gegensätzlichkeit von Stoff
und Geist, von Gott und Welt hier nicht mehr unumschränkt
herrscht. Wohl macht sie sich in einer mysteriösen,
hie und da gleichsam schattenhaften (,,doketischen")
zeichnung geltend, die dem Erdenwallen des Gottessohnes
zu Teil wird. Aber im Prinzip ist es doch ausgesprochen:
der Logos kann Fleisch werden. Nach anfänglichem
Widerstreben der in dem Dunkel der Sünde befangenen Welt
findet der Fleischgewordene eine Gemeinde, die sich allmälich
ausbreiten wird, bis alle eine Herde unter einem
Hirten werden. Von einem nahen Weltende ist hier also
keine Rede. Aus der Wiederkunft Christi ist sein Wohnungmachen
in den Herzen geworden, aus dem messianischen
Triumphator die Geistesgestalt des Parakleten, welcher die
Gemeinde Christi von Stufe zu Stufe in alle Wahrheit
leiten und die gläubige Menschheit ihrem Urbilde nachbilden
wird. Licht und Finsternis sind nicht mehr metaphysische
Begriffe, sondern ethische. Von dem nervösen Gedanken
also, der dem. spätem christlichen Rigorismus entstammt,
dass die empirische Welt überhaupt kein würdiger
Schauplatz für das Gottesreich sei, weiss die erhabene Ruhe
und andächtige Gottesgewissheit dieses "einen, rechten,
zarten" Evangeliums nichts.
Wortes erklärt. Die \alte Streitfrage nach den alexandrinischen
Zusammenhängen dieses Evangeliums muss hier unerörtert
bleiben: das ist sicher, dass die alte philosophische
Tradition über die unvereinbare Gegensätzlichkeit von Stoff
und Geist, von Gott und Welt hier nicht mehr unumschränkt
herrscht. Wohl macht sie sich in einer mysteriösen,
hie und da gleichsam schattenhaften (,,doketischen")
zeichnung geltend, die dem Erdenwallen des Gottessohnes
zu Teil wird. Aber im Prinzip ist es doch ausgesprochen:
der Logos kann Fleisch werden. Nach anfänglichem
Widerstreben der in dem Dunkel der Sünde befangenen Welt
findet der Fleischgewordene eine Gemeinde, die sich allmälich
ausbreiten wird, bis alle eine Herde unter einem
Hirten werden. Von einem nahen Weltende ist hier also
keine Rede. Aus der Wiederkunft Christi ist sein Wohnungmachen
in den Herzen geworden, aus dem messianischen
Triumphator die Geistesgestalt des Parakleten, welcher die
Gemeinde Christi von Stufe zu Stufe in alle Wahrheit
leiten und die gläubige Menschheit ihrem Urbilde nachbilden
wird. Licht und Finsternis sind nicht mehr metaphysische
Begriffe, sondern ethische. Von dem nervösen Gedanken
also, der dem. spätem christlichen Rigorismus entstammt,
dass die empirische Welt überhaupt kein würdiger
Schauplatz für das Gottesreich sei, weiss die erhabene Ruhe
und andächtige Gottesgewissheit dieses "einen, rechten,
zarten" Evangeliums nichts.
Aber die geschichtliche Betrachtung der urchristlichen Gedankenentwicklung kommt auch hier nicht zur Ruhe. Neben diesem johanneischen Schriftwerk steht die "Lehre der zwölf Apostel", ein litterarisches Denkmal von ziemlich nahverwandtem Zeitursprung und von nicht viel geringerer historischer Bedeutsamkeit, aber ganz anders
 geartet, voll und ganz in die alte Wiederkunftserwartung
eingetaucht; ganz auffallend undogmatisch, in seiner Ethik
schlicht, aber herb bis zum Extrem strenger Fasten-Konsilia.
Und durch dies monumentale Doppeltor der nachapostolischen
Zeit können wir auf die genuin-apostolische
Zeit nicht zurückschauen, ohne in dieser selbst die hervorbringende
Quelle all' der Zwiespältigkeit zu sehen,
zwischen deren widersprechenden Kundgebungen wir bisher
hin und her geworfen wurden.
geartet, voll und ganz in die alte Wiederkunftserwartung
eingetaucht; ganz auffallend undogmatisch, in seiner Ethik
schlicht, aber herb bis zum Extrem strenger Fasten-Konsilia.
Und durch dies monumentale Doppeltor der nachapostolischen
Zeit können wir auf die genuin-apostolische
Zeit nicht zurückschauen, ohne in dieser selbst die hervorbringende
Quelle all' der Zwiespältigkeit zu sehen,
zwischen deren widersprechenden Kundgebungen wir bisher
hin und her geworfen wurden.
Ein sonderbarer Irrtum, der freilich nur bei sehr mässiger Kenntnis des Neuen Testaments vorkommen kann, unternimmt es vielfach, die beiden verschiedenen Strömungen altchristlicher Ethik auf die apostolische Zeit so zu verteilen, dass die judenchristliche Richtung vorzugsweise die düstere, weltabgewandte Anschauung vertrete, die heidenchristliche, geistesfreiere Richtung aber, unter dem Losungswort: "den Griechen ein Grieche", in mehr optimistischer Gesinnung dem Weltleben und seinen Gütern entgegen komme. Nichts kann falscher sein. Um das sofort klar zu erkennen, brauchen wir uns nur an den eigentlichen Helden apostolischer Geistesfreiheit, den Apostel Paulus zu halten. Wer an dem geheimen Ringen widersprechender religiössittlicher Strebungen in einem und demselben gigantischen Charakter Anteil zu nehmen vermag, hier findet er dazu reichlichsten Anlass. Paulus hat sich nicht, wie die anderen Apostel, in persönlichem täglichem Verkehr mit dem Meister in sein Vertrauen zu ihm hineingelebt. Ein gewaltsamer Zusammenbruch musste erst seinem Widerchristentum ein Ende bereiten, bevor er von der Übermacht einer neuen, mit Blitzeshelle auf ihn andringenden Überzeugung überwältigt wurde. Gewaltsam, wie einst sein alter und sein neuer Glaube, rangen nun auch innerhalb des letzteren zwei Strömungen mit
 einander. Einerseits geht es ihm, dem Nachgeborenen, begreiflicherweise,
wie es den apostolischen Führern des Judaismus
trotz ihrer originalen Erkenntnisquelle aus Missverständnis
auch erging: er weiss den am Holz der Schande Gestorbenen
nur dann als siegreichen Herrn zu verstehen, wenn er auf
ihn den jüdischen Glauben an die weltbeendende Wiederkunft
des verherrlichten Messias überträgt. Andererseits
hat er in geisteskräftiger Denkarbeit das Lebenswerk Jesu
so energisch im innersten Zentrum desselben erfasst, dass
die sittlichen Gesichtspunkte, die Idee der christlichen Gerechtigkeit
oder Vollkommenheit, sein ganzes Denken beherrschen
wollen und ihn fort und fort auf das irdische
Arbeitsfeld dieser Ideen hinweisen.
einander. Einerseits geht es ihm, dem Nachgeborenen, begreiflicherweise,
wie es den apostolischen Führern des Judaismus
trotz ihrer originalen Erkenntnisquelle aus Missverständnis
auch erging: er weiss den am Holz der Schande Gestorbenen
nur dann als siegreichen Herrn zu verstehen, wenn er auf
ihn den jüdischen Glauben an die weltbeendende Wiederkunft
des verherrlichten Messias überträgt. Andererseits
hat er in geisteskräftiger Denkarbeit das Lebenswerk Jesu
so energisch im innersten Zentrum desselben erfasst, dass
die sittlichen Gesichtspunkte, die Idee der christlichen Gerechtigkeit
oder Vollkommenheit, sein ganzes Denken beherrschen
wollen und ihn fort und fort auf das irdische
Arbeitsfeld dieser Ideen hinweisen.
So ist denn für den grossen Heidenapostel, bei aller Erregtheit seiner Wiederkunfts-Erwartung, ein Gedanke wie derjenige der Apokalypse unvollziehbar: da der Tag des Gerichts unmittelbar bevorstehe, so solle kein Ungerechter durch eine doch verspätete Umkehr den schon heranrollenden Donner des allmächtigen Zornes zu beschwichtigen meinen, sondern nur bei der Unreinheit des bisherigen Wandels verharren; das Gerichtsbuch sei geschlossen. Die Absolutheit des Sittengesetzes für alle Menschen, Zeiten und Orte steht für Paulus überhaupt als erstes, unverrückbares Axiom allen anderen voran. Nur für solche denkt er überhaupt, denen das sittliche Streben erstes und letztes Verlangen der Seele ist. Nur für solche begründet er im Römerbrief den Satz: dass es keine Moral gebe, die Kraft habe und zum Ziel führe, als die religiös gegründete; und für sie illustrirt er diesen Satz an dem sittlichen Bankerott, der mit gleicher Unerbittlichkeit die selbstgenügsame Moral des Heidentums wie die selbstquälerische, gesetzliche des Judentums getroffen habe. Und so fest stehen die moralischen
 Gesichtspunkte im beherrschenden Vordergrund der
systematischen Gedankengänge Pauli, dass es ihm, trotz
aller Bemühung um präzises Auseinanderhalten benachbarter
Begriffe, nicht gelingt, die Elemente seiner physischen
Anthropologie von dem Hinüberwirken ethischer Kategorien
rein zu erhalten, wie u. a. auch Siebeck in seiner Geschichte
der Psychologie treffend nachweist.
Gesichtspunkte im beherrschenden Vordergrund der
systematischen Gedankengänge Pauli, dass es ihm, trotz
aller Bemühung um präzises Auseinanderhalten benachbarter
Begriffe, nicht gelingt, die Elemente seiner physischen
Anthropologie von dem Hinüberwirken ethischer Kategorien
rein zu erhalten, wie u. a. auch Siebeck in seiner Geschichte
der Psychologie treffend nachweist.
Aber nach einem verstandesmässigen Begreifen des Gedankengehaltes, der ihm in seiner neuen Überzeugung geworden ist, ringt Paulus eben doch; und er thut es im. klar festgehaltenen Zusammenhange mit dem Wissen und den Beweismethoden, die er in der theologischen Schule des Pharisäismus erlernt und, nach dem Dafürhalten von einigen Neueren, mit griechischer Bildung bereichert hat. Die falsche Weisheit, die er bekämpft, ist die, für welche die Realität des Übersinnlichen überhaupt nicht in Betracht kommt, die in den Elementen des sinnlichen Kosmos stehen bleiben will, und daher die Wertlegung auf religiöse Motive im Interesse des sittlichen Lebens, als Thorheit erachtet. Aber innerhalb der Prämissen seines christlichen Gottesglaubens ist sein eigenes theologisches Denken rührig und rücksichtslos und scheut auch vor den Schwierigkeiten nicht zurück, welche eine geschichtsphilosophische Betrachtung der bisherigen religiös-sittlichen Entwicklung des Menschengeschlechtes mit sich bringt.
Im weitern Verfolg dieser Geistesrichtung gewinnt dann Paulus für die sittlichen Güter dieser Weit überhaupt eine gerechte Würdigung. Der Staat gehört zur Weltordnung Gottes. Dass er heidnischer Staat ist, ändert nichts an der Gewissenspflicht, ihm zu gehorchen, weil er auch in dieser empirischen Erscheinungsform dem Guten dient, zu Nutz und Frommen des Einzelnen und der Gemeinschaft. Die
 Arbeit, sowohl die des Broderwerbs als auch die, welche
im Dienste idealer Berufsart steht, ist als solche ehrwürdig.
"Mit eigenen Händen" ist die selbstbewusste Parole der
ersteren; in Bezug auf die andere beurteilt sich Paulus
nicht minder streng und findet vor seinem Gewissen nur
darin Ruhe, dass er, der frühere Verfolger der Gemeinde,
nun doch sein Leben noch mit einem Berufswerk ausgefüllt
hat, welches, wie er hofft, vor dem höchsten Gericht
bestehen kann. Auch in Bezug auf die Verteilung der
irdischen Güter hegt Paulus seine Ideale und giebt sie
bei Gelegenheit seiner Kollekte für die palästinischen Gemeinden
den Korinthern kund: Nicht wehe sollt ihr euch
thun, um den anderen aufzuhelfen; nur eine Ausgleichung
soll es sein. Was ihr an zeitlichen Gütern mehr habt, soll
für das gut sein, das jene weniger haben... Wie geschrieben
steht: "Wer viel hat, ward nicht reich und wer wenig hat,
nicht arm." Dem Philemon schickt er seinen Sklaven,
der inzwischen durch Pauli Unterweisung Christ geworden,
mit den Worten zurück: "nimm ihn wieder auf, nicht als
einen Sklaven, sondern als einen Bruder." Das heisst
doch jedenfalls nicht: nimm ihn als Sklaven wieder auf und
behandle ihn wie früher; vielmehr hätte hier eine grundsätzlich
veränderte Haltung gegen die Sklaverei anknüpfen
können und sollen.
Arbeit, sowohl die des Broderwerbs als auch die, welche
im Dienste idealer Berufsart steht, ist als solche ehrwürdig.
"Mit eigenen Händen" ist die selbstbewusste Parole der
ersteren; in Bezug auf die andere beurteilt sich Paulus
nicht minder streng und findet vor seinem Gewissen nur
darin Ruhe, dass er, der frühere Verfolger der Gemeinde,
nun doch sein Leben noch mit einem Berufswerk ausgefüllt
hat, welches, wie er hofft, vor dem höchsten Gericht
bestehen kann. Auch in Bezug auf die Verteilung der
irdischen Güter hegt Paulus seine Ideale und giebt sie
bei Gelegenheit seiner Kollekte für die palästinischen Gemeinden
den Korinthern kund: Nicht wehe sollt ihr euch
thun, um den anderen aufzuhelfen; nur eine Ausgleichung
soll es sein. Was ihr an zeitlichen Gütern mehr habt, soll
für das gut sein, das jene weniger haben... Wie geschrieben
steht: "Wer viel hat, ward nicht reich und wer wenig hat,
nicht arm." Dem Philemon schickt er seinen Sklaven,
der inzwischen durch Pauli Unterweisung Christ geworden,
mit den Worten zurück: "nimm ihn wieder auf, nicht als
einen Sklaven, sondern als einen Bruder." Das heisst
doch jedenfalls nicht: nimm ihn als Sklaven wieder auf und
behandle ihn wie früher; vielmehr hätte hier eine grundsätzlich
veränderte Haltung gegen die Sklaverei anknüpfen
können und sollen.
Aber eine andere Macht treibt den Gedankengang des Apostels einer gerade entgegengesetzten Richtung zu und legt ihm die andere Mahnung nahe: "Ein jeder bleibe in dem Berufe, in welchem er berufen ward; bist du als Sklave berufen, lass dich's nicht anfechten" — was dann die Kirche nur gar zu eifrig acceptirt und festgehalten hat, als der hervorbringende Grund dieses apostolischen Indifferentismus für sie längst dahingefallen war.

Dieser Grund lag, wie Paulus es selber erklärt, in der Erwartung: das Ende dieser Weltzeit stehe unmittelbar bevor; woraus dann ohne weiteres die volle Entwertung aller Güter der Erde, der sinnlichen wie der geistigen, hervorging. Ja, es erwuchs dem Apostel aus seiner Zukunftserwartung ein System der Apathie, welches es hinsichtlich der Weltgüter in strenger Konsequenz mit der erneuerten Stoa mindestens aufnimmt. Dass, wenn zwei dasselbe thun, es nicht immer dasselbe ist, bewährt sich auch hier. Bei Paulus ein wahrhaft menschliches Rühren mit allem Geschick der ihm Nahestehenden, ein Weinen mit den Weinenden, ein Freuen mit den Fröhlichen: dort der Stelzengang einer künstlichen Gefühllosigkeit und die direkte Behauptung, jenes Mitfeiern und Mittrauern sei des Weisen unwürdig. Bei diesen Stoikern das Verbot jeder Erregung über das Böse und das Übel überhaupt, das sei da, um begriffen zu werden: bei Paulus der glutige Hass der Sünde, der Aufschrei des Schmerzes über die Übel, aus denen sie hervorgeht und die sie wiederum ihrerseits mehrt. Aber den Weltgütern gegenüber verlangt der Apostel das Übermenschliche, der Welt zu gebrauchen als gebrauchte man ihrer nicht; die da Weiber haben, seien als hätten sie keine; an eigener Freude hänge keine Lust, an eigenen Tränen kein Schmerz; denn die Gestalt dieser Welt ist am Vergehen. Höher als die Ehe sei die Ehelosigkeit. Um geraubten Besitz sei kein staatlich Gericht anzusprechen, und dies trotz Pauli bejahender Stellung auch zum heidnischen Staat. "Warum lasst ihr euch nicht lieber eure Habe. rauben?" — Es ist mir unter unsern verschiedenen "Richtungen" keine bekannt geworden, die auch hier "bibelgläubig" verbliebe. Und das ist recht so, auch vom theoretischen Standpunkt aus. . Denn das Festhalten an dieser
 ganzen apathischen Lebensanschauung wäre gleichbedeutend
mit dem Selbstverzicht der christlichen Apologetik.
ganzen apathischen Lebensanschauung wäre gleichbedeutend
mit dem Selbstverzicht der christlichen Apologetik.
IV.
So müssen wir denn noch ein letztes Mal fragen: welche der beiden Strömungen, die wir in den verschiedensten Stadien altchristlicher Geschichte wiederkehren sahen, ist die ächt christliche? Es bleibt noch eine Instanz übrig, zum Glück nach allgemein christlichem Recht die entscheidende.
Es ist zwar auch schon gesagt worden: wer die Lehre Jesu in den Streit der Meinungen hineinziehe, stelle sich eigentlich ausserhalb des Christentums, für welches das Wesen der geschichtlichen Erscheinung Jesu überhaupt ausser Diskussion stehe; auch habe sich statt dessen die "Nachfolge Christi" bei der Kirche bewussterweise "auf sein Schicksal, auf das Drama seines Lebens gerichtet und daraus ihre asketischen Ideale entnommen." Weshalb nun sollten wir heutigen Christen, um die Lebensworte des Christentums zu gewinnen, zu einem anderen hingehen, als zu welchem Petrus ging und seine Mitjünger, nämlich zu dem, der das Christentum brachte? Oder ist es überhaupt verständlich, dass wir in dem, was den Meister von aussen betroffen hat, das Wesentliche und Urbildliche seiner Erscheinung sehen sollen, und nicht in den Gedanken, die seinen Geist erfüllten, in deren Dienst er sein Leben gestaltete?
Mehr Anspruch auf Beachtung hat der andere Einwurf: dass den vorhandenen Quellen über Leben und Lehre Jesu nur ein geschichtliches Ansehen zweiter Ordnung zustehe. Aber was Jesus gewollt, wofür er gelebt und gestritten hat und gestorben ist, das wissen wir allerdings
 genau genug; und man konnte es wissen auch vor der
synoptischen Forschung dieses Jahrhunderts, die übrigens
keineswegs unfruchtbar gewesen ist. Dazu reichen unsere
Quellen aus.
genau genug; und man konnte es wissen auch vor der
synoptischen Forschung dieses Jahrhunderts, die übrigens
keineswegs unfruchtbar gewesen ist. Dazu reichen unsere
Quellen aus.
Wirklich, es sollte zunächst nicht mehr zweifelhaft sein, dass :Jesus nicht für ein Gottesreich eingetreten ist, das in Bälde und in sinnenfälliger Weise kommen sollte. Dieses Reich kommt überhaupt nicht mit "äusserlicher Geberde", wie Luther den Ausspruch Jesu überträgt, überhaupt. nicht in äusserlich wahrnehmbarer Weise: inwendig in euch, dort ist sein Sitz. — Es wäre nun geradezu wunderbar, wenn die mündliche Überlieferung der Worte Jesu, deren erster litterarischer Niederschlag, das Evangelium Matthäi, aus der heftig erregten Zeit vor der Zerstörung Jerusalems zu stammen scheint oder aus der unmittelbar folgenden, nicht einzelne dieser Worte, die dazu besonders geeignet waren, nach Stimmung und Zeitbedürfnis modifizirt hätte. So haben wir in den synoptischen Evangelien u. a. eine eschatologische Rede Jesu, deren Inhalt der Offenbarung Johannis näher steht, als dem sonstigen Inhalt dieser Evangelien; und die biblische Forschung ist redlich bemüht, Originales und später Hinzugekommenes darin zu unterscheiden. Aber die grossen geschichtlichen Charaktere wollen an den unzweifelhaften Worten erkannt sein, welche der Geist ihnen in den Stunden der grossen Entscheidung eingiebt, um ihr Werk gleichsam typisch zu bezeichnen. In der Entscheidungsstunde seines Lebens, den gewaltsamen Tod unmittelbar vor Augen, vor Hohenpriestern und hohem Rat spricht Jesus ein solches Wort, und alle drei ersten Evangelien berichten es übereinstimmend und unberührt von den Wandlungen der Überlieferung: "Von nun an werdet ihr sehen des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen
 in den Wolken des Himmels." Sie selbst sollen es sehen,
und von nun an; nicht in etlichen Jahren oder Jahrzehnten.
Von nun an; also: Jesu Wiederkunft als siegreicher Held
beginnt in seiner Todesstunde. Seine äussere Niederlage
ist selbst der Sieg seines Geistes. Sein Kreuz wird zu
allen Geschlechtern der Menschen eine unwiderstehliche
Sprache sprechen, wird das Wahrzeichen seines Triumphes
werden. Was er früher in Ungewissheit über die Zeitdauer
der ihm noch beschiedenen Lebensfrist etlichen verhiess
aus seiner Jüngerschaft: sie würden noch bei Lebzeiten
seinen Sieg mit Augen schauen, das verkündigt er jetzt
seinen Richtern allen in der Stunde seines scheinbaren
Untergangs. —Ganz in demselben Sinne sprechen einige der
markantesten Gleichnisse Jesu von dem langsamen allmälichen
Wachstum seines Reiches, das erst klein wie ein Senfkorn in die
Erde gelegt werden und darin ersterben müsse, ehe es keimen
und emporstreben könne zum weithin schattengebenden Baume.
—Noch sicherer aber als aus der kritischen Betrachtung der
überlieferten Wiederkunftssprüche Jesu geht dieselbe Thatsache
aus dem hervor, was wir sonst über sein Lebenswerk
wissen: aus dem Inhalt seines Evangeliums und aus
seinem persönlichen messianischen Anspruch, die beide unverständlich
wären, wenn wirklich Jesus seine baldige sichtbare
Wiederkunft geglaubt hätte.
in den Wolken des Himmels." Sie selbst sollen es sehen,
und von nun an; nicht in etlichen Jahren oder Jahrzehnten.
Von nun an; also: Jesu Wiederkunft als siegreicher Held
beginnt in seiner Todesstunde. Seine äussere Niederlage
ist selbst der Sieg seines Geistes. Sein Kreuz wird zu
allen Geschlechtern der Menschen eine unwiderstehliche
Sprache sprechen, wird das Wahrzeichen seines Triumphes
werden. Was er früher in Ungewissheit über die Zeitdauer
der ihm noch beschiedenen Lebensfrist etlichen verhiess
aus seiner Jüngerschaft: sie würden noch bei Lebzeiten
seinen Sieg mit Augen schauen, das verkündigt er jetzt
seinen Richtern allen in der Stunde seines scheinbaren
Untergangs. —Ganz in demselben Sinne sprechen einige der
markantesten Gleichnisse Jesu von dem langsamen allmälichen
Wachstum seines Reiches, das erst klein wie ein Senfkorn in die
Erde gelegt werden und darin ersterben müsse, ehe es keimen
und emporstreben könne zum weithin schattengebenden Baume.
—Noch sicherer aber als aus der kritischen Betrachtung der
überlieferten Wiederkunftssprüche Jesu geht dieselbe Thatsache
aus dem hervor, was wir sonst über sein Lebenswerk
wissen: aus dem Inhalt seines Evangeliums und aus
seinem persönlichen messianischen Anspruch, die beide unverständlich
wären, wenn wirklich Jesus seine baldige sichtbare
Wiederkunft geglaubt hätte.
1. Aus dem Inhalt seines Evangeliums. Erwachsen ist dasselbe auf nationalem Boden. Der es brachte, "es jammerte ihn seines Volkes", das allerdings physisch und moralisch, politisch und religiös elend genug war. Die Ursache dieses Elends ist die Sünde des Volks. Gesetz und Prophetie hat es mutwillig verdorben; denn beide wollten des Volkes Heiligung, und beide hat es veräusserlicht und damit erniedrigt und zu Grunde gerichtet. Als dasselbe Volk auch
 ihn zurückweist, richtet Jesus den Blick über die Volksgrenzen
hinaus; und der Menschheit ganzer Jammer fasst
ihn an. Eine Ursache des Elends überall: die innere Unheiligkeit,
die Sünde ist der Leute Verderben. Aber die
Zeit ist erfüllt. Ihm ist es gegeben, den Weg offenbar
zu machen, auf welchem der Fluch des Bösen in seinem
Volk, in der Menschheit zu brechen ist. Es giebt eine Rettung,
eine Erlösung für den Einzelnen: die unmittelbare
Hinwendung der Menschenseele zu Gott, dessen heilige
Lebensgemeinschaft von selbst der Untergang aller Sünde
ist — das war das Evangelium Jesu von der Gottessohnschaft,
zu der wir alle berufen sind (Matth. 5,
45). Und es giebt eine Rettung, eine Erlösung für die
Gemeinschaften und für die grosse Gemeinschaft des Menschengeschlechts:
die Vereinigung der Menschen und
Völker in der gleichen unmittelbaren Hinwendung aller zu
dem gleichen Gott und die Gestaltung aller irdischen
Verhältnisse nach dem Liebesgesetz der Bruderschaft im
gleichen grossen Vaterhause — das war das Evangelium
Jesu vom Reiche Gottes. Dieses Reich ist also nicht von
der Welt, wie das, welches das Judentum erträumte als
eine sichtbar glänzende Erneuerung untergegangener nationaler
Hoffnungen. Jene jüdische Gottesreichsidee überträgt
Jesus ins geistige und universale. Der Regent seines Reiches
ist unsichtbar. Übersinnliche Mächte gestalten und verwalten
es. Aber es soll kommen, dieses Reich, so bittet
das Herrngebet; und seine Getreuen, so sagen die ersten
Seligpreisungen, sollen die Erde erwerben, besitzen. In
diesem Reiche also, welches eine religiöse Geistesgemeinschaft
mit sittlicher Abzweckung ist, gilt keine Andacht,
die nicht in sich selbst den Trieb hätte, fruchtbar zu werden
für die Heiligung unseres Weltlebens; gilt kein frommes
ihn zurückweist, richtet Jesus den Blick über die Volksgrenzen
hinaus; und der Menschheit ganzer Jammer fasst
ihn an. Eine Ursache des Elends überall: die innere Unheiligkeit,
die Sünde ist der Leute Verderben. Aber die
Zeit ist erfüllt. Ihm ist es gegeben, den Weg offenbar
zu machen, auf welchem der Fluch des Bösen in seinem
Volk, in der Menschheit zu brechen ist. Es giebt eine Rettung,
eine Erlösung für den Einzelnen: die unmittelbare
Hinwendung der Menschenseele zu Gott, dessen heilige
Lebensgemeinschaft von selbst der Untergang aller Sünde
ist — das war das Evangelium Jesu von der Gottessohnschaft,
zu der wir alle berufen sind (Matth. 5,
45). Und es giebt eine Rettung, eine Erlösung für die
Gemeinschaften und für die grosse Gemeinschaft des Menschengeschlechts:
die Vereinigung der Menschen und
Völker in der gleichen unmittelbaren Hinwendung aller zu
dem gleichen Gott und die Gestaltung aller irdischen
Verhältnisse nach dem Liebesgesetz der Bruderschaft im
gleichen grossen Vaterhause — das war das Evangelium
Jesu vom Reiche Gottes. Dieses Reich ist also nicht von
der Welt, wie das, welches das Judentum erträumte als
eine sichtbar glänzende Erneuerung untergegangener nationaler
Hoffnungen. Jene jüdische Gottesreichsidee überträgt
Jesus ins geistige und universale. Der Regent seines Reiches
ist unsichtbar. Übersinnliche Mächte gestalten und verwalten
es. Aber es soll kommen, dieses Reich, so bittet
das Herrngebet; und seine Getreuen, so sagen die ersten
Seligpreisungen, sollen die Erde erwerben, besitzen. In
diesem Reiche also, welches eine religiöse Geistesgemeinschaft
mit sittlicher Abzweckung ist, gilt keine Andacht,
die nicht in sich selbst den Trieb hätte, fruchtbar zu werden
für die Heiligung unseres Weltlebens; gilt kein frommes
 Gefühl, das nicht unmittelbar rückwirken wollte auf die
sittliche Ausgestaltung der irdischen Wirklichkeit; gilt keine
Liebe zu Gott, die sich nicht bewährte als Liebe zu den
Brüdern. Jesus Christus, der erstgeborene unter den Gottessöhnen
dieses Reichs, die ganze Menschheit bestimmt
zu seiner Nachfolge.
Gefühl, das nicht unmittelbar rückwirken wollte auf die
sittliche Ausgestaltung der irdischen Wirklichkeit; gilt keine
Liebe zu Gott, die sich nicht bewährte als Liebe zu den
Brüdern. Jesus Christus, der erstgeborene unter den Gottessöhnen
dieses Reichs, die ganze Menschheit bestimmt
zu seiner Nachfolge.
Das ist das ganze positive Christenthum, das sind alle seine Grund- und Heilswahrheiten. Wer die letzteren, statt aus dem synoptischen Evangelium Jesu, aus den theologischen Gedankengängen Pauli zu entnehmen pflegt oder aus den Visionen der Apokalypse, aus den Doktrinen des Athanasius oder des Augustin, des Anselm oder Calvin oder gar aus der steingewordenen pseudoprotestantischen Scholastik des siebzehnten Jahrhunderts, der muss finden: das sei zu wenig, die eigentlichen Fundamentalwahrheiten des Heiles kämen erst noch hernach. Aber ein solcher hat keinen geringeren wider sich als den Stifter des Christentums, der eben in jener ureinfachen Lehre alles zusammengefasst haben will, was dem Menschengeschlecht zur Heiligung und Beseligung not thut und darin die nun offenbar gewordene Kardinalwahrheit des ganzen Gesetzes und der Propheten sieht.
Wir wissen sehr weniges von heftigen Gemütsbewegungen Jesu. Des öfteren ein starker Zorn gegen die Pharisäer; hin und wieder ein feuchtes Auge; nur einmal ein Ausbruch des Jubels. Das war, als er dessen gewiss wurde: dass sein Evangelium eine Lehre für die Kinder an Geist sei, verschlossen den Weisen, die in hohen Spekulationen einhergehen, ein sanftes Joch, eine leichte Last. Daher seine Zuversicht, dass sein Evangelium für alle Menschen sei, für alle Völker; für alle Zeiten. -
2. Daher auch die Selbstgewissheit seines persönlichen
 Anspruchs, des Anspruchs auf die Krone eines Königs des
Menschengeschlechts, auf die Würde des Messias. Es ist
behauptet und auch neuerdings in Havet's "Ursprüngen des
Christentums" wiederholt worden, Jesus habe diese Würde
niemals selbst übernommen, sie sei ihm nach seinem Tode
von der verehrenden Gemeinde übertragen worden. Gute
Gründe muss es aber doch wohl haben, wenn u. a. das neueste
dogmengeschichtliche Werk die Selbstübernahme der Messiaswürde
durch Jesum zu dem Gewissesten des Gewissen
rechnet. Ich selbst wüsste einen Zweifel daran vor meinem
exegetischen Gewissen gegenüber den drei ersten Evangelien
nicht zu verantworten. Wird aber dieser Zweifel fast allgemein
zu leicht befunden, was kann jene Besitzergreifung
in Gemässheit des echten christlichen Gottesreichsgedankens
bedeuten? Nichts als die feste Zuversicht Jesu, mit der
Ureinfachheit seines sündentilgenden Evangeliums siegreich
den Kampf wider alle gegenwärtigen. und zukünftigen Feinde
zu bestehen, bis dass sie liegen zum Schemel seiner Füsse:
Sieg über alles Priestertum und über alle Kultusgesetze,
die dem einzelnen den unmittelbaren Zugang zu Gott versperren;
Sieg über nationale Grenzen und Schranken, die
gerade in den Besonderheiten der nationalen Kulte ihre
stärksten Wurzeln haben; Sieg über alles Heidentum, alles
Judentum der Welt, Sieg auch über den Pharisäismus
aller Zeiten und Zonen, dieses langlebige Otterngezücht
von äusserlicher Glätte und verborgenem Gift; Sieg endlich
auch über die Geistesträgheit und den gröblichen Unverstand
der eigenen Jüngerschaft. — Im kleinen Raum auf
jüdischem Boden ist auch der Messiasgedanke erwachsen
als die Idee eines Königs, der von Zion aus die Herrschaft
der Welt führen werde: das war die geschichtliche Anknüpfung
des Werkes Jesu. Aber er übersetzt auch diesen
Anspruchs, des Anspruchs auf die Krone eines Königs des
Menschengeschlechts, auf die Würde des Messias. Es ist
behauptet und auch neuerdings in Havet's "Ursprüngen des
Christentums" wiederholt worden, Jesus habe diese Würde
niemals selbst übernommen, sie sei ihm nach seinem Tode
von der verehrenden Gemeinde übertragen worden. Gute
Gründe muss es aber doch wohl haben, wenn u. a. das neueste
dogmengeschichtliche Werk die Selbstübernahme der Messiaswürde
durch Jesum zu dem Gewissesten des Gewissen
rechnet. Ich selbst wüsste einen Zweifel daran vor meinem
exegetischen Gewissen gegenüber den drei ersten Evangelien
nicht zu verantworten. Wird aber dieser Zweifel fast allgemein
zu leicht befunden, was kann jene Besitzergreifung
in Gemässheit des echten christlichen Gottesreichsgedankens
bedeuten? Nichts als die feste Zuversicht Jesu, mit der
Ureinfachheit seines sündentilgenden Evangeliums siegreich
den Kampf wider alle gegenwärtigen. und zukünftigen Feinde
zu bestehen, bis dass sie liegen zum Schemel seiner Füsse:
Sieg über alles Priestertum und über alle Kultusgesetze,
die dem einzelnen den unmittelbaren Zugang zu Gott versperren;
Sieg über nationale Grenzen und Schranken, die
gerade in den Besonderheiten der nationalen Kulte ihre
stärksten Wurzeln haben; Sieg über alles Heidentum, alles
Judentum der Welt, Sieg auch über den Pharisäismus
aller Zeiten und Zonen, dieses langlebige Otterngezücht
von äusserlicher Glätte und verborgenem Gift; Sieg endlich
auch über die Geistesträgheit und den gröblichen Unverstand
der eigenen Jüngerschaft. — Im kleinen Raum auf
jüdischem Boden ist auch der Messiasgedanke erwachsen
als die Idee eines Königs, der von Zion aus die Herrschaft
der Welt führen werde: das war die geschichtliche Anknüpfung
des Werkes Jesu. Aber er übersetzt auch diesen
 Gedanken direkt in das geistige: darin lag dieses Werkes
weltgeschichtliche Bedeutung. Eine unendliche Perspektive
thut sich von da aus vor seinen Blicken auf: ein grenzenloser
Ausblick auf geistige Schlachten im kleinen und verborgenen
wie in der grossen Öffentlichkeit, auf ein wechselndes
Kriegesglück und doch auf ein langsames Vorwärtsdringen.
An seinem endlichen Siege kann Jesus nicht
zweifeln. Die Welt ist aus Gott und deshalb hat er Vertrauen
zu ihr. Ja, er liebt sie als die zur Erlösung berufene,
zur Erlösung fähige. Er ist gerüstet auf ihre Dornenkränze
und vollempfänglich für ihre Blumen.
Gedanken direkt in das geistige: darin lag dieses Werkes
weltgeschichtliche Bedeutung. Eine unendliche Perspektive
thut sich von da aus vor seinen Blicken auf: ein grenzenloser
Ausblick auf geistige Schlachten im kleinen und verborgenen
wie in der grossen Öffentlichkeit, auf ein wechselndes
Kriegesglück und doch auf ein langsames Vorwärtsdringen.
An seinem endlichen Siege kann Jesus nicht
zweifeln. Die Welt ist aus Gott und deshalb hat er Vertrauen
zu ihr. Ja, er liebt sie als die zur Erlösung berufene,
zur Erlösung fähige. Er ist gerüstet auf ihre Dornenkränze
und vollempfänglich für ihre Blumen.
Als Asket hat also Jesus nicht gelebt. Auch an seinen Jüngern sonnt er sich, wenn sie nicht fasten nach Pharisäerart, sondern fröhlich sind, so lange sie den Bräutigam unter sich haben. Jesus hat auch seinen gewaltsamen Tod nicht gesucht, vielmehr noch in der letzten Stunde an die Möglichkeit gedacht, dass dieser Kelch an ihm vorübergehe. Aber das war ein ganz vereinzeltes Schwanken. Vorausgeschaut und vorausgesagt hatte er sein gewaltsames Ende schon an demselben Tage, da er die Messiaskrone sich aufs Haupt setzte und seinen Gegensatz gegen die äusserlich verstandenen nationalen Volksheiligtümer damit zum unversöhnlichen machte. Er sah in diesem freiwilligen Tode das letzte Opfer eines Lebens, welches, in grundsätzlicher Hingabe seiner selbst, dem Loskauf vieler aus der Sklaverei der Sünde gewidmet war (Matth. 20, 28; Marc. 10, 45), das letzte Stück seiner Pflichterfüllung in der Treue gegen den ihm gewordenen Beruf. Auf diesen Beruf hat er sich ganz konzentrirt. Kurz war die ihm gewordene Frist für sein öffentliches Wirken: achtzehn Monate etwa nach den einen; zwei, höchstens drei Jahre nach den andern.. Da handelte es sich nicht um Haus und Hof; da galt es, wie
 ein Wort Jesu bei Matthäus (19, 12) sagt, ein Verschnittener
zu sein aus freiem Entschluss um der Begründung
des göttlichen Reiches willen, d. h. um vollkommen frei zu
sein für die Entscheidungskämpfe des idealen Berufs. Jesus
ist gekommen, das Schwert zu bringen; jetzt ist es gezückt.
Wer mehr will, als "zum Leben eingehen", wer in dieser
Kriegeszeit zum Stabe des Feldherrn gehören will, der muss
sich auch von seinem irdischen Gut losmachen können. Das
ist die Probe, die der reiche Jüngling nicht besteht und
wehmütig entlässt ihn der Meister.
ein Wort Jesu bei Matthäus (19, 12) sagt, ein Verschnittener
zu sein aus freiem Entschluss um der Begründung
des göttlichen Reiches willen, d. h. um vollkommen frei zu
sein für die Entscheidungskämpfe des idealen Berufs. Jesus
ist gekommen, das Schwert zu bringen; jetzt ist es gezückt.
Wer mehr will, als "zum Leben eingehen", wer in dieser
Kriegeszeit zum Stabe des Feldherrn gehören will, der muss
sich auch von seinem irdischen Gut losmachen können. Das
ist die Probe, die der reiche Jüngling nicht besteht und
wehmütig entlässt ihn der Meister.
Nur sage man nicht: Jesus habe von seinen Getreuen überhaupt das Wegwerfen alles irdischen Besitzes verlangt; zahlreiche Worte Jesu und Thatsachen aus seinem Freundeskreis, der bekanntlich keineswegs nur aus Armen bestand, sprechen dagegen. Der Reiche hat es schwer, Bürger des Gottesreichs zu werden, aber bei Gott ist auch dies nicht unmöglich, sagt Jesus ausdrücklich bei Gelegenheit der Parabel vom Nadelöhr. Überhaupt verlangt das Evangelium keinerlei Art von asketischem Weltverzicht. Es begründet die unbedingte Hegemonie der religiös-sittlichen Interessen und gegen den Ruin der Seele wiegen alle sonstigen Weltwerte nichts. Aber dass der in Gott gegründete Mensch diese Werte an sich für nichtig halten müsse oder nur achtlos verwalten dürfe, davon ist die christliche Lehre, die reine Verneinung, und auch das ganze landesübliche Gerede von der ethisch-kulturellen Unfruchtbarkeit des Lebens Jesu bestehet nicht zu Recht.
Ist denn Jesu Satz von der Nichtlöslichkeit der Ehe, es sei denn um Ehebruch, der sittlichen Stellung des Weibes nicht zu gute gekommen? Oder hat Jesus dem sittlichen Begriff der Familie nicht den denkbar grössesten Dienst gerade dadurch erwiesen, dass er derselben ihre
 Schranken wies, ihre Mitglieder von einer blöden Despotie
sogenannten Familiengeistes befreite und ihr das Bild einer
lebendigen, persönlich freien Geistesverwandtschaft überordnete,
zu welchem sie sich, wenn sie gelten wolle, emporbilden
müsse? Hat Jesus dem Staate, dem er als bestehender
Rechtsordnung einfach zu geben befahl, was ihm
gebührt, nicht auch — man sage dagegen, was man wolle
—ein soziales Ideal vorgezeichnet? Nur so im Vorübergehen
soll man zwar nichts in so schwierigen und verantwortungsvollen
Dingen behaupten wollen. Auch trennt
uns ja eine ganze Kluft von den Landes- und Zeitumständen,
unter denen Jesus die Armen selig zu preisen vermochte
und den Mammon kurzweg ungerecht nannte, unter denen
er die irdische Bitte aufs tägliche Brod beschränkte und
den Reichen dringlich gebot, sich mit dem ungerechten
Mammon wenigstens Freunde zu machen, die Vertrauensseligkeit
der Vögel unter dem Himmel empfahl und die
bedrohliche Parabel vom reichen Mann und armen Lazarus
vortrug. Aber das ist ohne weiteres verständlich: Eine
schwarze Gestalt will er aus seinem Reich gebannt wissen;
diejenige Sorge nämlich, welche dem Trachten nach dem
Reiche Gottes im Wege steht, die notwendig den Aufschwung
der Seele lähmt und sittliche Verwahrlosung zur
notwendigen Kehrseite hat. Und dann das andere: beschäftigt
hat sich Jesus — das muss in diesem Zusammenhang gesagt
werden — auf das angelegentlichste sowohl mit dem
Reichtum, den er unermüdlich warnt und ermahnt, als auch
mit der Armut, die er segnet und deren persönlichen Verkehr
er mit Vorliebe aufsucht. Wer seine diesbezüglichen
Worte versteht, der versuche dann getrost, sie unbrauchbar
zu finden; er wird darüber nicht lange im Zweifel sein,
dass von den idealen Motiven, die auf dem bezeichneten
Schranken wies, ihre Mitglieder von einer blöden Despotie
sogenannten Familiengeistes befreite und ihr das Bild einer
lebendigen, persönlich freien Geistesverwandtschaft überordnete,
zu welchem sie sich, wenn sie gelten wolle, emporbilden
müsse? Hat Jesus dem Staate, dem er als bestehender
Rechtsordnung einfach zu geben befahl, was ihm
gebührt, nicht auch — man sage dagegen, was man wolle
—ein soziales Ideal vorgezeichnet? Nur so im Vorübergehen
soll man zwar nichts in so schwierigen und verantwortungsvollen
Dingen behaupten wollen. Auch trennt
uns ja eine ganze Kluft von den Landes- und Zeitumständen,
unter denen Jesus die Armen selig zu preisen vermochte
und den Mammon kurzweg ungerecht nannte, unter denen
er die irdische Bitte aufs tägliche Brod beschränkte und
den Reichen dringlich gebot, sich mit dem ungerechten
Mammon wenigstens Freunde zu machen, die Vertrauensseligkeit
der Vögel unter dem Himmel empfahl und die
bedrohliche Parabel vom reichen Mann und armen Lazarus
vortrug. Aber das ist ohne weiteres verständlich: Eine
schwarze Gestalt will er aus seinem Reich gebannt wissen;
diejenige Sorge nämlich, welche dem Trachten nach dem
Reiche Gottes im Wege steht, die notwendig den Aufschwung
der Seele lähmt und sittliche Verwahrlosung zur
notwendigen Kehrseite hat. Und dann das andere: beschäftigt
hat sich Jesus — das muss in diesem Zusammenhang gesagt
werden — auf das angelegentlichste sowohl mit dem
Reichtum, den er unermüdlich warnt und ermahnt, als auch
mit der Armut, die er segnet und deren persönlichen Verkehr
er mit Vorliebe aufsucht. Wer seine diesbezüglichen
Worte versteht, der versuche dann getrost, sie unbrauchbar
zu finden; er wird darüber nicht lange im Zweifel sein,
dass von den idealen Motiven, die auf dem bezeichneten
 Gebiet mitarbeiten, die Gedanken Jesu noch heute die
wirksamsten sind; er taste nur an den Saum seines Gewandes,
und es geht eine Kraft von ihm. —
Gebiet mitarbeiten, die Gedanken Jesu noch heute die
wirksamsten sind; er taste nur an den Saum seines Gewandes,
und es geht eine Kraft von ihm. —
Ziehen wir endlich aus den vorgetragenen Daten einen letzten Schluss, so müssen wir sagen: das Rätsel, wie es gekommen, dass die christliche Religion bestehen blieb, als die für ihre erste Entwicklungsgeschichte so fundamental wichtige Wiederkunftshoffnung dahin sank, findet seine letzte Auflösung darin, dass diese Hoffnung im innersten Grunde keine christliche war, sondern nur eine zeitweise gebotene christliche Anwendung eines wesentlich jüdischen Zukunfts-Gedankens.
Im übrigen gedenken wir des Sprichworts von den Mühlen, welche langsam mahlen. . Die Einsamkeit überragender Geister hat der Stifter des Christentums bitter durchkosten müssen; schmerzlich beklagt er selbst des öftern, dass sein Geistesevangelium der Fassungskraft auch seiner treuesten Jünger um ein weites vorauseilt. Wie also der religiöse Grundgedanke des Christentums, derjenige der Gottessohnschaft, durch die Zweinaturenlehre und die ganze innere und äussere Not dieses Theologumenon hindurch musste, bevor er in seiner lebendigen, originalen Bedeutung voll begriffen und dadurch fähig wurde, bewusster Besitz der Christenheit zu werden; so hat auch der sittliche Wahlspruch. des Christentums: nicht von der Welt, aber in der Welt und für die Welt! seine Doppelseitigkeit zuerst in zahlreichen Systemen und Veranstaltungen der Weltflucht und .der Verweltlichung auswirken müssen. Als dieser Wahlspruch in der Reformation wieder zu reiner Geltung kam und irdische Pflichterfüllung wie aller reine
 und dankbare Genuss wieder zum heiligen Gottesdienst
wurde, da kam also eine essentiell christliche Macht zum
Durchbruch; und wir brauchen nicht gar zu viel in den
nationalen Eigenheiten der germanischen Stämme zu wühlen,
um diesen Umschwung der Lebensansicht im sechzehnten
Jahrhundert zu erklären. In einem neueren Essay über
"das katholische und das evangelische Lebensideal" wird
nachzuweisen gesucht: wie das Herrschaftsgebiet des letzteren
thatsächlich weit grösser sei als die äusseren konfessionellen
Grenzen es erscheinen lassen, und konziliatorische
Hoffnungen im grossen Stil werden an diese Thatsache angeschlossen.
Wir verzichten an dieser Stelle auf solche
Schönheitslinien weitausgreifender Zukunftsbilder und sind
zufrieden, auf den ganzen Ernst einer grundwichtigen und
ungebührlich vernachlässigten theologischen Aufgabe in aller
gebotenen Kürze hingewiesen zu haben.
und dankbare Genuss wieder zum heiligen Gottesdienst
wurde, da kam also eine essentiell christliche Macht zum
Durchbruch; und wir brauchen nicht gar zu viel in den
nationalen Eigenheiten der germanischen Stämme zu wühlen,
um diesen Umschwung der Lebensansicht im sechzehnten
Jahrhundert zu erklären. In einem neueren Essay über
"das katholische und das evangelische Lebensideal" wird
nachzuweisen gesucht: wie das Herrschaftsgebiet des letzteren
thatsächlich weit grösser sei als die äusseren konfessionellen
Grenzen es erscheinen lassen, und konziliatorische
Hoffnungen im grossen Stil werden an diese Thatsache angeschlossen.
Wir verzichten an dieser Stelle auf solche
Schönheitslinien weitausgreifender Zukunftsbilder und sind
zufrieden, auf den ganzen Ernst einer grundwichtigen und
ungebührlich vernachlässigten theologischen Aufgabe in aller
gebotenen Kürze hingewiesen zu haben.