Ueber das Verhältniss des männlichen und weiblichen Geschlechts in der Natur
Professor der Botanik in Basel.
Jena, Verlag von Gustav Fischer. 1894.
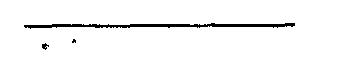
Die vorliegende Arbeit wurde als Rectoratsrede am
10. November 1893 vorgetragen; für den Druck ist sie in
einigen Punkten verändert und ergänzt worden.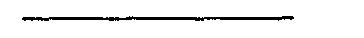
Wenn auch heute noch die Universität die allumfassende Gemeinschaft der Wissenschaften vorstellen will, so wird ihr doch nicht selten der Vorwurf gemacht, dass sie nicht mehr im Stande sei, die nach allen Seiten auseinanderstrebenden Zweige in sich aufzunehmen. Die einst wie im Schoosse einer Familie geschwisterlich zusammenlebenden, von einer Mutter behüteten Glieder scheinen sich mehr und mehr von einander loszureissen, jedes nach eigenen Zielen selbständig strebend. Der tief eingreifenden Arbeitstheilung, dem sonst so fördernden Princip jeder Gemeinschaft wird die grösste Schuld daran zugeschrieben. Mit ihr ist in der That jene Zertheilung, ja Zersplitterung der früher einheitlichen. Wissenschaften verbunden, jene Concentration des einzelnen Gelehrten auf ein winzig kleines Gebiet — Verhältnisse, die das beliebte Thema für alle jene Klagen bilden, welche, sich so reichlich über das heutige Gelehrtenthurn ergiessen. Doch nur ein einseitiger und wenig einsichtiger Geist kann ernsthaft solche Vorwürfe aussprechen. Während er sich an einzelne krankhafte Auswüchse einer nothwendigen Einrichtung anklammert, vergisst er das Wesentliche. Erst durch die Arbeitstheilung, durch das Specialstudium ist der wissenschaftlichen Forschung die Macht, verliehen worden, in früher ungeahntem Maasse weit entfernte Wissensgebiete zu überblicken, eine Masse vielfach zerstreuter Thatsachen unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt zu. bringen, Probleme von allgemeinster Bedeutung aufzustellen, deren Lösung von verschiedenen Seiten, oft von verschiedenartigen Wissenschaften gleichzeitig angestrebt wird. Wohin wir blicken, überall sehen
wir, dass Wissenschaften, die früher theilnahmlos neben einander hergelaufen sind, die selbst in dem Kopfe eines Polyesters früher sich gleichsam wie in gesonderten Fächern befunden haben, jetzt im innigsten geistigen Zusammenhange stehen. Wenn jetzt an irgend einer Stelle im weiten Gebiete der Forschung durch Specialstudium eine neue Thatsache entdeckt oder eine neue Idee geboren wird, so kann es geschehen, dass durch sie plötzlich weit entfernte Gegenden mit neuem Lichte bestrahlt werden. Dem Forschen und Ringen des Einzelnen, der auf seinem kleinen Flecke ruhig arbeitet, wird durch die enge Fühlung mit grossen mannigfaltigen Gebieten, mit gewaltigen, umfassenden Problemen jene höhere Weihe verliehen, welche der gelehrten Arbeit eigenste Schönheit ist.
Wohl nirgends treten uns im Augenblick bei ausgedehntestem Specialstudium so innige Wechselbeziehungen entgegen wie bei den biologischen Wissenschaften. Welch' unendliche Fülle des Wissens und mehr noch des zu Wissenden bietet sich in der Botanik und Zoologie dar, letztere in ihrem eigentlichen Umfange genommen, so dass die Naturgeschichte des Menschen inbegriffen ist. Noch am Anfange unseres Jahrhunderts hat ein einzelner Geleier das ganze Gebiet vertreten, welches heute unter eine grosse Anzahl besonderer Wissenschaften wie Anatomie, Morphologie, Systematik, Physiologie Pathologie, Entwickelungsgeschichte etc. vertheilt ist, deren jede sich wieder in Zweige spaltet, die die Kraft eines Menschenlebens erfordern. Und doch wohin führen alle die Stollen und Schachte, die von verschiedenen Seiten oft in scheinbar entgegengesetzten Richtungen, den mannigfachsten Krümmungen und Windungen in die dunkle Tiefe der lebendigen Natur getrieben werden, dem blöden Auge ein unentwirrbares Labyrinth ohne Ziel und Plan? Dem schärfer blickenden Geiste offenbart sich, dass alle diese ,Wege sich doch wieder treffen und begegnen, sich vereinigen und gemeinsamem Ziele zustreben, der Erforschung der Grundprobleme des Lebens, welche ebenso in dem kleinsten, nur bei tausendfacher Vergrösserung sichtbaren Kügelchen einer Bacterie, wie in dem hoch entwickelten Menschen verborgen sind. Die Biologie will bis zu einem gewissen Grade das, was z. B. die Physik in der
Electrizitätslehre zum Theil schon erreicht hat. In tausendfachen Formen und Anwendungen zeigt sich die mächtige Kraft der Electrizität, doch allem Wechsel ihrer Erscheinungen liegen gewisse einfache Gesetze zu Grunde. Wie viel reicher und herrlicher quillt das Leben in der Natur; doch auch hier gilt es, die Grundgesetze aufzudecken, das allem Leben Gemeinsame zu erkennen, wenn heute auch dieses Ziel noch in tief dämmernder Ferne ruht. In dem Streben nach diesem Ziel sind alle biologischen Wissenschaften eines Sinnes,. so wechselnd ihr Stoff, so wechselnd die Methode ihrer Forschung. ist. Sie bedürfen in diesem Streben unbedingt der thätigen Mithülfe von Physik, Chemie, sie vereinigen sich mit Anthropologie, Psychologie, Volks- und Staatslehre und anderen Zweigen der geistigen Wissenschaften. Dieses Ineinandergreifen, diese Gemeinsamkeit der Arbeit bei den biologischen Wissenschaften möchte ich versuchen an einem Beispiel zu schildern. Ich wähle dazu die Fortpflanzung, unter allen Lebenserscheinungen diejenige, welche, mit geheimnissvollstem Reize umkleidet, als die höchste der Functionen von dem Organismus nur in der strotzenden Fülle seiner Kraft ausgeübt wird.
In buntester Mannigfaltigkeit geschieht die Fortpflanzung in der Organismenwelt, ein überreiches Material von Beobachtungen liegt vor. Doch waren mehrere Jahrhunderte nothwendig, um zu erkennen, worin eigentlich das Wesen, des Processes besteht. Wohl sind sich schon die niedrigsten Völkerracen des ursächlichen Zusammenhanges bewusst, der zwischen der geschlechtlichen Vereinigung von Mann und Weib und der Geburt des neuen Wesens durch das Weib existirt. Aber selbst die Gelehrten des Alterthums sind trotz wichtiger Beobachtungen im Einzelnen nicht darüber hinausgekommen. Erst mit dem Ende des 17. Jahrhunderts begann eine neue Zeit, in der in Verbindung mit den verbesserten Vergrösserungsgläsern eine genauere Untersuchung der Geschlechtsorgane erfolgte. Von besonderer Bedeutung war die Entdeckung beweglicher, fadenförmiger Gebilde, der Samenthierchen, jetzt als Spermatozoen bezeichnet, welche von dem Studenten HAMM im August 1677 im menschlichen Sperma beobachtet wurden. Sein berühmter Lehrer LEEUWENHOEK führte die eigentliche Untersuchung und wies die gleichen Gebilde bei einigen Thieren nach. In der
Auffassung dieser Samenthierchen zeigten sich in den nächsten 150 Jahren die wunderbarsten Gegensätze. Die einen Gelehrten glaubten in ihnen die Anfänge des neuen Organismus zu sehen; die anderen leugneten Dasein, oder hielten sie für Fäulnissproducte oder Eingeweidewürmer. Erst die experimentellen Untersuchungen von PREVOST 'und DUMAS 1824 erwiesen, 'dass in dem Sperma der Thiere die Spermatozoen allein als die befruchtenden Elemente wirken. Später wurde ihre Verbreitung in allen Thierklassen mit Ausnahme der Protozoen nachgewiesen und seit KÖLLIKER'S Arbeiten ihre Entstehung aus bestimmten Zellen des Körpers erkannt.
Noch langsamer brach sich die Erkenntniss des weiblichen Elementes, des Eies, Bahn, obwohl dasselbe in den Eiern der Vögel offen vor Augen lag. Nachdem im 17. und 18. Jahrhundert die entsprechenden Gebilde bei Fischen und Fröschen beobachtet worden waren, gelang es erst KARL VON BAER 1827, das Säugethierei im Eierstock zu entdecken. Seit dieser Zeit mehrten sich auch die Angaben über das Eindringen der Spermatozoen in das thierische Ei, bis dann in neuerer Zeit durch die Forschungen von FOL, O. HERTWIG, VAN BENEDEN u. A. die Verschmelzung der beiden Sexualzellen aufs sorgfältigste verfolgt wurde.
Für die Pflanzen musste zuerst eine Sexualität überhaupt nachgewiesen werden, da diese im Alterthum ihnen ganz abgesprochen wurde. Erst am Ende des 17. Jahrhunderts lieferte der Tübinger Professor CAMERARIUS den experimentellen Nachweis, dass der Pollenstaub der Blüthen das männliche, befruchtende Element darstellt, ohne dessen 'Mitwirkung reifer Samen sich nicht ausbilden kann. Doch immer wieder tauchten Zweifel auf, obwohl die Untersuchungen KOELREUTER'S 1761-64 über Bastardbefruchtung die Sexualität der Pflanzen unwiderleglich bewiesen. Selbst noch SCHLEIDEN, einer der Begründer der neueren Botanik, brachte Verwirrung in die Frage, weil er die Entstehung des Pflanzenembryos aus dem männlichen Pollen zu sehen glaubte, bis AMICI und HOFMEISTER in den 40er Jahren die Befruchtung der weiblichen Eizelle in der Samenknospe durch den Schlauch des Pollens sicherstellten. Von da ab begann auch der grosse Aufschwung in Erforschung der
Kryptogamen, der Nachweis der Eizelle und der den thierischen Spermatozoen entsprechenden, beweglichen männlichen Zellen bei Farnkräutern, Moosen, Algen. PRINGSHEIM war es, der 1856 zum ersten Male bei der Süsswasseralge Oedogonium direct die Verschmelzung der Eizelle mit einem Spermatozoon beobachtete. Auch bei den anderen Pflanzenklassen wurde die Vereinigung der beiden Sexualelemente gesehen und in neuester Zeit durch STRASBURGER. GUIGNARD u. A. die Befruchtung der Phanerogamen genau verfolgt.
Durch die gemeinsamen Forschungen von Botanikern und Zoologen ist die überraschende Analogie im feineren Bau wie im Verhalten der männlichen und weiblichen Elemente bei Pflanzen und Thieren nachgewiesen worden. Als richtigsten Ausdruck der augenblicklichen Kenntnisse können wir den Satz aufstellen, dass in der ganzen. Organismenwelt das Wesen der geschlechtlichen Fortpflanzung darin besteht, dass zwei bestimmt geformte Zellen, die Geschlechtszellen, gebildet werden, die zu einer Zelle verschmelzen, dem Anfang des neuen Organismus.
Das weite, umfassende Gebiet der Sexualität wird beherrscht durch die Frage nach dem Verhältniss des Männlichen und Weiblichen. Ein tieferes Verständniss des Problems erfordert ein näheres Eingehen auf die Beziehungen der beiden Geschlechter.
Gewöhnlich nimmt man als Ausgangspunkt den Gegensatz, der sich bei den höheren Thieren in . den beiden Geschlechtsindividuen, Männchen und Weibchen, am schärfsten ausprägt.. Für die weitere Darstellung muss man aber im Auge behalten, dass dieser Gegensatz durchaus nicht eine allgemein verbreitete Erscheinung ist. Schon bei niedrigen Pflanzen, den Algen, bemerken wir den bunten Wechsel in der Vertheilung der männlichen und weiblichen Organe. Innerhalb einer Gattung (Vaucheria, Oedogonium) giebt es Arten mit beiden Geschlechtern bei demselben Individuum, sog. Zwitter, und Arten, bei denen die Geschlechter auf zwei Individuen vertheilt sind und die als getrennt geschlechtlich oder diöcisch bezeichnet werden. Aehnliche Schwankungen kommen bei Moosen, Farnkräutern vor; bei den Blüthenpflanzen ist die Mehrzahl zwittrig, eine kleinere .Anzahl, wie Maulbeerbäume, Nesseln,. Hanf etc. diöcisch. Eine
Art Mittelstellung nehmen die monöcischen Pflanzen ein, wie die Tannen, Eichen, bei denen die Geschlechter auf demselben Individuum, aber in gesonderten Blüthen sich finden.
Auch bei den Thieren wechselt die Geschlechtsvertheilung. Unter den niederen Thieren sind meist getrennten Geschlechtes die Korallen, Seeigel, Seesterns, Muscheln, die Mehrzahl der Gliedertiere. Zwittrig sind dagegen die Schwämme, Rippenquallen, Blutegel, Saug- und Plattwürmer, zahlreiche Schnecken, und als relativ höchste Gruppe die Tunicaten oder Mantelthiere. Diese sind von ganz besonderer Bedeutung, weil sie in ihrer Entwickelungsgeschichte eine auffallende Aehnlichkeit mit den niederen Wirbelthieren zeigen, so dass sie als den Urwirbelthieren nahestehende Organismen angesehen werden. Auch die Wirbelthiere sind ihrer Anlage nach Zwitter. Unter den Fischen giebt es noch unzweifelhafte Zwitter, bei den Fröschen sind alle jungen Larven mit den deutlichen Anlagen beider Geschlechtsorgane versehen, und selbst beim Menschen sind in der allerersten Zeit des embryonalen Lebens noch beide Anlagen vorhanden. In pathologischen Fällen tritt beim Menschen eine deutliche Zwitterbildung auf, wenn sie sich in den sicher bekannten Fällen auch nur auf die äusseren Geschlechtsorgane und Charactere bezieht.
Zwitterthum und getrenntes Geschlecht sind die beiden je nach Thier- und Pflanzenarten wechselnden Formen der Geschlechtsvertheilung. Der Gegensatz der männlichen und weiblichen Geschlechtszellen ist in allen solchen Fällen deutlich ausgesprochen.
Nur bei den niedrigsten Pflanzen und Thieren existirt auch dieser Gegensatz noch nicht; die beiden Geschlechtszellen erscheinen in allen sichtbaren Merkmalen übereinstimmend, so dass Männlich und Weiblich nicht zu unterscheiden ist. Doch schon sehr frühe tritt die Sonderung ein und zwar in der Weise, wie sie für fast alle Thiere und Pflanzen maassgebend ist: Von den beiden Zellen, welche anfangs in gleichem Grade beweglich sind, bewahrt die eine ihre Beweglichkeit und vergrössert sie noch; die andere wird passiv, unbeweglich und wird von der activen aufgesucht. Wir nennen die eine männlich, die andere weiblich. Nur in seltenen Fällen fehlt dieser Hauptcharacter der männlichen Zelle, ihre Beweglichkeit, so z. B. bei den rothen
Meeresalgen, bei denen die Bewegung der Wellen die Vereinigung der Geschlechter vermittelt. Dagegen bilden die Phanerogamen nur eine scheinbare Ausnahme, da die Pollenkörner zwar nicht frei beweglich sind, aber vermöge, ihrer Fähigkeit, zu wachsen, fortwandern und selbständig zu der Eizelle gelangen können.
Ein anderer durchgreifender Unterschied der männlichen und weiblichen Zelle macht sich in der Grösse bemerkbar. Die männliche reducirt ihre Körpersubstanz auf das Nothwendigste, die weibliche füllt sich mit Nahrungsstoffen aller Art an. Der Grössenunterschied kann, wie bei den Vögeln, ganz gewaltig sein; aber auch die relativ kleinen Eier des Menschen und der grösseren Säugethiere (0,2 mm) übertreffen an Grösse die Spermatozoen (beim Menschen 0,051 mm).
Der Gegensatz der Geschlechter zeigt sich ebenso in den die Zellen erzeugenden Organen; er prägt sich schliesslich bei den getrennt geschlechtlichen Organismen in der ganzen Individualität aus. Bei den diöcischen Pflanzen sind die Unterschiede des männlichen und weiblichen Individuums sehr gering. Doch sind im Allgemeinen bei Algen, Moosen, Farnkräutern, deutlicher noch bei den diöcischen Phanerogamen, die männlichen Individuen kleiner, schmächtiger, als die weiblichen. Auch bei zahlreichen diöcischen Thieren, den Echinodermen, Mollusken, Krebsen, Spinnen und selbst noch bei Fischen, sind Männchen und Weibchen kaum merklich verschieden. Deutlicheren Unterschieden begegnen wir bei manchen Würmern, Krebsen und zahlreichen Insekten. Häufig ist dabei das Männchen kleiner als das Weibchen, höchst auffallend bei einigen Würmern und Krebsen, bei denen das Männchen als winziger Parasit auf dem riesigen Weibchen sitzt. Bei vielen Insekten zeichnen sich die Männchen durch grössere Beweglichkeit aus, sie sind geflügelt, während das Weibchen flügellos ist. Kein einziges Beispiel kennt man, bei dem das Verhältniss umgekehrt ist.
Schon bei Insekten kommen Unterschiede der Geschlechtsindividuen zur Erscheinung, die weit hinausgehen über den Unterschied der Geschlechtszellen. Bei den Tagfaltern unter den Schmetterlingen schimmern die Männchen in bunten, glühenden Farben, während die Weibchen dunkler, matter gefärbt
sind. Noch mehr steigert sich dieser Unterschied bei den Vögeln, so dass bei den farbenherrlichsten Organismen unserer Erde, den Paradiesvögeln, den Kolibris, Fasanen und Pfauen, das Weibchen sich in dunkle Unscheinbarkeit hüllt. Unter den Säugethieren zeichnen sich wohl auch einige Männchen durch äussere Vorzüge aus, wie der Hirsch und der Löwe. Viel allgemeiner ist aber bei den Männchen grössere Kraft und Stärke entwickelt als bei den Weibchen, denen die wichtige Rolle zufällt, den jungen Keim längere Zeit im Leibe zu ernähren. Das gleiche Verhältniss sehen wir beim Menschen, bei dem die körperlichen Unterschiede von Mann und Weib wenig bedeutend sind, wenn wir von den eigentlichen Geschlechtscharacteren absehen; giebt es doch Völker, wie die Eskimos, deren Geschlechter zum Verwechseln ähnlich sind. Besonders der durchschnittlich kleinere weniger geräumige Schädel, das breitere Becken, der engere Brustkasten, die reichliche Fettablagerung, durch die alle Körperformen weicher, gerundeter erscheinen, sind solche Merkmale des Weibes. Viel mehr fällt der psychische Gegensatz der Geschlechter auf — ein unerschöpfliches Thema für Dichter und Denker, sowie für jeden Beobachter des menschlichen Daseins. Wenn wir die zahllosen psychischen Zwitterbildungen unter uns bei Seite lassen und uns nur an die typischen Erscheinungen halten, so sehen wir den willens- und verstandeskräftigen, von lebhaftem Thatendrange durchglühten Mann, der in den weiten Gebieten des menschlichen Lebens schöpferisch wirken will, und das schwächere, weiche, hingebende Weib, das, mit feinster und tiefster Empfindungsfähigkeit begabt, im. engeren Kreise mit seinem Zauber waltet. Der Grundzug des Gegensatzes, die Activität des Männlichen, die Passivität des Weiblichen, wie er auf der niedersten Stufe sexuellen Lebens sich findet, kehrt unendlich bereichert im Menschen wieder.
Mögen nun die Geschlechtszellen und auch die Geschlechtsindividuen bald mehr, bald weniger verschieden sein, in Einem sind sie alle gleich, in dem Streben und Sehnen, sich zu vereinigen. Auch hierbei sehen wir wieder die wunderbarste Mannigfaltigkeit in den Einrichtungen, welche zu diesem Ziele führen. Bei allen Cryptogamen, von den Algen bis zu den
Farnkräutern, findet die Vereinigung der Geschlechtszellen im Wasser statt, sei es in den Gewässern, sei es im Thau oder Regen. Die im Wasser frei schwimmenden Spermatozoen bewegen sich nach der Eizelle hin, die in ihrem Organ bleibt, zu der aber in der Zeit der Geschlechtsreife ein Zugang sich öffnet. Der fadenförmige, schraubig gedrehte Körper, der im Stande ist, sich zu strecken und zusammenzuziehen, erleichtert es wesentlich den Spermatozoen, in den engen Zuführungskanal des weiblichen Apparates einzudringen. Die grosse Sicherheit, mit der sie den Weg zu der oft versteckten Eizelle finden, setzt eine Anziehung voraus, welche die Eizelle auf die Spermatozoen ihrer Art ausübt. PFEFFER gelang es in der That, eine wichtige physiologische Beziehung der beiden Zellen nachzuweisen. Bei den Farnkräutern scheidet die geschlechtsreife Eizelle Aepfelsäure aus, welche sich langsam im Wasser verbreitet. Die Spermatozoen, von besonderer Empfänglichkeit für diese Substanz begabt, richten sofort ihre Bewegung nach dem Ort des Ausströmens und werden dadurch nothwendig zur Eizelle hingeführt. Bei anderen 'Pflanzen, z. B. den Laubmoosen, bildet Rohrzucker die anziehende Substanz; in vielen Fällen ist ihr chemischer Charakter noch nicht bekannt.
Höchst anfällig zeichnen sich gegenüber den Cryptogamen die Blüthenpflanzen aus, welche keine beweglichen Spermatozoen, sondern unbewegliche Pollenkörner besitzen. Es handelt sich hier um den durchgreifendsten Charakter der Phanerogamen, der sich bei ihren Vorfahren in früheren Erdepochen ausgebildet hat, als sie die Abhängigkeit ihrer Befruchtung vom Wasser aufgaben. Nothwendig mussten andere Mittel ergriffen werden, um den Pollen auf die empfängnissfähige Narbe zu bringen. Wir nennen diesen Act die Bestäubung und unterscheiden ihn von dem Act der eigentlichen Befruchtung. Bei den einfacheren Blüthenpflanzen, wie den Nadelhölzern, dem Haselstrauch, den Buchen, Eichen und Gräsern, werden die Pollenkörner durch die Bewegungen der Luft auf die Narbe gebracht, die ihrerseits durch klebrige Stoffe die männlichen Zellen festhält. Der staubartige, leichte, trockene Pollen wird in grossen Mengen; gebildet, so dass auch bei diöcischen Pflanzen die Bestäubung sicher erfolgt. Für die Mehrzahl der
Blüthenpflanzen spielen indessen die Thiere die Hauptrolle, in unseren Zonen die Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Erst seit man ihre Bedeutung als Pollenüberträger von Blüthe zu Blüthe kennt, hat man ein Verständniss dafür gewonnen, warum in der Blüthenwelt eine solche Schönheit in Formen und Farben sich entfaltet. Die Pracht der Farben in den Blumenblättern, die Düfte, der süsse Honig des Nectars sind Mittel, die Insekten anzulocken; die oft so wunderbaren Formen der Blüthen geben die Wege an, auf denen die Bestäubung zu erfolgen hat. Ist dann der Pollen auf die Narbe gelangt, so tritt seine Activität ins Spiel. Er wächst in Form eines Schlauches in den Griffel, wandert in manchen Fällen 10, selbst 20 cm, bis er in die Fruchthöhle kommt, wo wieder besondere Leitwege ausgebildet sind, auf denen er zur Samenknospe, endlich zu der darin versteckten Eizelle dringt. Wahrscheinlich hilft ihm dabei eine Anziehung des Eies, worüber allerdings nichts Näheres bis jetzt bekannt ist.
Den Cryptogamen ähnlich verhält sich die Mehrzahl der im Wasser lebenden Thiere, namentlich aus den unteren Klassen. Bei den Hydromedusen, Seeigeln und Seesternen, ebenso bei den Fischen und Fröschen werden beide Geschlechtszellen dem Wasser übergeben, wo die Befruchtung sich vollzieht; oder die Eier bleiben im Mutterleibe, wie bei Schwämmen, Muscheln, während die ins Wasser ausgestossenen Spermatozoen ihren Weg zu den Eizellen finden müssen. Schon bei den Fischen, noch auffallender bei den Fröschen, wirkt eine Anziehung der Geschlechtsindividuen mit, die Vereinigung der Zellen zu erleichtern. Die männlichen Fische suchen die Nähe der Weibchen auf, kämpfen sogar heftig um sie. Der männliche Frosch umklammert krampfhaft das Weibchen, und diese Umarmung kann bis zu 20 Tagen dauern, während welcher die Eier ausgestossen und von dem reichlich austretenden Sperma befruchtet werden. Bei der Mehrzahl der Landthiere und auch einigen Wasserthieren, wie den Krebsen, ist die Anziehung der Geschlechtsindividuen noch mehr gesteigert; es findet eine zeitweilige innige Vereinigung von ihnen statt, durch die die Spermatozoen direct in das innere weibliche Organ befördert werden, wo die eigentliche Befruchtung erfolgt.
Wie bei den höheren Pflanzen zwischen Bestäubung und Befruchtung, so ist bei solchen Thieren zwischen •Begattung und Befruchtung zu unterscheiden. Für die Vereinigung von Ei und Spermatozoon müssen wir für alle Thiere bisher ganz räthselhafte Anziehungskräfte annehmen. Einrichtungen besonderer Art müssen in solchen Fällen ausgebildet sein, wo die Eier vor der Befruchtung mit festen Häuten umkleidet sind, wie bei den Holothurien, Krebsen und Insekten. In diesem Fall finden sich besondere Eingangspforten,. die Micropylen. Bei der gemeinen Küchenschabe gelang es DEWITZ. die Art des Eindringens zu beobachten. Die Spermatozoen haben die Eigenheit, von festen Flächen, z. B. auch von der Haut des Eies, angezogen zu werden, so dass sie dicht auf derselben kreisende Bewegungen ausführen, wobei sie auf eine der vielen Micropylen stossen, die trichterförmige, sich nach innen verengernde Kanäle vorstellen und als Fangapparate für die Spermatozoen dienen.
Aeusserlich viel bekannter, ihrer inneren Natur nach ebenso räthselhaft ist die Anziehung der Geschlechtsindividuen, die zur Begattung führt. Die Hauptrolle spielt dabei der Geschlechtstrieb in einfachster Form, der Drang, die reifen Geschlechtsproducte zu entleeren. Er ist bereits vorhanden bei Thieren mit äusserer Befruchtung, ist aber viel mächtiger ausgebildet bei den sich begattenden Thieren und hier verknüpft mit der gegenseitigen Anziehung der Geschlechter. Auch hier sehen wir wieder denselben Gegensatz angedeutet wie bei den Geschlechtszellen. Der männliche Theil, von viel lebhafterem Geschlechtstriebe bewegt, sucht das Weibchen auf, das zuwartet und höchstens das Recht der Auswahl hat. Bei fast allen Thieren tritt der Geschlechtstrieb zu bestimmten Zeiten auf; das Frühjahr ist die bevorzugte Jahreszeit für die Brunst. Nur bei Hausthieren, z. B. dem Esel, dem Bock, besonders in südlichen Gegenden, finden wir dieselbe Erscheinung wie beim Menschen, dass der Geschlechtstrieb an keine Jahreszeit gebunden ist. Doch sollen nach WESTERMARCK bei nordamerikanischen Völkerstämmen regelmässige Brunstzeiten (Mitte des Frühjahrs) auftreten, und wahrscheinlich sehen wir selbst bei den civilisirten Völkern noch eine Andeutung davon in der
statistisch festgestellten Thatsache, dass das Maximum der Conceptionen in die Frühjahrsmonate Mai und Juni fällt.
Der mächtige Geschlechtstrieb bewegt, männliche und weibliche Individuen zu einander, und bei dem Sich-Suchen und -Finden spielen und wirken alle Sinnesempfindungen mit. Für viele Thiere ist der Geruchssinn ein wichtiger Vermittler der geschlechtlichen Annäherung. Die Männchen der Psyche-Arten, kleinen Schmetterlingen, kommen aus weiten Fernen und umschwärmen das in eine Schachtel verschlossene Weibchen Die Hunde wittern an dem Trimethylamin-Geruch des Harnes die Weibchen; zahlreiche Säuger zeichnen sich durch Afterdrüsen aus, die zur Brunstzeit intensiv riechen. In anderen Fällen locken und finden sich die Geschlechter durch die Gewalt der Töne, vom schrillen Zirpen der Heuschrecken ab bis zu dem auch das Menschenherz ergreifenden Gesange der Nachtigall. Selbst. bei den sonst stummen Fischen sollen die Männchen einiger Arten in der Brunstzeit lockende Töne von sich geben. Am wichtigsten ist der Gesichtssinn, durch den die zahlreichen äusseren Merkmalen der Geschlechter als Erkennungszeichen erst ihre wahre Bedeutung erhalten. Doch müssen wir uns hüten, das Verhältniss zu äusserlich anzusehen. Schon bei den höheren Thieren spielen bei der Annäherung der Geschlechter eine Fülle psychologischer Beziehungen mit, die wir allerdings nur insofern, deuten können, als wir ihnen die uns bekannten Motive .unterschieben. Gewiss führt auch ein rein ästhetisches Wohlgefallen ,die Geschlechter zu einander. Die mannigfaltigen Töne, das bunte Spiel der Farben im Gefieder der Vögel, die Entfaltung von Kraft und Muth im Kampfe der männlichen Säugethiere erregen die Zuneigung der Weibchen, die ihrerseits eine Auswahl zu treffen im Stande sind.
Von den wildesten Völkerracen bis zu den gebildetsten Europäern bemerken wir das gleiche Streben des Mannes, vor dem Weibe zu glänzen, nur dass bei den modernen Culturvölkern das Weib viel mehr aus seiner Passivität heraustritt und seinerseits in viel höherem Grade durch den bestrickenden Reiz seiner Schönheit lockt und verführt. Ein wesentlicher Unterschied gegenüber den Thieren prägt sich in dem Streben
des Menschen aus, die ihm von der Natur verliehenen Formen zu verschönern, sei es durch äusseren Schmuck, sei es durch künstlich hervorgerufene Veränderungen einzelner Organe. Wohl existirt schon bei niedrigen Racen eine rein absichtslose Freude am Schönen. Unzweifelhaft hat aber der künstlerische Trieb sich mächtig entwickelt und gesteigert durch das Bedürfniss der Geschlechter, sich anzuziehen. Nichts ist belebender, als bei den verschiedenartigen Völkern zu vergleichen, was für schön gilt und was bei dem anderen Geschlechte anziehend wirkt. Die Fettpolster auf dem Gesäss der Hottentottenweiber, die durch Mästung herbeigeführte Fettleibigkeit des ganzen Körpers bei den Weibern der südnubischen Völker, die Tätowirung der Indianer, die geschwärzten Zähne der Malayen, die verkrüppelten Füsse der Chinesinnen, die verschiedenartigen Lippen-, Nasen- und Ohrenringe, die Bärte und die Schnürbrust sind einzelne Beispiele aus der Fülle mannigfaltiger Mittel, die zur Befriedigung des Schönheitstriebes dienen. Erst dem feingebildeten Menschen bleibt es vorbehalten, in der schmucklosen unveränderten und unverhüllten Form, wie sie sich in den Gestalten einer Praxitelischen oder Titianischen Venus darstellt, die herrlichste Verkörperung menschlicher Schönheit zu erblicken. Doch mit dem Reize der formalen Schönheit verknüpft sich bei den Culturvölkern, bei denen nach und nach dem Weibe eine höhere Stellung verliehen worden ist, das Wohlgefallen an dem inneren geistigen Leben der Seele. Die geschlechtliche Zuneigung wird zu der Liebe, in welcher sich mit dem leis verhüllten und doch rastlos waltenden Geschlechtstriebe die reinste Freude an der seelischen Uebereinstimmung der Geschlechter untrennbar zu einem mächtigen, herrlichen Gefühl verbindet.
Diese Liebe, im Zaubergewande der Poesie von den Dichtern aller Zeiten besungen, tritt im wirklichen Leben uns nur relativ selten rein entgegen. Vielmehr mischt sich ihr ein anderer Trieb bei, den der Mensch aus dem Thierreich übernommen hat, der Trieb beider Geschlechter, zusammenzuleben, um gemeinsam für die Nachkommenschaft zu sorgen und damit eine Ehe einzugehen. Bei fast allen Thieren von den Schwämmen bis zu den Reptilien sorgt allein das Weibchen
für die Nachkommen, indem es die Eier an nahrungsreichen, für die Jungen günstigen Stätten legt, oder indem es die Jungen in der ersten Zeit in seinem Leibe ernährt. Das Männchen verhält sich nach der Befriedigung des Geschlechtstriebes ganz gleichgültig und theilnahmlos. Nur in seltenen Fällen hilft das Männchen mit, so z. B. bei einzelnen Fischarten, dem Stichling, ferner dem Seepferdchen, bei dem das Männchen die Eier in einer besonderen Tasche ausbrütet. Die ersten Anfänge der Ehe bemerken wir bei einzelnen Reptilien; eine viel höhere Ausbildung erreicht sie bei den Vögeln, die auch bereits die beiden Hauptformen der Ehe, die Monogamie und die Polygamie, zeigen, welche noch weiter entwickelt das sociale Leben aller Menschenracen beherrschen. WESTERMARCK hat neuerdings mit Erfolg den Nachweis versucht, dass die Monogamie die ursprüngliche Form menschlicher Ehe gewesen sei, dass sie sich von der monogamen Ehe der anthropoiden Affen, wie des Gorilla, des Chimpanse, herleite. Thatsächlich ist aber die Polygamie, und zwar in Form der Vielweiberschaft, auf der Erde sehr verbreitet. Damit hängt es zusammen, dass die Gattenliebe gar nicht so häufig auf der Erde, vielen Völkern ganz unbekannt ist, während die Liebe von Mutter und Kind bei allen Völkern zu allen Zeiten als mächtiger Naturtrieb waltet. Selbst bei den Culturvölkern, bei denen die Ehe durch Recht, Sitte und Religion geregelt und geheiligt ist, spielt die Zuneigung der sich vermählenden Individuen so oft gar keine Rolle. Um so edler und menschenwürdiger erscheint die Ehe der fürs Leben durch Liebe verbundenen Gatten.
Die monogame Form der Ehe hat zur Voraussetzung, dass die beiden Geschlechter ziemlich in gleicher Anzahl vorhanden sind. Das trifft im Allgemeinen auch zu, gilt ebenso für viele Pflanzen und Thiere ohne Ehe, während andererseits extreme Fälle von grossem Ueberschuss des einen oder des anderen Geschlechtes nicht fehlen. Das Zahlenverhältniss, in dem die beiden Geschlechter stehen, hängt in erster Linie von der Menge ab, in der sie erzeugt werden; es kann nach der Geburt durch verschiedenartige Einflüsse verändert werden. Schon das Alterthum, ebenso das Mittelalter interessirte sich in hohem Grade für die Frage, von welchen Umständen das Geschlecht
der Kinder abhängig sei. Man suchte nach einer Methode, es willkürlich zu bestimmen. Die alten Römer wie die Juden des Talmud, die Araber des Mittelalters, zahlreiche Gelehrte bis auf die neueste Zeit haben verschiedenartige, meist sehr sonderbare Vorschriften gegeben, um die Geburt eines Knaben — denn das war immer die Hauptsache — herbeizuführen. Die heutige Wissenschaft steht auf einem sehr skeptischen Standpunkt dabei. Sie beruft sich nicht blosS auf die negativen Resultate aller solcher Vorschläge, sie stützt ihren Zweifel auf die wichtige Thatsache, dass das Verhältniss von Knaben- und Mädchengeburten, ein ganz bestimmtes ist. Wenn durch grosse Zahlen die kleineren individuellen Abweichungen zum Verschwinden gebracht werden, so ergiebt sich, dass auf 100 Mädchen circa 106 Knaben geboren werden. Eine solche Gesetzmässigkeit des Verhältnisses, nur in anderen Zahlen, zeigt sich auch bei Pferden, Schafen, Fröschen; sie ,tritt ebenso auf bei diöcischen Pflanzen. So wies HEYER nach, dass z. B. beim Bingelkraut auf 100 Weibchen 106 Männchen kommen, also merkwürdiger Weise genau wie beim Menschen.
Die scheinbar einfachste Auffassung würde in der Annahme bestehen, dass ein inneres Gesetz jeden Organismus nöthigt, die Geschlechter in bestimmtem Zahlenverhältnisse zu erzeugen. Dafür könnte sprechen, dass die oft gemachten Angaben über den directen Einfluss der Aussenwelt auf die Geschlechtsentstehung vor einer strengen Kritik nicht Stand halten können. Die sorgfältigen Versuche von HEYER ergaben, dass bei diöcischen Pflanzen unter wechselnden äusseren Bedingungen das Verhältniss constant bleibt, dass alle früheren gegentheiligen Angaben unrichtig sind. Dazu kommt, dass die Experimente mit Thieren, die statistischen Untersuchungen für den Menschen einen Wirrwarr widerspruchsvoller Thatsachen und Theorieen ausmachen. Auf der anderen Seite ist die Annahme eines solchen inneren Gesetzes im Grunde nichts weiter als eine durchsichtige Verschleierung unseres Nichtwissens. Man möchte dann schon lieber zu der Hypothese DÜSING's greifen, welcher eine durch Zuchtwahl erworbene nützliche Eigenschaft jedes Organismus annimmt, das für seine Fortpflanzung günstige Verhältniss der Geschlechter zu erzeugen. Die Regulirung,
wobei das Verhältniss um einen bestimmten, stets wiederkehrenden Zahlenwerth schwankt, denkt DÜSING sich dadurch herbeigeführt, dass jeder Mangel an Individuen des einen Geschlechts eine Mehrgeburt des anderen bewirkt. Die bekannten Thatsachen lassen sich nun keineswegs dadurch erklären; vor allem leidet diese Hypothese, wie die Mehrzahl aller anderen, daran, dass sie. das Problem zu wenig allgemein anfasst. Die Grundfrage lautet: welche physiologischen Unterschiede existiren zwischen den Geschlechtern? Dabei ist es zunächst weniger wichtig, ob diese sich in einem Individuum oder auf zwei Individuen vertheilt finden. Für die Untersuchung dieser Frage werden durchaus nicht alle Organismen gleich passend sein. Nur solche werden uns Aufschluss geben können, bei denen das Geschlecht in bestimmter Abhängigkeit von bekannten Bedingungen der Aussenwelt steht. Wir müssen in der That nach Organismen suchen, bei denen die Bestimmung des Geschlechtes willkürlich, dabei vollkommen exact gelingt. Ist es bei einzelnen Organismen gelungen, so folgt nicht daraus, dass der Versuch bei anderen Arten in der gleichen Weise vor sich gehen werde. Wohl aber haben wir damit die erste Grundlage gewonnen, von der aus die Erkenntniss der physiologischen Geschlechtsunterschiede sich erheben kann, auch für solche Organismen, deren Geschlechtsbildung unabhängig von der Aussenwelt sich vollzieht. Augenblicklich kann man nur einige Angriffspunkte bezeichnen, von denen aus die Physiologie der Geschlechtsbildung sich Bahn brechen muss.
Bei einer niedrigen Fadenalge Vaucheria finden sich scheinbar gesetzmässig ein männliches und ein weibliches Organ (nicht selten auch 2 weibliche) dicht neben einander. Mit Hülfe verdünnter Luft oder höherer Temperatur gelang es mir, diese Gesetzmässigkeit zu überwinden, das weibliche Organ zu unterdrücken, an seine Stelle 2 oder noch mehr männliche Organe hervorzurufen. Aus dem Zwitterfaden entstand ein rein männlicher Faden. Man wird sagen, dass - es sich hierbei um eine krankhafte Erscheinung handle. Das ist zunächst gleichgültig; das Wesentliche bleibt, dass gegenüber bestimmten äusseren Bedingungen männliches und weibliches Organ sich verschieden, Bei den Farnkräutern entwickelt sich aus den Sporen
der fruchtbaren Blätter die kleine laubartige Geschlechtsgeneration, das Prothallium, auf dem Organe von beiden Geschlechtern sich bilden. Theils durch Entziehung gewisser salziger Nahrungsstoffe (nach PRANTL), theils durch Cultur in schwachem Lichte (nach eigenen Beobachtungen) kann mit grösster Sicherheit das weibliche Organ unterdrückt werden, so dass rein männliche Prothallien erzeugt werden. Unter besonderen, noch nicht klar erkannten Umständen können aber auch rein weibliche Prothallien gewonnen werden. Es ist gewiss kein Zufall, sondern stimmt mit anderen bekannten Thatsachen überein, dass für die Erzeugung des weiblichen Organes eine grössere Gunst äusserer Umstände herrschen muss, während das männliche Organ auch unter viel ungünstigeren Verhältnissen entstehen kann. Für die höheren Pflanzen sind trotz vielfältiger Versuche noch keine sicheren Resultate erlangt worden; aber dass solche überhaupt nicht gewonnen werden sollten, wie HEYER glaubt, ist höchst unwahrscheinlich. Wir sehen, dass bei manchen Zwittern eine Verkümmerung des einen oder anderen Geschlechtes eintritt. Alle diöcischen Pflanzen, wie Weiden, Hanf, Nesseln, zeigen ab und zu Zwitterblüthen. Solche Fälle werden gewöhnlich als pathologische Merkwürdigkeiten bei Seite gelegt, als ob die Pathologie noch immer ein Raritätencabinet vorstelle, während sie doch ein Zweig der allgemeinen Physiologie ist. Bestimmte physiologische Ursachen müssen solche Anomalieen veranlasst haben; warum sollten nicht Einflüsse der Aussenwelt die Ursachen sein und als solche erkannt werden?
Für die niederen Thiere existiren keine Untersuchungen über die Ursachen des Geschlechtes, obwohl sie gerade geeignete Objecte dafür sein werden. In neuerer Zeit hat NUSBAUM beobachtet, dass die zwittrigen Süsswasserpolypen unter nicht näher bekannten Umständen rein weiblich geworden waren. Einige Krebse und besonders die Insekten haben für die Frage stets grosse Bedeutung gehabt. Bei den Daphniden z. B. unter den Krebsen glaubte man zu beobachten, dass die Männchen durch ungünstige äussere Umstände, wie Nahrungsmangel, Kälte, Trockenheit, hervorgerufen werden. Doch die vielen Versuche WEISMANN's haben in dieser Richtung
keinen Erfolg gehabt, und er schreibt die Entstehung des Geschlechtes ausschliesslich inneren Ursachen zu. Keine andere Klasse bietet so mannigfache Formen der Geschlechtsvertheilung wie die der Insekten, und für diese ist seit LANDOIS mehrfach ein directer Einfluss der Aussenwelt auf die Geschlechtsbildung angenommen worden. Allein wirklich entscheidende Versuche wurden nicht gemacht, und es waltet die Meinung vor, dass das Geschlecht bei den Insekten bereits im Ei bestimmt sei. Immerhin weisen eine Reihe merkwürdiger Erscheinungen darauf hin, dass äussere Umstände bei der Geschlechtsentstehung mitwirken. Bei manchen Schmetterlingen vermögen die unbefruchteten Eier, wie SIEBOLD nachwies, sich zu entwickeln, und zwar zu Weibchen. Die Männchen sind bei Arten wie Psyche helix äusserst selten; bei Solenobia sind sie ab und zu in grösserer Menge vorhanden, sie treten aber in beiden Fällen erst nach mehreren Weibchen-Generationen auf. Wenn nun aus solchen unbefruchteten Eiern meist Weibchen, zeitweise aber auch Männchen entstehen, so ist es höchst wahrscheinlich, dass hierfür die Aussenwelt entscheidend sei, dass Versuche in dieser Richtung Erfolg hätten. Das gilt auch für die Bienen, für welche DZIERZON und SIEBOLD nachgewiesen haben, dass die befruchteten Eier sich zu Königinnen. oder bei schlechter Ernährung zu Arbeitern, die unbefruchteten Eier sich zu Männchen, den Drohnen, entwickeln. Hier entscheidet also der Mangel oder das Hinzutreten eines Spermatozoon über das Geschlecht. Für die physiologische Untersuchung würden besonders die Bienenzwitter werthvoll sein, welche sich in manchen Stöcken in grosser Menge ausbilden. Durch Versuche müsste zu entscheiden sein, worin, die Ursachen für diese Zwitterbildung liegen, ob in der verspäteten Befruchtung, wie LEUCKART meint, oder in besonderen Ernährungsverhältnissen u. s. w.
Unter den Wirbelthieren sind Experimente über die Geschlechtsentstehung bei Fröschen angestellt worden; doch den Resultaten BORN's widersprechen diejenigen PFLÜGER's. Für die. Hausthiere behauptete THURY, dass das Alter des Eies von Bedeutung für das Geschlecht sei, so dass am Anfange der Brunst belegte Kühe mit relativ jungen Eiern Kuhkälber,
später belegte mit älteren Eiern Stierkälber erzeugen.. Die verschiedenartigen Versuche über diese Hypothese ergaben widersprechende Resultate. Noch viel schwieriger und unsicherer ist die Lösung der Frage für den Menschen, da der einzige Weg der Untersuchung durch die Statistik gegeben wird, welche an und für sich bei dem verwickelten Problem mit äusserster Vorsicht zu gebrauchen ist und im besten Falle gewisse Thatsachen festzustellen, aber nicht zu erklären vermag. Es ist nicht möglich, auf die zahlreichen Hypothesen einzugehen, die sich alle darin gleichen, dass sie auf Schwankendem Grunde stehen. Doch ist die wichtige Thatsache hervorzuheben, dass das Verhältniss von 100 Mädchen und 106 Knaben nicht auf einem inneren Gesetz des Organismus beruhen kann, dass vielmehr bestimmte physiologische Erscheinungen das Verhältniss regelmässig verändern können. Das beweist die von AHLFELD zuerst erwähnte und vielfach bestätigte Thatsache, dass ältere Erstgebärende überwiegend Knabengeburten hervorbringen, und ferner die andere von PLOSS, DÜSING u. A. herangezogene Thatsache, dass bei Zwillingsgeburten die Gleichgeschlechtlichkeit überwiegt, nicht nur dort, wo die Zwillinge aus einem Ei, sondern auch wo sie aus zwei Eiern entstanden sind. In dem einen Fall sind es die besonderen physiologischen Zustände des Geschlechtsorgans einer älteren Erstgebärenden, im anderen Fall die gleichartigen Umstände, unter denen Zwillinge entstehen, welche dahin wirken, das sonst so constante Verhältniss der beiden Geschlechter umzuändern. Das regelmässige Ueberwiegen des männlichen Geschlechtes muss zunächst darin begründet sein, dass die für seine Entstehung charakteristischen physiologischen Ursachen durchschnittlich etwas häufiger eintreten als die für das weibliche Geschlecht, und hierfür könnte eine Art Disposition maassgebend sein, die bei der Entstehung der Eier oder der Spermatozoen oder gleichzeitig: beider wirkt und welche bis zu einem gewissen Grad, aber nicht unabänderlich fest vererbt wird. ' Als ein Racenmerkmal wird man es auffassen müssen, wenn die Juden in Deutschland, unter denselben Verhältnissen lebend wie die Deutschen, doch auf 100 Mädchen 111 Knaben hervorbringen — eine Thatsache, die
man vergeblich durch äussere Umstände, wie die strenge Befolgung mosaischer Vorschriften etc., hat erklären wollen.
Mit der Unkenntniss von den Ursachen der Geschlechtsentstehung hängt auch die unsichere Beantwortung der Frage zusammen, in welchem Zeitpunkte das Geschlecht bestimmt wird. Die drei möglichen Fälle, dass die Bestimmung vor der Beleuchtung oder im Augenblicke der Befruchtung oder nach dieser erfolgt, finden wir in Form von Hypothesen ebenso oft behauptet wie bestritten. Wahrscheinlich kommen alle drei Fälle bei den Organismen vor. Bei dem merkwürdigen Wurm Dinophilus apatris bildet das Weibchen nach KORSCHELT vor der Befruchtung bereits zweierlei Eier: grössere, die zu Weibchen, kleinere, die zu Männchen werden. Bei den Farnkräutern wird lange nach der Befruchtung erst das Geschlecht entschieden. Für die höheren Thiere und den Menschen waltet im Augenblicke die Ansicht vor, dass im Moment der Vereinigung von Ei und Spermatozoon das Geschlecht bestimmt wird. Dann fragt es sich, welchem der beiden Erzeuger die wichtigere Rolle dabei zufalle. 1n der Art der Antwort auf diese Frage spiegeln sich die im Laufe der Zeiten wechselnden Anschauungen über den Werth von Mann und Weib wieder. Heutzutage werden wir sagen, dass beide Erzeuger gleich viel zur Entscheidung beitragen können; wir dürfen mit DÜSING annehmen, dass jedes Geschlecht dahin strebt, das ihm entgegengesetzte hervorzubringen. Im Augenblicke der Befruchtung entscheidet sich der Sieg für das stärkere, ohne dass wir verstehen, worauf diese Stärke und damit der Sieg beruhe. In dem Kampfe der beiden Erzeuger werden jedenfalls die physiologischen Bedingungen, unter denen vorher die Geschlechtszellen gestanden haben, sehr bedeutsam sein. Daher liegt ein richtiger Gedanke der. von JANKE empfohlenen Methode der Knabenerzeugung zu Grunde, wonach zur Erreichung des Zweckes der Mann durch unzureichende Ernährung in seiner Geschlechtssphäre geschwächt, das Weib durch stärkere Ernährung gekräftigt werden soll. Wenn auch die Versuche des amerikanischen Züchters FIQUET, auf die JANKE sich beruft, von diesem selbst nicht als beweiskräftig bezeichnet werden, wenn auch diese Methode praktisch von keinem Erfolge sein wird,
so weist sie doch nach meiner Ansicht auf einen richtigen Weg hin für das interessante Experiment an Thieren und Pflanzen, durch bestimmte äussere Einwirkungen auf die Erzeuger einen Einfluss auf das Geschlecht des Erzeugten zu erhalten.
In den bisherigen Erörterungen wurde stets vorausgesetzt, dass die sich vereinigenden Geschlechtszellen oder Individuen ein und derselben Species angehören, also infolge Uebereinstimmung in allen wesentlichen Charakteren mit einander verwandt sind. Der Begriff der Verwandtschaft, bei der eine geschlechtliche Zeugung möglich ist, muss indessen nach der einen Seite erweitert, nach der anderen eingeschränkt werden. Auch Geschlechtszellen, die verschiedenen Arten angehören, vermögen sich zu vereinigen; das Product. einer solchen Befruchtung nennen wir Bastard. Bei den Pflanzen finden sich solche Bastarde gar nicht selten in der freien Natur, eine noch grössere Rolle spielen sie in der Gärtnerei, wo durch Bastardirung verschiedenartiger Nelken, Pelargonien, Orchideen etc. neue schönblühende Mischformen erzeugt werden. Bastarde werden im Allgemeinen nur von solchen Arten erhalten, welche sich systematisch nahe stehen, derselben Gattung angehören, seltener von Arten verschiedener Gattungen, nie von solchen, die verschiedenen Familien angehören. Je grösser die systematische Verwandtschaft, um so fruchtbarer ist, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, die Verbindung und später auch ihr Product, der Bastard selbst. Bei den Thieren sind die Bastarde viel weniger zahlreich, weil der Mangel. der geschlechtlichen Anziehung die Vermischung erschwert. Doch kennt man Bastarde zwischen Hund und Wolf, Löwe und Tiger, Pferd und Esel u. s. w. Die Mehrzahl solcher thierischen Bastarde zeichnet, sich durch Unfruchtbarkeit aus. Bei dem Menschen, bei dem nur Varietäten einer Species, die Racen, in Betracht kommen, ist Bastardirung zwischen allen, auch den verschiedenartigsten Völkern beobachtet worden, wenn auch der Grad der Fruchtbarkeit einer solchen Verbindung wechselt. So gelten die Ehen zwischen Europäern und Australnegern für wenig fruchtbar, während solche zwischen Europäern und Hottentottenweibern fruchtbarer sein sollen als zwischen Hottentotten unter sich. ' '
Noch auffallender als diese Befruchtungsfähigkeit verschiedenartiger
Organismen ist die Thatsache, dass innerhalb ein und derselben Art eine zu nahe Verwandtschaft der geschlechtlichen Vereinigung sich entgegenstellt. Infolge eines allgemeinen Instinctes pflegen sich die Glieder einer Familie bei den Culturvölkern nicht zu vermischen. Die Abneigung, ja der Abscheu gegen die Blutschande oder Inzucht ist, wie WESTERMARCK sehr ausführlich nachgewiesen hat, bei allen Völkern der Erde verbreitet, wenn auch die Ansichten über den erlaubten Verwandtschaftsgrad weit auseinander gehen. Mit seltenen Ausnahmen sind die Ehen zwischen Eltern und Kindern verboten, und nur wenige Racen, wie die tiefstehenden Veddas auf Ceylon, gestatten regelmässig Geschwisterehen, welche ferner heute noch in den Herrscherfamilien von Siam, Birma sich finden, wie einst bei den Inkas von Peru, den Ptolemäern von Aegypten. Manche Völker sind sogar strenger als die Europäer, so z. B. die Ostafrikaner, bei denen bis zum 7. Grade verwandte Personen nicht heirathen dürfen. Wie tief die Abneigung gegen Verwandtenheirath bei niederen Racen wurzeln kann, zeigt sich nach den Angaben WESTERMARCK's in den religiösen Anschauungen der kalifornischen Nischnamis. Diese glauben, dass bei Erschauung der Welt gleich zwei Menschenpaare entstanden seien, so dass die Vermehrung durch Blutschande vermieden wurde — ein Gedanke, der der jüdischen Mythe von Adam und Eva ferngelegen hat.
Die Anthropologen haben durch verschiedene Hypothesen diese Abneigung gegen Inzucht zu erklären versucht; doch handelt es sich hierbei, wie. zuerst DARWIN hervorgehoben hat, um eine ganz allgemeine Erscheinung in der Natur. Nur bei tiefstehenden Algen (Chlorochytrium, Hydrodictyon) sind die Geschlechtszellen wirklich Schwesterzellen die, kaum durch Theilung aus derselben Mutterzelle entstanden, sich gleich vereinigen. Bei anderen Algen ist für die Befruchtung nothwendig, dass die Geschlechtszellen verschiedenen Zellgenerationen, anderen Organen desselben Individuums oder besonderer Individuen entstammen, selbst wenn der Gegensatz von Männlich und Weiblich in diesen Zellen noch gar nicht ausgedrückt ist. So ist also die Abneigung gegen die Vermischung zu nahe verwandter Zellen früher ausgebildet, als der Unterschied
von Männlich und Weiblich. Da das Vorhandensein beider Organe auf einem Individuum unzweifelhaft grosse Vortheile für die Sicherung der Befruchtung darbietet, sehen wir die Zwitterbildung so weit verbreitet. Von hohem Interesse ist es nun, dass Einrichtungen sich ausgebildet haben, die eine Selbstbefruchtung des Zwitters, d. h. den stärksten Grad der Inzucht zu vermeiden streben oder wenigstens zeitweise Kreuzbefruchtung verschiedener Blüthen gestatten. Es giebt allerdings eine Anzahl Pflanzen mit nie sich öffnenden, stets sich selbst befruchtenden Blüthen; dieselben Pflanzen aber besitzen ausserdem andere, sich öffnende und der Kreuzung zugängliche Blüthen, wie z. B. die Veilchen. Auch bei Pflanzen, wie Oryza clandestina, Salvia cleistogama, die wesentlich durch Selbstbefruchtung sich fortpflanzen, hat man ab und zu offene Blüthen beobachtet. Von solchen Pflanzen finden sich alle möglichen Uebergänge bis zu dem anderen Extrem, das einige Orchideen, Oncidium-Arten darbieten, bei denen der Pollen der eigenen Blüthe vollkommen impotent ist, ja sogar giftig auf das weibliche Empfängnissorgan, die Narbe derselben Blüthe, einwirkt. Schon am Ende des vorigen Jahrhunderts entdeckte der Conrector L. SPRENGEL die mannigfaltigen Einrichtungen, durch welche die Selbstbefruchtung der Blüthenpflanzen beschränkt, die Kreuzung verschiedener Individuen befördert werden. Eines der wirksamsten Mittel dafür besteht in der ungleichzeitigen Reife der Geschlechtsorgane derselben Blüthe, so dass diese zuerst rein männlich, später rein weiblich oder umgekehrt sich verhält. Bei den thierischen Zwittern findet meistens eine Kreuzbefruchtung zweier Individuen statt, so bei den Blutegeln, der Weinbergschnecke. Andere Zwitter, wie die Tunicaten, zeigen wie die höheren Pflanzen eine verschiedene Reifezeit der Geschlechtsorgane, und auch bei den gewöhnlich sich selbst befruchtenden Bandwürmern liegt die Möglichkeit offen, dass ab und zu eine Kreuzung erfolgt.
Bei allen Organismen mit getrennten Geschlechtern vereinigen sich stets zwei Individuen. Es bilden sich nun Instincte aus, die einer Vermischung naher Blutsverwandten entgegenwirken. Nur selten sind wir bisher mit den Lebensverhältnissen der Thiere so vertraut, um sagen zu können, in welchem Grade
Inzucht vermieden wird. Doch gehört hierher die bekannte Thatsache, dass eine Bienenkönigin sich nicht in ihrem Stock befruchten lässt, sondern ins Freie eilt, wo sie von fremden Drohnen befruchtet werden kann. Noch auffallender zeigt es sich nach SEITZ bei Wespen, zahlreichen Schmetterlingen, bei denen aus derselben Brut zuerst sich Männchen, später Weibchen ausbilden, so dass eine Befruchtung der Geschwister vermieden wird. Beim Menschen haben wir eine ganz allgemeine Abneigung gegen Inzucht kennen gelernt. Von den verschiedenen Erklärungsversuchen ist anscheinend derjenige WESTERMARCK'S sehr einleuchtend, der in dem engen Zusammenleben innerhalb einer Familie den nächsten Grund dafür ansieht. Für diese Annahme würde in der That sprechen, dass Geschwister, die unter fremden Verhältnissen und ohne Ahnung ihrer Blutsverwandtschaft aufgewachsen sind, nicht immer eine solche Abneigung zeigen. Der tragische Conflict zwischen der hell auflodernden Leidenschaft solcher Geschwister und dem Sittengesetz ist oft von Dichtern behandelt worden. Warum aber erzeugt das enge Zusammenleben selbst bei tiefstehenden Völkern eine solche Abneigung gegen die Inzucht? Wir wissen es nicht, wir kennen nicht die Ursachen für die Abneigung nahe verwandter Geschlechtszellen bei den einfachsten Algen, noch viel weniger die innersten Gründe für das Verhalten des Menschen. Aussichtslos sind daher alle Bemühungen, für diesen allein eine Erklärung zu finden; sie muss die gesammte Organismenwelt umfassen. Heute erscheint als der einzige Rettungsanker in der Erklärungsnoth die DARWIN'sche Theorie, nach der durch natürliche Zuchtwahl diese Abneigung zur Entwickelung gebracht worden ist, weil die Inzucht für die Vermehrung der Organismen schädlich ist. Allerdings ist in Wirklichkeit der Schaden fortgesetzter Inzucht gar nicht sehr auffallend, im besten Falle zeigt er sich erst nach vielen Generationen und auch dann nur, wenn andere Verhältnisse, geringer Wechsel der äusseren Bedingungen, Vererbung von Krankheiten, ungünstige Ernährung u. s. w. mitwirken. Grösser als der unmittelbare Nachtheil der Inzucht wird aber der Vortheil der Kreuzbefruchtung sein. Die Experimente DARWIN'S ergeben, dass für dieselbe Pflanzenart eine Kreuzbefruchtung
gegenüber Selbstbefruchtung sehr förderlich wirkt, sowohl was die Menge der erzeugten Samen, als was die Kräftigkeit der Keimlinge betrifft. Die Erfahrungen der Thierzüchter sprechen ebenfalls für einen fördernden Einfluss der Kreuzungen von Individuen, die nicht verwandt oder, was mindestens ebenso wichtig ist, nicht unter denselben Bedingungen aufgewachsen sind, so dass sie eine verschiedenartige Constitution besitzen. Um diese Kreuzung- verschiedener Individuen zu erreichen, treibt bei dem Menschen unbewusst der launische Liebesgott so oft entgegengesetzte Naturen zusammen, die Grossen und Kleinen, die Blonden und Braunen, die Lebhaften und die Ruhigen, wie schon SCHOPENHAUER in seiner Metaphysik der Geschlechtsliebe es so trefflich geschildert hat. Wir werden mit DARWIN, SPENCER u. A. den Hauptvortheil der geschlechtlichen Befruchtung gegenüber der ungeschlechtlichen darin sehen, dass zwei Geschlechter sich vermischen, die durch verschiedene Herkunft und durch individuelle Unterschiede in ihrer ganzen Organisation ausgezeichnet sind.
Die Frage nach der Bedeutung, dem Wesen der Sexualität wird gerade in neuester Zeit mit lebhaftestem Interesse besprochen im Zusammenhange mit der ebenso wichtigen Frage nach dem Wesen der Vererbung. Besonders haben die Forschungen von Botanik und Zoologie über die feineren Vorgänge bei der geschlechtlichen Vereinigung neuen Anstoss gegeben. Wir können ausgehen von der aus Theorie und Praxis sich ergebenden Anschauung, dass Vater und. Mutter durchschnittlich gleich viel zur Bildung des Kindes beitragen. Nur ein Theil der dem Kinde übergebenen Eigenschaften, seien es mehr die mütterlichen oder die väterlichen, kann sich im Kinde entfalten; ein anderer Theil bleibt in ihm unentwickelt und tritt oft erst in den nächsten Generationen zu Tage. Die Summe der erblichen Anlagen ist in den Geschlechtszellen concentrirt, und man denkt sie sich an eine bestimmte Substanz, die Vererbungssubstanz, das Idioplasma NAEGELI'S, gebunden. Wenn Vater und Mutter gleich viel beitragen, so wird auch die Vererbungssubstanz der männlichen und weiblichen Zelle der Quantität nach gleich sein. Seit OSCAR HERTWIG wird vielfach angenommen, dass der Träger dieser wichtigsten Substanz
ein Organ der Zelle, der Zellkern sei. Bei jeder Vereinigung zweier Geschlechtszellen verschmilzt in der That unter sehr eigenartigen Erscheinungen der Kern der männlichen mit dem Kern der weiblichen Zelle, und man stützt sich besonders darauf, dass die Spermatozoen der Hauptmasse nach aus dem Zellkern bestehen. Andere Forscher legen dem neu entdeckten Centralkörperchen die grössere Bedeutung bei. Doch scheint auch heute noch die Ansicht am richtigsten, nach der Zellplasma, Kern und Centralkörperchen eine Einheit bilden, in deren jedem Gliede Vererbungssubstanz sich finden muss.
Werden nun die Vererbungssubstanzen beider Eltern in gleicher Menge bei jeder Befruchtung dem Kinde übergeben, so fragt es sich, worin denn die Bedeutung des Unterschiedes von Männlich und Weiblich liege. Zwei principiell entgegengesetzte Anschauungen stehen sich in der Antwort auf diese Frage gegenüber. Nach der einen Ansicht, die bis heute vorgeherrscht hat, sind männliche und weibliche Vererbungssubstanzen ihrer inneren Natur nach verschieden, gleichsam einander entgegengesetzt, wie Säure und Basis. Man kann den Unterschied auch durch den Satz ausdrücken, dass dem weiblichen Element zur Weiterentwickelung Etwas fehlt, was das männliche besitzt und ihm bei der Vereinigung übergiebt — ein alter Gedanke des ARISTOTELES, nach welchem das Weib den Stoff für den neuen Keim, der Mann den Anstoss zur Bewegung des Stoffes und damit die eigentliche Seele liefert.
Die andere Anschauung, die von NUSSBAUM, STRASBURGER, WEISMANN vertheidigt wird, hält die. beiden Vererbungssubstanzen auch ihrer Qualität nach für gleich, so dass ein anderer Gegensatz nicht existirt als ein rein individueller. Der thatsächlich zu beobachtende, so allgemeine Gegensatz der Geschlechtszellen betrifft nur Aeusserliches, ist eine secundäre Erscheinung; er hängt zusammen mit einer Arbeitstheilung, bei der das Männliche die Rolle des aufsuchenden, die Vereinigung herbeiführenden Elementes spielt, das Weibliche für die erste Ernährung des neuen Keimes sorgt. Immer mehr schliessen sich die Gelehrten dieser neuen Anschauung an, deren Richtigkeit zu beweisen wirklich bei niederen Pflanzen möglich ist. So gelang es mir bei einigen Algen (Cosmarium, Closterium)
die Vereinigung der beiden Geschlechtszellen, d. h. hier. der zusammengezogenen, einander sich nähernden Zellinhalte zu verhindern und jeden für sich zur Fortentwickelung zu bringen. Jeder der beiden bildete für sich eine vollkommen gleich beschaffene Zelle, die dem sonstigen Product ihrer Vereinigung, der sog. Zygospore entsprach, nur dass sie um die Hälfte kleiner war. Der Versuch beweist die vollkommene Gleichheit beider Geschlechtszellen resp. ihrer Vererbungssubstanzen. Da nun die geschlechtliche Befruchtung im ganzen Reiche der Organismen in übereinstimmender Weise erfolgt, so wird man auch zu der Annahme genöthigt, dass sie überall ihrem Wesen und ihrer Bedeutung nach gleich sei.
Von diesem neu gewonnenen Standpunkt aus können wir sagen, dass die geschlechtliche Fortpflanzung in der Vermischung zweier, der Art und Bedeutung nach gleicher, nur individuell verschiedener Vererbungssubstanzen besteht, wodurch eine neue, eigenartige Individualität ins Leben gerufen wird. Der Gegensatz der Geschlechter, die allgemeinen Einrichtungen die Inzucht zu beschränken und Kreuzung verschiedenartiger Zellen herbeizuführen, wirken dahin, dass die individuellen Unterschiede der sich vermischenden Substanzen möglichst ausgebildet werden. Dadurch wird die geschlechtliche Befruchtung zu einem der mächtigsten und wirkungsvollsten Mittel, die Fortentwickelung der Organismen zu befördern. Wohl kann bereits bei ausschliesslich ungeschlechtlicher Vermehrung eine grosse Mannigfaltigkeit der Artbildung herrschen, wie die Bacterien zeigen; aber sie wird vermehrt, gesteigert, da durch die Vermischung zweier Individualitäten neue Modificationen und Variationen des Arttypus hervorgerufen werden, unter denen die natürliche Zuchtwahl mittelst des Kampfes ums Dasein eine Auslese treffen kann. Doch die Fülle mannigfaltiger, zu neuen Varietäten und Arten strebender Individualitäten wird noch erhöht. Denn die Geschlechtszellen eines Organismus sind nicht isolirte, unabhängige Gebilde. Sie nehmen fortwährend Antheil an den wechselnden Einflüssen, welche die Aussenwelt auf den Organismus ausübt, und halten einen Theil dieser Einflüsse fest, sie auf das Product ihrer Vereinigung übertragend. Denn man muss nach meiner Meinung an der von DARWIN, SPENCER, HAECKEL
u. A. vertretenen Idee festhalten, dass ein Theil der Aenderungen, welche der Organismus während des Lebens erleidet, auch den Nachkommen übergeben wird. Diese Vererbung erworbener Eigenschaften, diese Annahme, die durch WEISMANN und seine Anhänger so lebhaft bestritten wird, kann 'uns allein physiologisch verstehen helfen, wie jeder Organismus so wunderbar genau den Verhältnissen, unter denen er lebt, angepasst ist.
So führt die Lehre von der geschlechtlichen Befruchtung, die die mannigfaltigsten Wissensgebiete berührt, zu jener gewaltigen Frage nach den Ursachen der Bildung und Entwickelung der Organismen, zu jener Frage, die seit DARWIN's bahnbrechenden Werken nicht mehr aus unserem Gedankenkreis wird entschwinden können und welche mehr und mehr alle Wissenschaften in ihren Zauberbann hineingezogen hat. Diese Frage ist aber nur ein Theil des allgemeinen Problems über die Entstehung und Fortbildung der Erde, über das Warum und Wozu der ganzen Weltentwickelung. Deshalb erscheinen auch im Grunde alle Bemühungen, die Entwickelung der Organismen für sich allein zu erklären, als aussichtslos. Denn derselbe Trieb zur Entwickelung beherrscht die anorganische Natur, offenbart sich in überraschendster Weise in der Geschichte der Erde, ja wirkt sehr wahrscheinlich auch in der Welt, der chemischen, anscheinend so unveränderlichen Elemente, die als Entwickelungsformen eines Urelementes zu erkennen seit langer Zeit ein. Traum der Chemie ist. Doch bei diesen letzten und höchsten Fragen stehen wir am Rande einer unergründlichen Tiefe, die uns von dem nur als Fata. morgana erscheinenden Lande der Erkenntniss trennt: Den Einen treibt's in heissem Verlangen zu immer neuen Versuchen, kühn mit Hülfe philosophischer oder religiöser Vorstellungen die Tiefe zu überfliegen; der Andere, wehmuthsvoller Entsagung, ergeben, denkt nur daran, mühsam Schritt vor Schritt in die unendliche Tiefe hinabzudringen.






