Ueber Leben und Tod.
Rektoratsrede von
in Bern.Hochansehnliche Versammlung!
Der Physiologe, d. h. der Vertreter der Lebenswissenschaft an unserer Hochschule hat die Ehre, das 61. Jahr unserer alma mater einzuweihen. Wollen Sie ihm freundlich folgen, wenn er Sie für kurze Zeit an die Grenzen seines Gebietes führt.
Uebrigens ist der etwas hochnotpeinlich klingende Titel meines Vortrags keineswegs originell, sondern rührt von Bichat, der vor fast 100 Jahren ein Buch verfasst hat, unter dem Titel «Recherches physiologiques sur la vie et la mort». Bichat ist im 32. Lebensjahre als Arzt, Anatom und Pathologe am Hôtel-Dieu gestorben. Dort liess ihm Napoleon, der erste Konsul, ein Denkmal errichten. Gleiche Ehre erwies ihm seine Vaterstadt Thoirette im Jura. Der berühmte Verfasser der Anatomie générale definierte das Leben folgendermassen: La vie est l'ensemble des fonctions qui resistent à la mort. Er unterschied zwei Arten von Leben: das animale und das organische. Das erste hat seinen Sitz im Gehirn, das zweite in den Eingeweiden. Es giebt, sagt er, glücklich beanlagte Menschen, denen die zwei Leben im Gleichgewichte bleiben. Diese werden von ihren Regungen belebt, erwärmt; ihre intellektuellen Fähigkeiten
 werden angeregt, ohne die Herrschaft zu verlieren. Stets
werden ihre Leidenschaften gezügelt durch Ueberlegung.
werden angeregt, ohne die Herrschaft zu verlieren. Stets
werden ihre Leidenschaften gezügelt durch Ueberlegung.
Durch Spekulationen über die Vorgänge des Lebens gelangt er zum Begriffe der Lebenskraft, welche er den physischen Kräften gegenüberstellt. So bleibt er in einem Mysticismus befangen, der nicht weit absteht von den Vorstellungen der Philosophen und Aerzte des klassischen Altertums.
Plato unterschied drei Seelenteile, deren höchster, das Erkennen und Wollen vermittelnd, im Gehirne thronen sollte, deren weiter, als Gemüt, vornehmlich im Herzen wirke, deren dritter, niederster, als Begehrungsvermögen vornehmlich in der Leber sitze.
Galen codifizierte die alten Lehrsysteme und wandte die Elementenlehre des Empedokles, in Ausführung hippokratischer Ideen, auf die Lebenslehre an:
Der Weltäther vergeistigt die irdischen Elemente: das warme Feuer, die kalte Luft, das feuchte Wasser, die trockene Erde. Diesen entsprechen im Körper Blut, Schleim () gelbe und schwarze Galle . Bei den einzelnen Menschen herrscht ein Element vor und bedingt die vier Temperamente: das sanguinische oder feuchtwarme, das phlegmatische oder feucht-kalte, das cholerische oder trocken-warme, das melancholische oder trocken-kalte.
Diese Bezeichnungen sind noch jetzt, 1700 Jahre nach Galen, dem Laien geläufig — weniger bekannt ist wohl seine Einteilung der Seele: des (Hauch) und Doch fällt der lebendige Odem, den man mit dem letzten Atemzuge aushaucht, ganz in unseren Innere.
Ausserdem gilt allgemein das Blut als Lebenssaft. Mit Gut und Blut opfert man sein Alles, reines Blut charakterisiert die edlen Geschlechter und Blutsverwandtschaft gilt als engstes Band. Mit seinem Blute verschreibt sich Faust der Hölle, Lammblut vermittelt uns den Himmel.
Aber nur die Bewegung ist das Zeichen des Lebens und das Blut wird durch den Körper der höheren Tiere vom Herzen getrieben. Aristoteles sah als den zuerst lebenden
 Teil im bebrüteten Hühnerei das Herz an und nannte
das winzige Gebilde das punctum saliens
oder den springenden Punkt der Uebersetzer. Dieser Ausdruck
ist noch heute sprichwörtlich, zur Bezeichnung des
Wesentlichsten. Aber im allgemeinen verlangen wir mehr,
als dass unser Herz schlägt. Das Bewusstsein und die willkürliche
Bewegungsfähigkeit gelten uns als Merkmale des
Lebens.
Teil im bebrüteten Hühnerei das Herz an und nannte
das winzige Gebilde das punctum saliens
oder den springenden Punkt der Uebersetzer. Dieser Ausdruck
ist noch heute sprichwörtlich, zur Bezeichnung des
Wesentlichsten. Aber im allgemeinen verlangen wir mehr,
als dass unser Herz schlägt. Das Bewusstsein und die willkürliche
Bewegungsfähigkeit gelten uns als Merkmale des
Lebens.
Köpfen heisst die Todesstrafe vollziehen. Anencephalen werden als nicht lebensfähig angesehen. Aber die analysierende experimentelle Physiologie beruhigte sich nicht bei diesen oberflächlichen Erfahrungen. Legallois, der ingeniöse Gefängnisarzt von Bicêtre, hat vor 80 Jahren gezeigt, dass auch Tiere ohne Kopf viele Stunden am Leben erhalten werden können, wenn man verhütet, dass sie beim Abtrennen des Gehirns sich verbluten, und dass durch künstliche Atmung die fehlende natürliche ersetzt wird. Aber er sah auch die Tiere weiter atmen, wenn er den Kopf nur ein klein wenig höher abtrennte, als üblich war, so dass das sogenannte verlängerte Mark mit dem Rückenmark in Zusammenhang blieb. Flourens begrenzte dann den Ort genauer, der unentbehrlich ist, um das Tier atmen zu lassen und fand im Nackenmark der Kaninchen eine erbsengrosse Stelle, deren Verletzung den sofortigen Tod des Tieres zur Folge hatte. In seinem berühmten Buche über die Funktionen des Nervensystems (1842, zweite Auflage) sagt er: c 'est toujours d'un point, et d'un point unique, et d'un point qui a quelques lignes à peine que la respiration, l'exercice de l'action nerveuse l'unité de cette action, la vie entière de l'animal, en un mot, dépendent. Er nannte diesen Ort in der Folge «Noeud vital», den Lebensknoten. Sollte man nun dahin den Sitz der Seele verlegen? Es ist wahr, dass wer das Genick bricht, wie vom Blitz getroffen, niederfällt, aber man weiss auch, dass es genügt das Grosshirn blutleer zu machen, um das Bewusstsein sogleich zu vernichten. Die Apoplexie: der Gehirnschlag lähmt, weil das aus den geborstenen Adern geströmte Blut die Zufuhr frischen Blutes verhindert. Ganz ähnliches erfolgt, wenn durch andere Vorgänge das Blut vom Gehirn abgehalten wird. Es genügt schon, dass das Herz
 sehr schwach schlage, oder die Gehirngefässe sich zusammenziehen,
um eine Ohnmacht herbeizuführen. Leichte Anämie
verursacht: Schläfrigkeit (Somnolenz), stärkere: Schlafsucht
(Sopor), stärkste; vollständige Bewusstlosigkeit (Coma);
sehr schwach schlage, oder die Gehirngefässe sich zusammenziehen,
um eine Ohnmacht herbeizuführen. Leichte Anämie
verursacht: Schläfrigkeit (Somnolenz), stärkere: Schlafsucht
(Sopor), stärkste; vollständige Bewusstlosigkeit (Coma);
Aber einen Menschen ohne bewusstes Dasein nennt man keineswegs tot. Subjektiv unmerkliches Leben kann objektiv höchste Daseinsäusserungen geben. Patienten, welche zum Behufe einer Operation mit Chloroform oder Aether betäubt worden sind, können während der Narkose sich bewegen, sprechen, singen, selbst toben, aber nach dem Erwachen erinnern sie sich weder der äusseren Vorgänge, noch ihrer Empfindungen. Ja man weiss sogar, dass die Gefühlsäusserungen lebhafter sind, wenn das Grossgehirn ausgeschaltet ist, als wenn es fungiert. Wenn man einen Menschen "wie toll schreien" hört ohne entsprechenden Grund, so nimmt man an, dass sein überlegendes Gehirn nicht normal fungiert. Winckelmann sagt von Laokoon in der berühmten antiken Marmorgruppe: "Er erhebt kein schreckliches Geschrei, wie Virgil von seinem Laokoon singt; die Oeffnung des Mundes gestattet es nicht; es ist vielmehr ein ängstliches und beklemmtes Seufzen, wie es Sadolet beschreibt. Der Schmerz des Körpers und die Grösse der Seele sind durch den ganzen Bau der Figur mit gleicher Stärke ausgeteilt und abgewogen."
Der energische, lebensfrische Lessing ist damit gar nicht einverstanden. Er sagt im "Laokoon": "Schreien ist der natürliche Ausdruck des körperlichen Schmerzes. Homers verwundete Krieger fallen nicht selten mit Geschrei zu Boden. Selbst der eherne Mars, als er die Lanze des Diomedes fühlt, schreit so grässlich, als schrien zehntausend wütende Krieger zugleich, dass beide Heere sich entsetzen."
"Alle Schmerzen verbeissen, dem Streiche des Todes mit unverwandtem Auge entgegensehen, unter den Bissen der Nattern lachend sterben, weder seine Sünde noch den Verlust seines liebsten Freundes beweinen, sind Züge des alten nordischen Heldenmutes. Palnatoko (der Wickinger) gab seinen Jomsburgern das Gesetz, nichts zu fürchten, und das Wort Furcht auch nicht einmal zu nennen."
"Der Grieche schämte sich keiner der menschlichen
 Schwachheiten; keine musste ihn aber auf dem Wege nach
Ehre und von Erfüllung seiner Pflicht zurückhalten."
Schwachheiten; keine musste ihn aber auf dem Wege nach
Ehre und von Erfüllung seiner Pflicht zurückhalten."
Lessing tadelt Ciceros Ansichten über die Erduldung körperlicher Schmerzen: "Dem verdammten oder feilen Fechter kam es zu, alles mit Anstand zu thun und zu leiden. Von ihm musste kein kläglicher Laut gehört, keine schmerzliche Zuckung erblickt werden. Denn da seine Wunden, sein Tod die Zuschauer ergötzen sollten: so musste die Kunst alles Gefühl verbergen lehren."
Die physiologischen Untersuchungen haben seither bewiesen, dass Tiere, denen das Grosshirn und Kleinhirn und Mittelhirn entfernt worden, noch schreien, wenn sie gereizt werden und auch, wenn das Nachhirn mit fortgenommen worden, noch Abwehrbewegungen machen. Geköpfte Frösche, deren Rückenhaut man mit einem Tropfen Säure betupft hat, wischen, scheinbar bedachtsam, mit ihren Hinterpfoten den ätzenden Stoff ab. Man hat daraus sogar schliessen wollen, dass bis ins Rückenmark sich die Seele erstrecke. Genaue Versuche haben gelehrt, dass solche geordnete Bewegungen rein maschinenmässig sind und ebenso unzweckmässig wie nützlich sein können. Von grösster Wichtigkeit ist aber der Nachweis, dass diese Reflexbewegungen schwerer hervorzurufen sind, wenn die Tiere noch Gehirn besitzen, als wenn es ihnen ausgeschaltet ist. Daher nimmt man an, dass das Gehirn ebenso sehr dazu diene Bewegungen zu hemmen, als um solche auszulösen. Folgender höchst interessante Versuch des Strassburger Physiologen Goltz giebt über diese Hemmungsfunktion Auskunft: Wenn man einem Frosch das Grosshirn zerstört hat, so bleibt er in normaler hockender Lage sitzen; wenn man ihm die Rückenhaut streichelt, so quakt er, wie Frösche, denen es im Teiche wohl ist. Von selbst quakt er nie; auf richtiges Streicheln immer, also gesetzmässig. Wenn man einen Frosch mit unversehrtem Gehirn streichelt, so springt er davon oder bleibt sitzen, aber er quakt nicht. Erhöhte Reflexerregbarkeit finden wir auch bei tief schlafenden Menschen und Tieren. Aus Aeusserungen dürfen wir also nicht auf Empfindungen schliessen, sondern wir müssen dann noch andere Beweise für das Dasein von subjektiven Leiden oder Freuden sehen, um wahres Mitgefühl
 haben zu können, sonst werden wir getäuscht wie
weiche Eltern durch das Schreien eines unartigen, vom
Lehrer zu mild gestraften Buben. Kräfte kann man nur
durch Widerstande messen. Daher gewinnen wir nur den
Eindruck von Affekten durch die Anstrengung, deren wir
bedürfen, um zu widerstehen. Die grosse Tragödin Dufe
wirkt mächtig durch verhaltene Leidenschaft. "Wir verachten
denjenigen," sagt Adam Smith, "den wir unter körperlichen
Schmerzen heftig schreien hören." Das ist auch dem
scharfsinnigen Lessing nicht entgangen. Er fügt hinzu: "Aber
nicht immer verachten wir ihn,... dann nicht, wenn wir sehen,
dass ihn der Schmerz zwar zum Schreien, aber auch zu weiter
nichts zwingen kann, dass er sich lieber der längeren Fortdauer
dieses Schmerzes unterwirft, als das geringste in
seiner Denkungsart, in seinen Entschlüssen ändert, ob er
schon in dieser Veränderung die gänzliche Endschaft seines
Schmerzes hoffen darf...... Das alles findet sich bei dem
Philoktet."
haben zu können, sonst werden wir getäuscht wie
weiche Eltern durch das Schreien eines unartigen, vom
Lehrer zu mild gestraften Buben. Kräfte kann man nur
durch Widerstande messen. Daher gewinnen wir nur den
Eindruck von Affekten durch die Anstrengung, deren wir
bedürfen, um zu widerstehen. Die grosse Tragödin Dufe
wirkt mächtig durch verhaltene Leidenschaft. "Wir verachten
denjenigen," sagt Adam Smith, "den wir unter körperlichen
Schmerzen heftig schreien hören." Das ist auch dem
scharfsinnigen Lessing nicht entgangen. Er fügt hinzu: "Aber
nicht immer verachten wir ihn,... dann nicht, wenn wir sehen,
dass ihn der Schmerz zwar zum Schreien, aber auch zu weiter
nichts zwingen kann, dass er sich lieber der längeren Fortdauer
dieses Schmerzes unterwirft, als das geringste in
seiner Denkungsart, in seinen Entschlüssen ändert, ob er
schon in dieser Veränderung die gänzliche Endschaft seines
Schmerzes hoffen darf...... Das alles findet sich bei dem
Philoktet."
Diese Betrachtung zeigt uns die Bedeutung des Grosshirns, aber lehrt zugleich, dass auch bei Säugetieren ein gut Teil des Lebens vom Gehirne unabhängig ist. Wie im Bau so besteht auch in der Funktion ein beträchtlicher Rest segmentaler Anordnung, wie er bei vielen niederen Tieren, z. B. den Ringelwürmern deutlich ausgeprägt ist.
Uralt ist die Erfahrung, dass der Rumpf vieler Tiere nach der Enthauptung sich noch eine Weile, scheinbar willkürlich, bewegt.
Der Kaiser Commodus soll sich oft daran vergnügt haben, im Zirkus den laufenden Straussen mit sichelförmig geschärften Pfeilen den Kopf abzuschiessen, wonach die Tiere bis ans Ziel weiterliefen. Lametrie erzählt ähnliches von Kalekutschen Hühnern, Cuvier von Enten. Ich habe als Knabe oftmals im Hühnerhofe geschlachtete Tauben und Truthühner ohne Kopf flattern und laufen sehen. Es erschien mir daher nicht so wunderbar, dass die von Professor Steiner dekapitierten Haifische ganz normal schwammen. Legallois sah dekapitierte neugeborene Kaninchen sich fünfzehn Minuten lang derart bewegen, dass er annahm, der Rumpf habe noch Willen und Empfindung. Brown-Séquard hat schon im Jahre 1853 die Dauer des Lebens
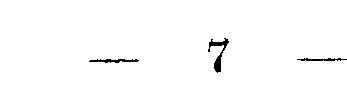 von Tieren bestimmt, nachdem ihnen das gesamte Gehirn
genommen worden war. Salamander und Frösche lebten
danach über vier Monate, Schlangen zwei Wochen, Aale
sechs Tage, andere Fische einen bis drei Tage, neugeborene
Vögel bis zwanzig Minuten, erwachsene Vögel zwei bis
drei Minuten, winterschlafende Igel einen Tag, wachende vier
Minuten, neugeborene Hunde und Katzen oder Kaninchen
36-37 Minuten, erwachsene Säugetiere drei Minuten. Die
Operation tötet den Rumpf durch allmähliche Erstickung.
"Die krankhaften Bewegungen, die nach Köpfung auftreten,
sind blosse Reflexphänomene."
von Tieren bestimmt, nachdem ihnen das gesamte Gehirn
genommen worden war. Salamander und Frösche lebten
danach über vier Monate, Schlangen zwei Wochen, Aale
sechs Tage, andere Fische einen bis drei Tage, neugeborene
Vögel bis zwanzig Minuten, erwachsene Vögel zwei bis
drei Minuten, winterschlafende Igel einen Tag, wachende vier
Minuten, neugeborene Hunde und Katzen oder Kaninchen
36-37 Minuten, erwachsene Säugetiere drei Minuten. Die
Operation tötet den Rumpf durch allmähliche Erstickung.
"Die krankhaften Bewegungen, die nach Köpfung auftreten,
sind blosse Reflexphänomene."
Weshalb bewegen sich diese Teile scheinbar selbständig? Die ersten Bewegungen lassen sich durch den mechanischen Reiz des Schnitts erklären, aber woher kommen die späteren, "spontanen" Bewegungen?
Brown-Séquard hat, von 1851 an, oft gemeldet, dass, wenn Meerschweinchen verschiedenartige Verletzungen des Rückenmarks einige Wochen überleben, sich bei ihnen von Zeit zu Zeit, anscheinend spontan, oder nach gewissen Reizungen ausgedehnte, vorübergehende, sich mehr oder weniger häufig wiederholende Konvulsionen einstellen. Schiff nannte diesen Zustand des Rückenmarks Hyperkinese. Er hält die Konvulsionen gegen Brown-Séquard nicht für epileptische; denn die Tiere sind dabei nicht bewusstlos. Schiff sah diese Hyperkinese bei Fröschen schon wenige Minuten, nachdem er ihnen das Rückenmark durchschnitten hatte. Romberg fand bei einem Manne, der nach Verletzung des untersten Halswirbels gelähmt war, die Reflexerregbarkeit derart erhöht, dass während jeder heftigen Darmbewegung Konvulsionen im Rumpfe und in den Gliedern auftraten. Oft brachen, ohne äussere Erregung, Konvulsionen in den Muskeln der Beine, der Arme und des Rumpfes aus. Bei der ersten Rückkehr der cerebralen Leitung vermochte der Kranke schon einigermassen die Reflexbewegungen zu beschränken, allein dies erforderte grosse Anstrengung der Willenskraft. Auch der Veitstanz (Chorea) besteht nach Romberg "in kombinierten Bewegungen einzelner oder mehrerer Muskelgruppen, unabhängig von cerebralem Einflusse, durch die vom Willen intendierten Bewegungen an Heftigkeit zunehmend, und deren Vollziehung mehr oder
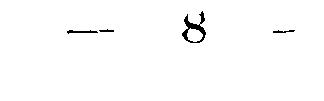 minder störend." Chauveau fand, wie Leyden berichtet, in
einem von Chorea befallenen Hunde die klonischen Krämpfe,
nach Abtrennung des verlängerten Marks unverändert
bestehen. Carville und Paul Bert zeigten, dass unmittelbar
nach solcher Operation bei an Chorea erkrankten Hunden
4-5 Minuten lang die Krämpfe gehemmt werden, dann aber,
während der künstlichen Atmung wieder auftreten. Viele
Krankheiten des Rückenmarks sind von Krämpfen begleitet,
zumal von stossweisen, welche reflektorischer Natur sind.
Die Reizungen des Rückenmarks verursachen klonische
Krämpfe, ebenso wie dies Verletzungen thun, oder Blutungen,
oder Erschütterungen. Sie entstehen auch bei
Fröschen, welche man geköpft hat, oder denen man das
Rückenmark quer durchtrennt hat.
minder störend." Chauveau fand, wie Leyden berichtet, in
einem von Chorea befallenen Hunde die klonischen Krämpfe,
nach Abtrennung des verlängerten Marks unverändert
bestehen. Carville und Paul Bert zeigten, dass unmittelbar
nach solcher Operation bei an Chorea erkrankten Hunden
4-5 Minuten lang die Krämpfe gehemmt werden, dann aber,
während der künstlichen Atmung wieder auftreten. Viele
Krankheiten des Rückenmarks sind von Krämpfen begleitet,
zumal von stossweisen, welche reflektorischer Natur sind.
Die Reizungen des Rückenmarks verursachen klonische
Krämpfe, ebenso wie dies Verletzungen thun, oder Blutungen,
oder Erschütterungen. Sie entstehen auch bei
Fröschen, welche man geköpft hat, oder denen man das
Rückenmark quer durchtrennt hat.
Tiegel, ein jung verstorbener schweizerischer Physiolog, hat vor 18 Jahren, mit seinem Assistenten Osawa in Tokio gefunden, dass Schlangen, denen man den Kopf abgeschnitten hatte, sich am Boden fortbewegten wie unversehrte, nur langsamer. Wenn das Köpfen mit sauberem, scharfem Messer geschehen war, so dauerten die Kriechbewegungen höchstens zehn Minuten; doch wenn man den Schnitt mit Blut bestrich, so ringelte sich der Rumpf viel längere Zeit. Neue Schnitte durch die Wirbelsäule verstärkten die Bewegungen.
Aber auch vom Rückenmarke funktionell ganz losgetrennte Muskeln können sich noch, scheinbar selbständig, rhythmisch bewegen.
Auf diesem Gebiete hat Albrecht von Haller, der grösste Physiolog des vorigen Jahrhunderts, einige seiner schönsten Entdeckungen gemacht.
Ihm zu Ehren soll das hier, in seiner Vaterstadt, neu erstellte, seiner inneren Vollendung harrende physiologische Institut "Hallerianum" genannt werden.
Haller hat die Beobachtung gemacht, dass Muskeln toter Tiere spontan rhythmisch sich zusammenziehen. Am längsten sah er das Zwerchfell sich bewegen. Auch der aus gezeichnete verstorbene Berner Physiolog Valentin hat solche "paralytische Oscillationen" am Zwerchfell kurz zuvor getöteter Tiere bemerkt. Die Bewegungen blieben, nachdem die Zwerchfellnerven durchschnitten waren. Remak sah am Zwerchfell noch 48 Stunden nach dem Tode der
 Kaninchen die mikroskopisch betrachteten Muskelprimitivbündel
langsam wiederholt sich zusammenziehen. Solche
paralytische flimmernde Oscillationen hat Schiff an der
Zungenmuskulatur drei Tage nach Durchschneidung der
Zungenfleischnerven entdeckt. Aehnliches fand er an paralysierten
Gliedermuskeln, an der Iris der Vögel u. s. w.
Kaninchen die mikroskopisch betrachteten Muskelprimitivbündel
langsam wiederholt sich zusammenziehen. Solche
paralytische flimmernde Oscillationen hat Schiff an der
Zungenmuskulatur drei Tage nach Durchschneidung der
Zungenfleischnerven entdeckt. Aehnliches fand er an paralysierten
Gliedermuskeln, an der Iris der Vögel u. s. w.
Sigmund Mayer stellte den Satz auf: "Wenn die normale Ernährung nervöser Endorgane im Muskel gestört worden ist, so werden sie durch erneute Ernährungsvorgänge gereizt. Die postanämischen Oscillationen gelähmter Muskeln dauern fort, wenn die Nervenzweige durch Curare (indianisches Pfeilgift) paralysiert sind. Hiernach muss der Reiz zu diesen oft erstaunlich regelmässigen und kräftigen Bewegungen in den Nervenendgebilden, oder vielleicht in der Muskelsubstanz selbst liegen. W. Kühne hat in verdünnter Lösung von Kochsalz und Natriumphosphat den dünnen Schneidermuskel des Frosches bis 45 Minuten lang wie ein Herz zucken gesehen. Biedermann hat solches Spiel bei niederer 'Temperatur (unter 10 °) tagelang (mit Unterbrechungen) beobachtet und zwar anfangs weniger deutlich als später. v. Fleischl sah das abgeschnittene Bein eines Wasserkäfers Schwimmbewegungen machen.
Albrecht von Haller hat lange Zeit für seine Anschauung gekämpft, dass die Muskel direkt, ohne Vermittlung von Nerven, erregbar sind. Vom Herzen wusste man schon, dass es, abgetrennt vom Tiere, noch längere Zeit schlagen kann. Das Herz der Schildkröte pulsiert unter günstigen Bedingungen 8 Tage, nachdem es aus dem getöteten Tiere genommen ist. — Im vierten Bande seiner Elementa physiologique corporis humani fasst Haller seine Resultate in folgenden wichtigen Sätzen zusammen. Es sei mir erlaubt, dieselben im lateinischen Wortlaute wiederzugeben:
«Separavi irritabilern naturam a vi mortua, inde a vi nervosa, et ab animae potestate. Ab ea motum cordis et intestinorum irritabilem naturam unice pendere ostendi. Ad muscularem fibram unice reduxi, qua in re nondum nobiscum sentit schola batava (Boerhaave); sentiet vero, ut spero, si voluerit a vi irritabili musculo propria vira centractilem fibrae animali communem separare. Ostendi porro, eam vim quidem perpetuo vivam
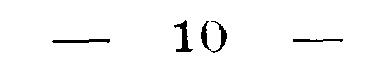 adesse, et saepe nullo, certe qui nobis notus sit, stimulo
externo indigam in motum erumpere; a stimulo tomen,
quotier quievit facillime revocari. In eo motu distinxi
stimulum, qui possit parvus esse, et motum ab eo stimulo
natum, qui possit esse maximus.»
adesse, et saepe nullo, certe qui nobis notus sit, stimulo
externo indigam in motum erumpere; a stimulo tomen,
quotier quievit facillime revocari. In eo motu distinxi
stimulum, qui possit parvus esse, et motum ab eo stimulo
natum, qui possit esse maximus.»
Seitdem ist durch viele Thatsachen die Richtigkeit seiner Anschauungen sichergestellt worden.
Während ich Ihnen kurz über physiologische Ezperimente berichtete, werden manche von Ihnen sich mit Schaudern oder wenigstens mit Unbehagen der Anklagen erinnert haben, welche von den Antivivisektionsvereinen oder von einzelnen Gegnern der Tierversuche gegen diejenigen Forscher geschleudert worden sind, welche sogenannte Vivisektionen zur Förderung ihrer Wissenschaft brauchen: der Physiologen, Pathologen, Pharmakologen, Kliniker, Hygieiniker, Bakteriologen u. s. w.
Der Tierschutz will nicht das Leben der Tiere schützen. Fast alle Menschen, mit Ausnahme einiger schwärmerischer Vegetarianer, halten sich für berechtigt, Tiere zu töten.
Dies ist schon durch die Notwendigkeit geboten. Wenn ein einziges Kaninchenpaar sich sechs Jahre ungestört vermehrte, so würde es eine Nachkommenschaft von viel mehr als vier Milliarden erleben Ein Hundepaar sähe nach 10 Jahren ungestörter Familienfreuden auf eine Descendenz von 2 1/2 Millionen. Daher nötigt der Selbsterhaltungstrieb die Menschen, die Vermehrung der Tiere zu beschränken. Dies geschieht durch Töten mit und ohne Nutzen. Das letztere vollbringt der Mensch entweder direkt, indem er die neugeborenen Tiere ersäuft, erwürgt oder vergiftet, oder indem er Raubtiere zu dem Zwecke hält, wie Katzen gegen Ratten und Mäuse; wie Frettchen und Eulen gegen Kaninchen. In Meyers Konversations-Lexikon kann man im Artikel "Kaninchen" die Stelle lesen: "Das Kaninchen ernährt sich wie der Hase, wird aber bei seiner grossen Fruchtbarkeit und seiner Vorliebe für Baumrinde viel schädlicher. Deshalb verfolgt man die Kaninchen überall, wo und wie man irgend kann, das ganze Jahr hindurch. Doch sind sie ohne Hülfe des Frettchens nicht auszurotten und nur wen der Iltis, das grosse Wiesel, der Steinmarder, Uhus und
 andere Eulen in der Gegend häufig sind, nehmen die Kaninchen
ab. Ich erinnere mich, im Jahre 1883 oder 1884
in einer Berliner Zeitung gelesen zu haben, dass ein Grossgrundbesitzer
bei Lübben in einem Aufrufe ein Mittel zur
Ausrottung der Kaninchen suchte, welche seine Felder verwüsteten.
Ein Förster riet ihm, die Gänge der Kaninchen
mit Petroleum zu füllen und dieses anzuzünden. Das half.
Tausende von Kaninchen wurden lebendig verbrannt.
andere Eulen in der Gegend häufig sind, nehmen die Kaninchen
ab. Ich erinnere mich, im Jahre 1883 oder 1884
in einer Berliner Zeitung gelesen zu haben, dass ein Grossgrundbesitzer
bei Lübben in einem Aufrufe ein Mittel zur
Ausrottung der Kaninchen suchte, welche seine Felder verwüsteten.
Ein Förster riet ihm, die Gänge der Kaninchen
mit Petroleum zu füllen und dieses anzuzünden. Das half.
Tausende von Kaninchen wurden lebendig verbrannt.
Also das Recht der Menschen, Tiere zu töten, erscheint uns sichergestellt. Die zweite Frage ist: zu welchem Zwecke dürfen Tiere getötet werden? Unzweifelhaft 1) zur Ernährung der Menschen (auch über Stillung des Hungers), ferner zur Gewinnung von Heilmitteln und anderen gewerblichen Erzeugnissen: Fellen, Federn, Zähnen, Thran, Perlen u. s. w.; 2) zur Verhütung von Schaden: Raubtiere, die obengenannten Schadenstifter in Wald und Feld, ausserdem schädliche Vögel, Reptilien, Insekten u. s. w.; 3) zum Vergnügen des Menschen: bei Gastmahlen, auf Jagden, oder bei Tierkämpfen u. s. w.; 4) zu idealen Zwecken: a. im Kriege, in denen ja die edlen Pferde, aber auch Hunde, Elefanten u. s. w., unbedenklich geopfert werden; b. für religiöse Opfer, welche vom Christentum beseitigt werden; c. für die wissenschaftliche Erforschung der Lebensvorgänge.
Während man aber für alle genannten Zwecke das Mittel des Tiermordes gutheisst, erhebt die Gesellschaft für Tierschutz Einspruch gegen die letztgenannten Zwecke: die physiologische Forschung. Weshalb? Ist die Erkenntnis der Geheimnisse des Lebens, abgesehen von ihrem Nutzen, zur Diagnose und Heilung von Krankheiten, minderwertig gegenüber der Kriegsführung und dem Sport? Ist die leibliche Ernährung soviel wichtiger, als die geistige? Doch nein, die Tierschützer sind ja Idealisten. Sie verwerfen nicht die Tötung, sondern die Quälerei.
§ 360 des deutschen Reichsstrafgesetzbuches lautet: Die Uebertretung, deren sich derjenige schuldig macht, welcher öffentlich oder in Aergernis erregender Weise Tiere boshaft quält, oder roh misshandelt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft. Also das Quälen ist nicht an sich strafbar, sondern nur, wenn
 es öffentlich geschieht oder Aergernis erregt. Aehnlich
lauten die Gesetzesparagraphen der Kantone: Bern, Glarus,
Graubünden, Zürich und Zug.
es öffentlich geschieht oder Aergernis erregt. Aehnlich
lauten die Gesetzesparagraphen der Kantone: Bern, Glarus,
Graubünden, Zürich und Zug.
Wenn das Quälen der Tiere an sich bestraft würde, dann müssten alle Menschen, deren Beruf ist, Tiere zu züchten oder abzurichten, strafbare Handlungen begehen. Werden nicht Pferde, Rinder, Schweine, Hühner zum Zwecke der Zähmung und Mästung in grausamer Weise verstümmelt, und dadurch die Tiere eines ihrer wesentlichsten Lebensberufe und einer Hauptlust beraubt? Um Strassburger Gänselebern zu erzielen, sperrt man jede Gans in einen engen Käfig, an einem dunklen Orte. Durch einen Schlitz in der Vorderwand des Käfigs kann die Gans den Kopf strecken, um aus einem Gefässe Wasser zu saufen. Mit dem Wasser lässt man sie kleine Stückchen Holzkohle verschlucken. Man stopft der Gans zweimal täglich durch den Schnabel in den Schlund gequellten Mais, etwas Salz und Knoblauch, und zuweilen etwas Mohnöl. Nach 18 bis 24 Tagen ist die Mästung beendet. So wird die fettige Degeneration, ein schwerer Krankheitsprozess, in den Tieren erzeugt, welchem die Tiere nach kurzer Zeit erliegen würden, wenn man sie nicht zuvor tötete. Aehnlich werden die Poulets de Bresse zu vielen Tausenden gezüchtet. Diese Hühner haben überhaupt kein anderes Leben als in den drehbaren Türmen, aus deren Zellen ihnen der Kopf herausgezogen wird, um ihnen mittels einer Spritze den Mastbrei in den Magen zu spritzen. Sobald sie gemästet sind, werden sie getötet. Die Bauern in der Gegend von Rastatt reissen den Fröschen die Schenkel ab und bringen sie in vielen Tausenden von Exemplaren im Sommer auf den Markt. Häufig findet man auf den Wiesen noch lebende Vorderteile der Frösche, weil sich die Fänger nicht die Mühe geben, die Tiere zu töten, bevor sie ihnen die Schenkel abtrennen. Die meisten Rumpfe mögen wohl von den Störchen verzehrt werden.
Auch das Töten der im Uebermass geborenen Hunde und Katzen geschieht bekanntlich nicht in der Narkose, sondern die neugeborenen hülflosen Tierchen werden meist ersäuft. Man hat solche Tiere nach 1/2- bis 2stündigem Todeskampfe unter Wasser wieder aufleben sehen.
All dies und vieles Aehnliche geschieht nicht, um den Menschen notwendige Nahrungsmittel zu gewinnen.
Aber das Quälen der Tiere geschieht auch zum Zwecke der Abrichtung. Hier sind die Schmerzen beabsichtigt. Wie viele Peitschenhiebe und Sporenstiche muss ein Pferd ertragen, bevor es gut eingeritten oder eingefahren ist, wie vielmehr, wenn es zu Schaustellungen dienen soll. Es giebt besondere Gestelle, zwischen denen die Pferde festgebunden werden, um dort unter den Schlägen der Bereiter besondere Schriftarten zu lernen. Und wie gesundheitswidrig ist den Droschkenpferden das stundenlange Stehen auf dem Pflaster bei kaltem, nassen Wetter Aehnlich ergeht es den Hunden. Sind diese edelsten Haustiere um deswillen zu beklagen? Ein streng gezüchtigter Hund leckt seinem sonst wohlwollenden Herrn die Hand, welche ihn schlug.
Zu beklagen sind die herrenlosen Hunde, welche verwahrlost, schmutzig, mit eklem Ungeziefer bedeckt, von jeder Thür fortgejagt, ihre kärgliche, elende Nahrung auf den Strassen zusammenlesen müssen. Solche Geschöpfe werden "Opfer der Wissenschaft". Was geschieht mit ihnen? Wenn sie nicht sogleich zu Experimenten dienen, so werden sie gereinigt, in luftige Ställe gebracht, die mit freien Vorplätzen versehen sein sollen; sie werden meist reichlich gefüttert. In der Mehrzahl der Fälle, wenn die Versuchszwecke es nicht verbieten, werden die Tiere durch subcutane Injektion von Morphium, in manchen Laboratorien durch Opium, Aether oder Chloroform betäubt und unempfindlich gemacht, bevor sie gefesselt werden. Das Fesseln der Tiere an den Operationstisch erregt bei Menschen, welche sich in die Lage der Versuchsobjekte versetzen, das grösste Mitleid Würde man es für human halten, Menschen an eine Hundehütte zu ketten oder ihnen Maulkörbe vorzubinden? Hiernach ist kein Experiment für die Tiere "quälend" , ebensowenig wie irgend ein Mensch, der sich einer chirurgischen Operation unterwirft, von den tiefsten Eingriffen etwas fühlt. Die Hunde haben auch nach der Operation keineswegs die Empfindung, gemartert worden zu sein. Die Hunde, welche nach der Operation erhalten bleiben, sind anhänglich, ja, wenn ihr Charakter dazu neigt, zärtlich — genau wie die abgerichteten. Solche operierte Hunde findet man in gut gehaltenen physiologischen Instituten
meist in trefflichem Zustande, zuweilen im fröhlichen Besitze zahlreicher Familie.
Ja sie scheinen stolz auf die Beachtung zu sein, die man ihnen widmet. Sie springen frohwedelnd auf den Tisch um sich untersuchen zu lassen und ertragen kleine Operationen, die etwa bei zugewachsener Fistel nötig werden, unangebunden, ohne zu zucken.
Den Arzt wundert das nicht, denn er weiss, dass wesentlich die Haut Sitz der Schmerzempfindung ist, die Blutgefässe, Muskeln Sehnen, Knochen u. s. w., ganz oder fast unempfindlich gegen Schnitt, Druck u. s. w. sind. Jedermann hat aber wohl auch schon die Erfahrung gemacht, dass sehr schnelle Trennungen der Haut mittels Rasiermesser oder scharfer Rapiere oder durch Flintenkugeln von grosser Geschwindigkeit nicht schmerzen. Mit sehr scharfen Messern kann man also operieren, ohne Schmerzen zu verursachen. Auch ist bekannt, dass Soldaten weiterrauchten, während ihnen ohne Narkose, Gliedmassen amputiert wurden. Schmerzhafte Schläge mit Stöcken oder Peitschen teilt der Physiolog nicht aus.
Kaninchen sind ausserordentlich unempfindlich gegen körperliche Insulte. Tiefschlafenden Kaninchen fressen ihre Stallgenossen zuweilen die Ohren ab. Kaninchenböcke verstümmeln einander aufs Scheusslichste. Man muss einem Kaninchen sensible Nervenstämme (Trigeminus) zerschneiden, bevor es vor Schmerzen schreit (Claude Bernard 1858). Dagegen schreit es häufig heftig vor Aufregung, wenn man es (wie dies üblich ist) an den Ohren aufhebt. Auch wenn es tief betäubt ist, sodass es sicherlich nichts fühlen kann, schreit es häufig bei geringfügigen Eingriffen reflektorisch. Hierdurch werden Unerfahrene oft getäuscht Wenn abgeschnittene Aalschwänze von den Köchinnen in das siedende Wasser geworfen werden, so winden sie sich, als ob sie Schmerz empfänden. Lotze, der Philosoph, und Goltz, der Physiolog, haben die Frage, ob in geköpften Tieren ein Stück Seele stecke, verneinend entschieden.
Die Physiologen unterscheiden sich von den Laien, welche sich mit Tieren beschäftigen, sowie von den zum Jagen und Vertilgen gehaltenen Raubtieren in zwei Punkten: 1) Sie wissen genau, welche Eingriffe schmerzhaft sind und durch
welche Mittel man die Schmerzen verhüten oder mildern kann. 2) Bei ihnen ist das Quälen der Tiere niemals Selbstzweck.
Die Herren Antivivisektionisten stellen die Experimentatoren als wütende Metzger dar, welche in den "Folterkammern der Wissenschaft" Hekatomben von Hunden opfern, um sich an den Qualen der unglücklichen Geschöpfe zu weiden.
Die berühmten Jagdstücke des mittelalterlichen vlämischen Malers Franz Snyders, auf denen zerfleischende und zerfleischte Hunde in Lebensgrösse naturwahr dargestellt sind, haben, meines Wissens, nicht zur gesetzlichen Verfolgung der Jäger angereizt. Wereschagin freilich wünschte durch seine grausigen Schlachtenbilder Abscheu vor dem Kriege zu erwecken.
Haller sagt im Anfange seiner Abhandlung "Von den empfindlichen und reizbare Teilen des menschlichen Körpers": Ich habe mit Herrn Dr. Zimmermann vom Anfange des Jahres 1751 an mehr als 400 lebendige Tiere auf mancherlei Weise untersucht. Ich habe in der That hierbei mir selbst verhasste Grausamkeiten ausgeübt, die aber doch der Nutzen für das menschliche Geschlecht und die Notwendigkeit entschuldigen werden, da dabei sich gleichwohl der mitleidigste Mensch des Fleisches der Tiere ohne Vorwurf und ohne sich ein Gewissen darüber zu machen bedient.
Welcher Einsichtige wird glauben, dass es dem Experimentator an und für sich ein Vergnügen gewährt, mit übelriechenden, schmutzigen, mit Flöhen und Läusen behafteten, oft bissigen, zuweilen in ekelerregender Weise kranken, ja selbst tollen Hunden, Katzen und Kaninchen, widerwärtigen Kröten und Schlangen zu hantieren? Nur die Begeisterung für die wunderbaren Geheimnisse des Lebens, für die unendliche Mannigfaltigkeit des tierischen Organismus, lässt den Forscher alle Widrigkeiten vergessen. Wie würde es ihm möglich sein, mit rohen Metzgerhänden die von ihm bewundernd erkannten Kunstwerke der Schöpfung zu zerstören? Die griechischen Splanchnoskopiker und die römischen Haruspices machten an Opfertieren die ersten anatomischen und physiologischen Beobachtungen. Die Physiologie stünde nicht am Anfang, sondern auf der Höhe
ihrer Bahn, wenn die Milliarden zu profanen Zwecken geopferten Tiere und Menschen wissenschaftlich beobachtet worden wären.
Aber auch der Studierende der Medizin muss von idealem Streben, mit hoher Selbstüberwindung, beseelt sein, um zu anatomischen Studien faulende Leichen tagelang zu durchforschen , zur Vermehrung physiologischer Erkenntnis mit bösen oder widerwärtigen Tieren zu experimentieren, zu pathologischer und klinischer Ausbildung Fäkalmassen, Urin, Blut, Eiter, Auswurf u. s. w. zu untersuchen.
Dies alles ist aber notwendig zur Erziehung des Arztes. Was würde man von eiv eni Arzte denken, der merken liesse, dass ihm der Verkehr mit Kranken, von denen Laien sich mit Ekel oder mit Grauen abwenden würden, ihm unangenehm wäre, oder der durch den Anblick zuckender und blutender Teile erschreckt, durch krampfhafte Bewegung oder selbst durch Schmerzäusserungen aus der Fassung gebracht würde, sodass er nicht mit ruhiger Besonnenheit einzugreifen vermöchte? Die Anatomie und das physiologische Laboratorium sind die Manöverfelder, die Krankenzimmer die Schlachtfelder der Aerzte. Wer nicht an Leichen und Tieren seine Erfahrungen über den Bau und die Funktionen des Organismus sammelt, muss es später zum Schaden seiner Patienten an diesen thun.
Aber — und das ist der Hauptpunkt dieser ganzen Darlegung, diese Schattenseiten des Daseins dürfen nicht ins helle Licht gestellt werden. Die stillen Studien dürfen nicht auf den Markt gezogen werden. Wer würde noch Freude an Theatervorstellungen haben, wenn er immer hinter die Coulissen sähe, wer im Zirkus sich ergötzen, wenn er die "Dressur" von Pferden und Hunden hätte mitansehen müssen und die Verrenkungen der zukünftigen Schlangenmenschen? Wem würde nicht der Appetit vergehen, wenn er sähe, wie die leckersten Speisen in der Küche zubereitet werden? Wie würden zumal die spanischen und italienischen Weine schmecken, wenn wir das Keltern mitangesehen hätten? Wie wenige Bäckereien dürften vor den Augen ihrer Abnehmer den Teig kneten lassen? Die moderne Sitte gebietet, viele körperliche Verrichtungen zu verbergen, auch die Kranken, deren Anblick unangenehme Empfindungen
erregt, abzusondern. Sogar die schönste menschliche Gestalt wird schamhaft verhüllt.
Mir scheint demnach der Tierschutzparagraph des Reichsstrafgesetzbuches mehr die Ankläger der Vivisektion, als die Experimentatoren zu treffen, denn diese Ankläger erregen öffentliches Aergernis, indem sie auf den Markt bringen, was in die Stille des Laboratoriums gehört. Die Herren wissen wohl nicht, dass sie die Wurzel unserer edelsten Industrie abgraben! Galvani war Anatom und Physiolog. Emil du Bois-Reymond hat die Verbindung von Siemens und Halske herbeigeführt und Hermann von Helmholtz war Präsident der technischen Reichsanstalt.
Uebrigens werden unsere meisten Experimente gar nicht an lebenden Tieren, sondern nach C. Ludwigs Methoden an überlebenden Organen ausgeführt.
Aber nicht nur einzelne Organe, sondern auch einzelne Zellen können ein vom Leben des ganzen Tieres unabhängiges Dasein führen.
Im Blute und in der Lymphe finden sich Milliarden von weissen Zellen, die langsam aber beständig ihre Gestalt verändern nach Art der mikroskopischen einzelligen Tiere, welche Amöben genannt werden. Sie strecken Fortsätze aus dem Zellleib, kriechen durch enge Spalten, sogar der Blutgefässwände, nehmen in den Blutstrom gebrachte Teilchen, wie z. B. Fetttröpfchen, auf und verarbeiten dieselben, helfen bei der Aufsaugung der Speisen aus dem Darmkanale u. s. w. Ausser diesen unaufhörlich thätigen Packträgern auf den Lebenswegen finden sich noch festpostierte Strassenarbeiter, die sogenannten Flimmerepithelzellen, welche z. B. die Atmungswege von der Nase bis zur Lunge freizuhalten haben. Diese ebenfalls mikroskopisch kleinen Zellen überkleiden lückenlos die Kanäle und tragen auf ihrer Oberfläche kurze feinste, aber sehr feste Härchen, die sie unaufhörlich in schnellem Tempo wie Geisseln bewegen. Sie treiben den in die Kanäle ergossenen Schleim heraus. Dieser nützt, indem er die zu den Lungenbläschen vordringende Luft und die Epithelzellen selbst feucht zu erhalten und die eingeatmeten Staubteilchen den ausfegenden Zellen gebunden zu übergeben vermag. Diese Zellen sind so sehr unabhängig vom Willen und allen nervösen Teilen, dass
ihre Thätigkeit lediglich von ihren lokalen Verhältnissen bedingt wird. Ja sie können noch in lebhafter Bewegung sein, wenn das Tier längst tot ist und zu faulen beginnt. So haben wir das Leben bis in die Zellen sich teilen sehen. Aber selbst hier ist es noch nicht unteilbar geworden.
Neue Untersuchungen über Bau und Funktion der Zelle haben gezeigt, dass der Kern eine vom umgebenden Protoplasma in gewissem Grade unabhängige Rolle spielt. "In die Zellentheorie in ihrer heutigen Form betrachtet die Zelle nicht als ein Elementarorgan, sondern als den Elementarorganismus der lebendigen Welt" (Flemming). Nach den Anschauungen von Maggi und Altmann ist die Zelle eine Kolonie oder ein symbiotisches Aggregat von selbstlebenden Einzelorganismen. (Körnchen, Granula; Plastidule oder Bioblasten.) Flemming will freilich nicht eher den Granulis eine selbständige Bedeutung zuerkennen, bevor nicht erwiesen ist, dass sie ausserhalb der Zelle dauernd leben, sich ernähren und fortpflanzen können, wie eine Zelle.
Hiermit haben wir auch diejenige Art von Leben gestreift, welches als das vegetative betrachtet wird Nicht nur die äusserlich grob merkliche Bewegung bekundet das Leben, sondern auch die still wirkende, erhaltende und vermehrende, nur moleculare Bewegungen erzeugende Kraft. Aufbau und Zerfall oder Assimilation und Dissimilation sind die beiden Pole des lebenden Mikrokosmos. Ohne Zerfall keine Bewegung; vielleicht gewährt auch die Assimilation Empfindung.
Giebt es aber gar keine Ruhe im Leben? Bei den hoch organisierten Geschöpfen sicherlich nicht. Ohne Atmung, ohne Herzschlag kein Leben! Aber diese Aeusserungen können, sogar bei Säugetieren ausserordentlich vermindert sein. Dies beobachtet man zumal an den Winterschläfern. Die Körperwärme winterschlafender Murmeltiere sinkt bis zu solcher von Kaltblütern, etwa 4 °, das Tier atmet nur sehr selten und flach, sein Herz schlägt etwa 10 Mal in einer Minute. Das Tier ist ganz gefühllos. Man kann ihm den Kopf abschneiden, ohne dass es sich rührt. Es kann selbst unter Wasser lange Zeit fortschlafen. In Sibirien hat man sie 6 Meter unter der Erde schlafend
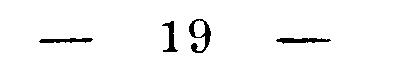 gefunden. Starke Kälte weckt sie auf, wonach sie dann sogleich
Warmblüter werden, zugleich aber schnell kältesichere
Schlupfwinkel aufsuchen. Derartige Vita minima findet man
bekanntlich auch bei Igeln, Haselmäusen, Fledermäusen,
Maulwürfen, Hamstern e., in minderem Grade beim Bären.
Auch sehr viele sogenannte kaltblütige Tiere verfallen in
Winterschlaf, manche in tropischen Gegenden auch in
Sommerschlaf. Der Alligator schläft im nördlichen Amerika
während der Winterkälte, im tropischen Amerika während
der trockenen und heissen Jahreszeit. Da vergraben sich
auch die grossen Schlangen für mehrere Monate im Schlamme.
Unter den Vögeln finden sich keine Winterschläfer. Diejenigen,
welche den nordischen Winter nicht vertragen,
ziehen nach dem Süden. Von Pflanzen ist die Winterruhe
allbekannt. Samenkörner erhalten sich viele Jahre, türkischer
Weizen über 300 Jahre keimfähig. Manche Moose,
die 10 Jahre lang im Trockenen (z. B. in Herbarien) gelegen
haben, können durch Wasser wieder zum Wachsen gebracht
werden. Die Ruhe ist aber kein Tod, nur ein äußerst
sparsames Leben.
gefunden. Starke Kälte weckt sie auf, wonach sie dann sogleich
Warmblüter werden, zugleich aber schnell kältesichere
Schlupfwinkel aufsuchen. Derartige Vita minima findet man
bekanntlich auch bei Igeln, Haselmäusen, Fledermäusen,
Maulwürfen, Hamstern e., in minderem Grade beim Bären.
Auch sehr viele sogenannte kaltblütige Tiere verfallen in
Winterschlaf, manche in tropischen Gegenden auch in
Sommerschlaf. Der Alligator schläft im nördlichen Amerika
während der Winterkälte, im tropischen Amerika während
der trockenen und heissen Jahreszeit. Da vergraben sich
auch die grossen Schlangen für mehrere Monate im Schlamme.
Unter den Vögeln finden sich keine Winterschläfer. Diejenigen,
welche den nordischen Winter nicht vertragen,
ziehen nach dem Süden. Von Pflanzen ist die Winterruhe
allbekannt. Samenkörner erhalten sich viele Jahre, türkischer
Weizen über 300 Jahre keimfähig. Manche Moose,
die 10 Jahre lang im Trockenen (z. B. in Herbarien) gelegen
haben, können durch Wasser wieder zum Wachsen gebracht
werden. Die Ruhe ist aber kein Tod, nur ein äußerst
sparsames Leben.
Auch das sichtbare Leben kann jahrelange bestehen. Während Cercaria ephemara (eine Eintagsfliege) nicht viel über sechs Stunden lebt, manche Korallentiere nur einige Tage, Wochen oder Monate vegetieren, können Spinnen einige Jahre, Fische über 100 Jahre alt werden. Im Jahre 1497 wurde bei Kaiserslautern ein 3 Zentner schwerer Hecht gefangen, der nach der Inschrift auf einem an den Kiemendeckel gehefteten Kupferring 267 Jahre zuvor gefangen und wieder ins Wasser gesetzt worden war. Adler und Raben können 100 Jahre alt werden, Papageien noch viel älter, Elephanten bis 200 Jahre. Als die ältesten Menschen aus historischer Zeit sind von Hufeland der Schotte Kintingern und der Ungar Peter Czartan genannt, welche das Alter von etwa 180 Jahren erreicht haben sollen.
Bäume können viel länger vegetieren. Aus der Stärke der Stämme, aus der Zahl der Jahresringe und aus historischen Ueberlieferungen hat man erfahren, dass Cypressen und Ulmen über 200 Jahre, Epheu 450, Bergahorn 500, Lärchen 570, Kastanien 600, Oelbäume und Platanen 700, Cedern und Orangenbäume 800, Linden 1000, Eichen 1500,
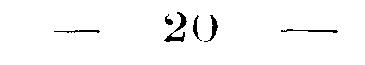 Eiben 2000 Jahre alt werden können. Einer virginischen
Cypresse wird das Alter von 6000 Jahren zugesprochen.
Eiben 2000 Jahre alt werden können. Einer virginischen
Cypresse wird das Alter von 6000 Jahren zugesprochen.
Pflanzen widerstehen, im allgemeinen, schädlichen Einflüssen besser als Tiere. Herr Prof. Tavel hat im bakteriologischen Institute hiesiger Universität die Beobachtung gemacht, dass Sporen von Wasserbakterien 16 Stunden lang im strömenden Wasserdämpfe von 100 ° noch entwicklungsfähig blieben. Manche fette Pflanzen sah man noch vegetieren, nachdem sie in kochendem Wasser abgebrüht und einige Wochen lang unter der Presse gewesen waren. Aber auch Tiere können unter schädlichsten Bedingungen ihr Leben fristen. Schnecken, Fische und Amphibien kommen in heissen Quellen vor. Insekten und Frösche, welche eingefroren sind, leben wieder auf, wenn der Eisklumpen, der sie eingeschlossen, aufgethaut wird. Franklin sah Fliegen, die auf Madera im Wein ertrunken waren, in Amerika an der Luft wieder lebendig wurden. Wie lange Kröten, die man in Marmorblöcken und anderen Steinen eingeschlossen gefunden hat, ohne Zutritt von Luft gelebt haben, ist nicht zu berechnen. Kleine Karpfen, welche von Störchen verschluckt worden waren, sollen bisweilen lebendig wieder entleert worden sein. Ausgetrocknete Rädertierchen sah Leuwenhoeck nach 2 Jahren, Spallanzani nach 4 Jahren wieder aufleben. Endlich aber erlischt bei allen Geschöpfen das Leben. Das Ende heisst Sterben. — Goethes Mephistopheles nennt dies den letzten, schlechten, leeren Augenblick. Faust dagegen ruft sterbend: "Im Vorgefühl von solchem hohem Glück geniess ich jetzt den höchsten Augenblick."
Ist der Tod der würgende Knochenmann oder der ernstere Bruder des Schlafes?
Den Lebenden erscheint er um so grausiger, je gewaltsamer er den Menschen packt. Wie erscheint er den Sterbenden?
Albrecht von Haller schliesst den letzten (achten) Band seiner Elementa phyiologiae corporis humani folgendermassen: Die Zeichen strahlender Hoffnung prägt die fliehende Seele nicht selten den Sterbenden auf. Ich habe viele gesehen, welche mit heiterstem Antlitz, selbst sanftestem Lächeln aus dem Leben schieden. Solcher Tod ist des weisen Mannes wohlverdientes, letztes und mächtigstes Verlangen.
Es wurde ihm selbst leider nicht erfüllt, wie Prof. Ludwig Hirzel uns in seiner schönen Lebensbeschreibung des grossen Mannes erzählt.
Ein plötzlicher Tod, welcher dem Beobachter Grausen erweckt, kann den Sterbenden ohne eine Spur von Leid treffen. Schnell eintretende Totenstarre fixiert zuweilen untrügliche Zeichen der letzten Empfindung in den Zügen Gestorbener. — Der ehemalige Jenenser Kliniker Rossbach hat auf dem Schlachtfelde bei Sedan merkwürdige Beobachtungen gemacht: Eine Gruppe von sechs Franzosen wurde durch einen einzigen Granatschuss beim Frühstück getötet. Bei dem einen sah man ein lachendes Gesicht, von dem das Schädeldach abgerissen war. Der neben ihm Sitzende hielt zierlich mit Daumen und Zeigefinger, eine zinnerne Tasse an seine Unterlippe. Der ganze Schädel bis zum Unterkiefer war fortgeschleudert. Ein in die Brust geschossener Deutscher lag halb seitlich auf seinem Tornister und hielt in der vor die Augen gehobenen, erstarrten Hand die Photographie einer Frau.
Aber nicht allein auf Mutmassungen beruht unsere Kenntnis von Sterbegedanken, sondern wir besitzen Nachrichten von Menschen, die dem Tode zueilten.
Freilich haben wir keine Kunde von den Seelen Verstorbener. Spiritistischer Spuk von "Dingen zwischen Himmel und Erde" soll von dem Irrenarzte oder von der Polizeikommission beurteilt werden.
Aber Verunglückte, die gerettet werden, haben ihre während der Katastrophe empfangenen Eindrücke erzählt. So hat Herr Professor Heim im Jahrbuche des Schweizer Alpenklubs (vom Jahre 1891) fesselnde "Notizen über den Tod durch Absturz" veröffentlicht. Er beschreibt unter anderem seinen Absturz am Säntis oberhalb der Fehlalp. Während er stehend auf steilem Schneecouloir herabfuhr, kam er zu Fall. Er erzählt weiter: "Nun vermochte ich meinen Sturz nicht mehr zu regieren. Ich trieb mit Windeseile an den linkseitigen Felskopf, prallte am Felsbord hinauf, fuhr dann auf dem Rücken mit dem Kopf nach unten, über den Fels und flog schliesslich noch zirka 20 Meter frei durch die Luft, bis ich auf der Schneekante unter der Wand liegen blieb.
Sofort, wie ich stürzte, sah ich ein, dass ich nun an den Fels geworfen werden müsse, und erwartete den Anprall. Ich grub mit den gekrallten Fingern in den Schnee um zu bremsen, und riss mir dadurch alle Fingerspitzen blutig, ohne Schmerz zu empfinden Ich hörte genau das Anschlagen meines Kopfes und Rückens an jeder Ecke des Felsens, und ich hörte den dumpfen Schlag, als ich unten auffiel. Schmerzen aber empfand ich erst etwa nach einer Stunde. Während dem Fall stellte sich eine grosse Gedankenflut ein. Was ich in fünf bis zehn Sekunden gedacht und gefühlt habe, lässt sich in zehnmal mehr Minuten nicht erzählen. Alle Gedanke; und Vorstellungen waren zusammenhängend und sehr klar, keineswegs traumhaft verwischt. Zunächst übersah ich die Möglichkeit meines Schicksals und sagte mir: Der Felskopf, über den ich nächstens hinausgeworfen werde, fällt unten offenbar als steile Wand ab, denn er verdeckte den unten folgenden Boden für meinen Blick; es kommt nun ganz darauf an, ob unter der Felswand noch Schnee liegt. Wenn dies der Fall ist, so wird der Schnee von der Wand abgeschmolzen sein und eine Kante bilden. Falle ich auf die Schneekante, so kann ich mit dem Leben davon kommen, ist aber unten kein Schnee mehr, so stürze ich ohne Zweifel in Felsschutt hinab, und dann ist, bei dieser Sturzgeschwindigkeit, der Tod ganz unvermeidlich. Bin ich unten nicht tot und nicht bewusstlos, so muss ich sofort nach dem kleinen Fläschchen Essigäther greifen, das ich beim Weggehen auf dem Säntis nicht mehr in die Tornisterapotheke geborgen, sondern nur in die Westentasche gesteckt habe, und davon einige Tropfen auf die Zunge nehmen. Den Stock will ich nicht gehen lassen, vielleicht kann er mir noch nützen. Ich behielt ihn dann auch fest in der Hand. Ich dachte daran, die Brille wegzunehmen und fortzuwerfen, damit mir nicht etwa ihre Splitter die Augen verletzen, allein ich wurde derart geworfen und geschleudert, dass ich der Bewegung meiner Hande hiefür nicht mächtig werden konnte. Eine andere Gedanken- und Vorstellungsgruppe betraf die Folgen meines Sturzes für die Hinterbleibenden. Ich sagte mir, dass ich unten angekommen, gleichgültig, ob ich schwer verletzt sei oder nicht, jedenfalls, wenn immer möglich, sofort aus
Leibeskräften rufen müsse: "Es hat mir gar nichts gethan!" damit meine Begleiter, darunter mein Bruder und drei Freunde, aus dem Schrecken sich so weit aufraffen konnten, um überhaupt den ziemlich schwierigen Abstieg zu mir herab zu stande zu bringen. Ich dachte daran, dass ich nun meine auf fünf Tage später angekündigte Antrittsvorlesung als Privatdozent jedenfalls nicht halten könne. Ich übersah, wie die Nachricht meines Todes bei den Meinigen eintraf, und tröstete sie in Gedanken. Dann sah ich, wie auf einer Bühne aus einiger Entfernung mein ganzes vergangenes Leben in zahlreichen Bildern sich abspielt. Ich sah mich selbst als die spielende Hauptperson. Alles war wie verklärt von einem himmlischen Lichte und alles war schön und ohne Schmerz, ohne Angst, ohne Pein, auch die Erinnerung an sehr traurige Erlebnisse war klar, aber dennoch nicht traurig. Kein Kampf und Streit, auch der Kampf war Liebe geworden. Erhabene und versöhnende Gedanken beherrschten und verbanden die Einzelbilder, und eine göttliche Ruhe zog, wie herrliche Musik, durch meine Seele. Mehr und mehr umgab mich ein herrlich blauer Himmel mit rosigen und besonders mit zart violetten Wölklein — ich schwebte peinlos und sanft in denselben hinaus, während ich sah, dass ich nun frei durch die Luft flog, und dass unter mir noch ein Schneefeld folgte. Objektives Beobachten, Denken und subjektives Fühlen giengen gleichzeitig neben einander vor sich. Dann hörte ich mein dumpfes Aufschlagen, und mein Sturz war zu Ende. In dem Momente war mir, es busche ein schwarzer Gegenstand vor meinen Augen vorüber, und ich rief aus Leibeskräften drei bis vier Mal nacheinander: "Es hat mir gar nichts gethan!" Ich nahm von dem Essigäther, ich griff nach der Brille, die unversehrt neben mir im Schnee lag, ich betastete meinen Rücken und meine Glieder, um zu konstatieren, dass ich keine Knochen gebrochen.
Da sah ich meine Begleiter langsam, Tritt um Tritt hauend, im Schneecouloir schon ganz nahe bei mir hinter dem Felskopf, über den ich hinausgeflogen war, erscheinen. Ich konnte nicht begreifen, dass sie schon so weit waren. Sie sagten aber, ich hätte wohl eine halbe Stunde keine Antwort gerufen. Hieraus erst ersah ich, dass ich beim Aufschlagen
das Bewusstsein verloren hatte. Damit war aus jeder Sinnes und jeder Gefühls- und Gedankenthätigkeit eine halbe Stunde herausgeschnitten. Der schwarze Gegenstand war das Verschwinden der Bewusstlosigkeit, das offenbar für das Auge einen Bruchteil einer Sekunde später sich einstellte, als für das empfindende Gehirn. Und ohne den Unterbruch selbst zu bemerken, hatten die Gedanken und Thätigkeiten nachher genau da sich fortgesetzt, wo sie vorher unterbrochen worden waren. Dazwischen war ein absolutes subjektives Nichts. Die schönen, himmlischen Vorstellungen aber empfand ich nur, so lange ich noch durch die Luft flog und sehen und denken konnte. Mit der Bewusstlosigkeit beim Aufschlagen waren auch sie plötzlich weggewischt und setzten nachher nicht mehr fort.
Noch konnte ich gehen, nachdem mich mein Freund, Dörig, auf die Beine gestellt hatte. Die Quetschungsschmerzen im Rücken und der Kopfschmerz entrissen mir zwar manchen Schrei, bis ich, in Eisumschläge gewickelt, auf der Meglisalp lag. Meine Antrittsvorlesung habe ich aber dennoch zur vorher festgesetzten Zeit gehalten."
Goethe preist in kurzen Aphorismen "die Natur" unter anderem in folgenden bedeutungsvollen Worten:
"Ihr Schauspiel ist immer neu, weil sie immer neue Zuschauer schafft. Leben ist ihre schönste Erfindung und der Tod ist ihr Kunstgriff viel Leben zu haben."
Eigentlich lösen sich Tod und Leben in jedem Geschöpfe beständig ab. Unsere Organe erneuern sich fortwährend. Zellen gehen zu Grunde und nene treten an ihre Stelle. Die Blutkörperchen, welche ihre Elastizität verloren haben, bleiben in .den Lebergefässen stecken und werden von den Leberzellen verarbeitet. Neugebildete Zellen treten dafür auf, so dass nach wenig mehr als einem Monate das gesamte Körperblut erneut ist Ueber die Lebensdauer der anderen Gewebe wissen wir noch wenig. Nach Pflügers neuen Anschauungen schrumpft im Alter der Körper, weil die Neubildung kleiner als der Verbrauch ist. Die bildende Thätigkeit, welche die Ursache des Wachstums ist, nimmt schon von Beginn des Lebens an stetig ab. Sie kann nicht durch Ruhe und Nahrung erneuert werden.
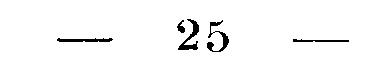
Das Altern eines Gewebes ist nach Merkel nur abhängig von seiner Lebensbeschaffenheit; die Gewebe mit embryonalem Charakter, wie die Epithelgewebe, regenerieren sich am vollständigsten und längsten, ähnlich die glatte Muskulatur und die Drüsen, weniger die quergestreifte, am mindesten das Herz. Dort finden wir schon in der Kinderzeit Produkte regressiver Metamorphose in Pigmentmassen, welche die Kerne umlagern und es treten da am ehesten physiologische Alterserscheinungen auf. Doch scheint auch der Herzmuskel durch funktionelle Gymnastik teilweise regeneriert werden zu können. Bei den Binde- und Stützsubstanzen ist die Reproduktionskraft sehr gering, Nervenzellen wachsen, aber vermehren sich nicht. Bald sammelt sich in ihnen Pigment, zum Zeichen, dass ihr Stoffwechsel gelitten hat.
Nach Minot's ergebnisreichen Untersuchungen über Altern und Verjüngung überwiegt in den jugendlichen Zellen der Kern, in alternden das Protoplasma. Meerschweinchen haben während langsamer Wachstumsperiode protoplasmareiche Zellen; Fische, die sehr lange wachsen, haben wenig Protoplasma in ihren Gewebezellen. Protoplasma ist, nach Minor, das Merkmal der Entartung, während man bisher das Protoplasma für das Substrat des Lebens hielt. Die Befruchtung scheint ihm den Anstoss für das Wachstum, auch während des späteren Lebens der Tiere zu geben; daher sei von der Geburt an die Energie des Wachstums vermindert.
August Weismann giebt in seinem umfangreichen Buche, betitelt "Das Keimplasma, eine Theorie der Vererbung" (1892). Er nennt das Vererbungsplasma des Kerns "Idioplasma", das Gestaltungsplasma des Zellkörpers "Morphoplasma", ferner die kleinsten Einheiten des lebenden Protoplasmas "Biophoren" (Lebensträger), welche schon zu: Stoffwechsel, Wachstum und Vermehrung durch Teilung befähigt sind. Eine Gruppe von Biophoren, die zu einer höheren Lebenseinheit verbunden sind, heisst "Determinante" (Eigenschaftsträger). Gruppen von Determinanten bilden ein "Id" (Ahnenplasma), das sämtliche Elemente enthält, welche für die Entwicklung aller folgenden Id-Stufen erforderlich sind. Gruppen von Iden bilden die "Idanten".
 Dies sind die mit guten Mikroskopen erkennbaren Kernstäbchen
der im Ei vereinten Keimzellen.
Dies sind die mit guten Mikroskopen erkennbaren Kernstäbchen
der im Ei vereinten Keimzellen.
Weismann stellt folgenden Lehrsatz auf: "In der Keimzelle sind mindestens so viele Determinanten enthalten, als verschiedene, vom Keim aus einzeln bestimmbare Zellen oder Zellengruppen im fertigen Organismus vorhanden sind." Mit de Vries sieht er im Kerne der Keimzelle ein Magazin von Reserve Biophoren, die bei der Teilung des Bion sich verdoppeln und jeder Hälfte die ihr fehlenden Biophoren-Arten zuführen. Der Kern bestimmt den Charakter der Zelle.
"Wenn es feststeht, dass mit der Mischung der elterlichen Idioplasmen, wie sie bei der Befruchtung zu stande kommt, die Charaktere des sich entwickelnden Kindes in allen wesentlichen Punkten bestimmt sind, so fragt es sich zunächst, was eigentlich vom Idioplasma der Eltern in der Keimzelle dem Kinde überliefert wird: das ganze elterliche Idioplasma mit allen darin enthaltenen Determinanten, oder bloss ein Teil davon, wieviel vom Keimplasma der Grosseltern, Urgrosseltern und ferneren Vorfahren."
"Soviel ist sicher, dass in dem Keimplasma des befruchteten Eies niemals sämtliche Idanten eines der Eltern enthalten sein können, sondern nur die Hälfte derselben." ....."Dass diese Hälfte aber aus allen möglichen Kombinationen der Idanten des Elters bestehen kann, also entweder bloss aus grossväterlichen oder bloss aus grossmütterlichen Idanten, oder aber aus einer Kombination grossmütterlicher und grossväterlichen Idanten, in welchen bald die einen, bald die anderen überwiegen." Jedoch ist das Kind niemals identisch mit "dem Elter". Jede Vererbung schliesst Variation in sich ein. Veränderungen der Kernsubstanz (durch äussere Einflüsse) können Veränderungen des Zellkörpers erblicher Natur hervorrufen.
Die Lehre von den Biophoren erinnert an die Monadologie. Monade nannte Leibniz die einfache, unausgedehnte Substanz, welcher thätige (Spann)-Kraft eigen ist. Jeder Körper besteht aus einer Vielheit von Monaden. Alle Monaden haben Vorstellungen, die dunkel oder klar sein können. Die Mineralien und Pflanzen sind gleichsam Komplexe schlafender Monaden mit unbewussten Vorstellungen.
 Die tierischen Monaden haben Bewusstsein, die
menschlichen Monaden können von ihren inneren Zuständen
deutliche Vorstellungen haben, ja sogar einzelne adäquate,
d. h. den wirklichen Zuständen entsprechende. Gott ist die
Urmonade und hat lauter adäquate Vorstellungen.
Die tierischen Monaden haben Bewusstsein, die
menschlichen Monaden können von ihren inneren Zuständen
deutliche Vorstellungen haben, ja sogar einzelne adäquate,
d. h. den wirklichen Zuständen entsprechende. Gott ist die
Urmonade und hat lauter adäquate Vorstellungen.
E. du Bois-Reymond sagt in seiner geistvollen Festrede über "Leibnizische Gedanken in der neueren Naturwissenschaft" (1870): "Da die Monaden als einfache Wesen nicht durch Zusammensetzung entstehen und nicht durch Auflösung vergehen können, schliesst Leibniz, dass Gott mit einem Schlag sie ins Dasein. gerufen habe, und dass auch er nur ebenso plötzlich sie vernichten könne Da sie weder eine Einwirkung von aussen erfahren, noch nach aussen wirken, oder, wie er in seiner lebhaften, bildlichen Art sich ausdrückt, da sie keine Fenster haben, durch die etwas in sie eindringen oder sie verlassen könnte, so schliesst er, dass in den Seelen-Monaden ein Fluss der Vorstellungen stattfinde, genau entsprechend den äusseren Umständen, in welche sie geraten. Wenn ich einen bellenden Hund sehe und höre und nach ihm schlage, dringen nicht etwa Botschaften von meinen Sinneswerkzeugen bis zum Sitze meines Bewusstseins und belehren mich, dass ein heilender Hund da sei und mich beissen wolle, und es wirken nicht etwa Willensimpulse meiner Seele auf Nerven und Muskeln, um Arm und Stock zu bewegen. Sondern als Gott meine Seelen-Monade schuf, schuf er sie so, dass in demselben Augenblicke, wo der Hund sich auf meiner Netzhaut abbildet und sein Gebell mein Labyrintwasser erschüttert, sie aus inneren Gründen im Fluss ihrer Vorstellungen auch gerade bei der Vorstellung eines bellenden Hundes anlangt, und dass sie sich vorstellt, mein Körper schlage den Hund, in demselben Augenblicke, wo er rein mechanisch es wirklich thut. Dies ist Leibniz' berühmte Lehre von der prästabilierten Harmonie, von der uns heute allerdings schwer fällt, uns zu denken, dass er sie alles Ernstes geglaubt habe, durch die er aber mit grösster Zuversicht das Rätsel der Verbindung von Körper und Geist gelöst zu haben meinte."
"In der That lässt Leibniz in der Monadenwelt keine andere Bestimmungen zu, als durch jene Endursachen,
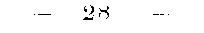 welche aus der Weltanschauung zu verbannen das Ziel
theoretischer Naturforschung ist."
welche aus der Weltanschauung zu verbannen das Ziel
theoretischer Naturforschung ist."
Wie beschaffen aber auch die Urbestandteile der lebenden Organismen gedacht werden mögen, wir wissen jetzt, dass aus reellen Teilen der Eltern die Kinder sich entwickeln. Wer Kinder hat, kann also nicht gänzlich sterben.
Die Fortpflanzung, diese geheimnisvolle schöpferische Kraft der belebten Natur gewährt schon auf der Erde eine wunderbar herrliche Auferstehung: nicht aus Asche, sondern aus edlem, hoch organisiertem Materiale.
Die haushälterische Mutter Natur sorgt zu bester Zeit für die Zukunft der Geschlechter. Die Geschöpfe verteilen ihre Erbschaft auf der Höhe ihres Lebens, in der Fülle ihrer Kraft. Viele Tiere sterben, sobald sie Eier gelegt und damit den Bestand der Art gesichert haben.
Und die Kinderlosen? Steht denen Dantes «Seconda morte» bevor? Sicherlich nicht, wenn sie irgend welche geistige Interessen haben.
Viel mächtiger, als die sehr beschränkte Uebertragung materieller Teilchen von Vorfahren auf Nachkommen ist die Mitteilung von Gedanken.
Noch sind für uns gedankliche und materielle Vorgänge incommensurabel, aber dass Sinneseindrücke nicht nur Vorstellungen und Bewegungen, sondern sogar unwillkürliche Drüsenabsonderung hervorrufen kann, weiss jeder, dem der Anblick des Elends oder auch schon die Erinnerung an ein trauriges Ereignis Thränen entlockt hat. Schwache Sinneserregungen können mächtige Muskelkräfte auflösen. Ein geistiger Anstoss kann genügen, um Millionen von Menschen neue Lebensrichtungen zu geben. Hierdurch kann die Unsterblichkeit einer bedeutenden Persönlichkeit ebenso gut gesichert werden, wie der Bestand niederer Tiere und Pflanzen, die nicht durch individuelle Stärke, sondern durch ihre Fruchtbarkeit sich erhalten. Wie glücklich ist der akademische Lehrer, welcher berufen ist, die Elite der Nation zu beeinflussen! Seinen Tod überdauern die besten Früchte seines Lebens.






