Form und Funktion
II BERICHT über das akademische Jahr 1933/34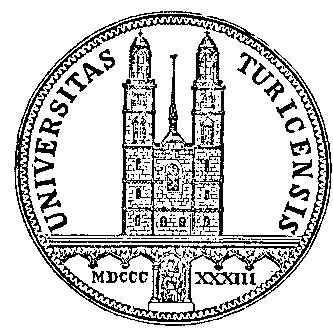
DRUCK ART. INSTITUT ORELL FÜSSLI, ZURICHINHALTSVERZEICHNIS Seite
I. Rektoratsrede 3
II. Behörden der Universität 26
III. Jahresbericht 28
a) Dozentenschaft 28
b) Allgemeines 31
c) Feierlichkeiten, Kongresse und Konferenzen . . . 34
d) Studierende 35
e) Promotionen und Prüfungen . 38
f) Preisaufgaben 39
g) Fonds und Stipendien 41
h) Kranken- und Unfallkasse der Universität . . . . 42
i) Darlehenskasse der Studentenschaft 44
k) Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren der Universität 44
l) Zürcher Hochschulverein 46
m) Stiftung für wissenschaftliche Forschung 48
n) Jubiläumsspende für die Universität 52
o) Julius Klaus-Stiftung 53
IV. Schenkungen und Vermächtnisse 57
V. Nekrologe 60
I. FESTREDE DES REKTORS PROF. Dr. H. v. MEYENBURG
gehalten an der 101. Feier des Dies academicus der Universität Zürich
|
Zürich darf das Recht für sich in Anspruch nehmen, als Geburtsstätte der funktionellen Anatomie zu gelten, jener Betrachtungsweise, die in der anatomischen Form der einzelnen Teile des menschlichen Körpers den gestalt-gewordenen Ausdruck ihrer Funktion erkennen will. In einer Sitzung der Zürcher naturforschenden Gesellschaft demonstrierte anno 1867 der damalige Anatom unserer Universität, Hermann v. Meyer, Präparate, an denen der innere Aufbau der Knochen von Fuss und Oberschenkel sichtbar wurde, die zierliche und zugleich gesetzmässige Anordnung der Knochenbälkchen, die heute jeder Medizinstudent im dritten Semester kennt. Der Begründer der graphischen Statik, Culmann, sah diese Demonstrationen mit an und errechnete rasch den Verlauf der Kraftlinien, die ein künstlich erstelltes Gebilde bei gleicher statischer Beanspruchung aufweisen müsste; und bald konnte er zeigen, dass diese Linien denselben Verlauf hatten, wie die Knochenbälkchen in den vorgezeigten Objekten. Die Lage der Bälkchen entspricht den sogenannten Spannungstrajektorien. — Diese Konvergenz der Ergebnisse von Beobachtung und Berechnung führte so zu der Erkenntnis, dass der menschliche Körper beim Aufbau der Knochenarchitekturen nach dem Prinzip der grösstmöglichen Materialersparnis verfährt, wie der rechnende Techniker bei seinen Konstruktionen. Seither gilt der Bau der Knochen als ein besonders klares, überzeugendes Beispiel funktioneller Strukturen in unserem Organismus, d. h. von Strukturen, deren Funktion man direkt aus ihrer Form ablesen kann.
Unser Landsmann Paul Ernst in Heidelberg, der an diese historischen Zusammenhänge erinnert, hielt uns vor wenigen
Jahren, hier in seiner Vaterstadt, einen fesselnden Vortrag, in dem er das hohe Lied sang von der Harmonie zwischen Gestalt und Leistung im Körper des Menschen. Und wenn wir das Problem etwas weiter, allgemeiner fassen, müssen wir dann nicht auch das Werk eines Zürchers aus früherer Zeit hier nennen, das rund 90 Jahre vor jenen Untersuchungen des Anatomen H. v. Meyer erschien, ich meine Joh. Casp. Lavaters Physiognomische Fragmente? Bezeichnet er selbst doch als Physiognomik "die Fertigkeit, durch das Äusserliche des Menschen sein Inneres zu erkennen; das, was nicht unmittelbar in die Sinne fällt, vermittelst irgend eines natürlichen Ausdruckes wahrzunehmen". Fassen wir das in etwas andere Worte, so will es besagen: Lavater versuchte in seiner Physiognomik, aus der äusseren Erscheinungsform des Menschen die Art seiner psychischen Funktionen zu erschliessen; auch er trieb gewissermassen funktionelle Anatomie. — Wir werden hören, dass andere darin glücklicher waren als er.
Darüber kann heute kein Zweifel mehr walten, dass zwischen Leistung und Gestalt eines Organes engste Wechselbeziehungen bestehen. Jeder Biologe kann hierfür Belege beibringen, und das Verhalten unseres Körpers — des kranken vielleicht fast noch mehr als des gesunden — liefert uns Anschauungsmaterial in Fülle. —So ist nicht nur der normale Knochen in seinem Aufbau der statischen Beanspruchung bestens angepasst; sondern unter pathologischen Verhältnissen gilt das in ähnlichem Masse: Wenn nach einem Beinbruch die Fragmente nicht wieder in die gehörige Lage kommen, sondern wenn sie gegeneinander abgeknickt zusammenheilen, dann wird die Knickung von mächtigen neuen Knochenmassen untermauert, der Skeletteil an dieser Stelle verstärkt, und in der so abgeänderten, neuen Form ist er wiederum den veränderten mechanischen Anforderungen bestens gewachsen. — Wird der geniessende Blick des Künstlers vom Ebenmass des gesunden Körpers entzückt, so kann das kritische Auge des konstruktiven Technikers auch durch den Anblick kranker Formen befriedigt werden.
Der Biologe aber fragt nach dem Wie? Er möchte das Geschehen, das Werden der Form erfassen, es von seinen Anfängen an verfolgen; und bei unserem Beispiel der Knochenfraktur stellt er da fest, dass die Natur folgendermassen vorgeht: zuerst werden grosse Mengen eines anfänglich weichen und formlosen Gewebes an die Stelle geschafft, das die Bruchenden zusammenheftet, gleich einer strukturlosen Kittmasse. Allmählich entsteht daraus Knochengewebe, zunächst im Überschuss und noch ohne regelrechte Ordnung. Ganz langsam wird dann das Überflüssige weggeräumt, bis nur noch die Knochenbälkchen übrig bleiben, die bei der neuen Stellung der Bruchenden die Träger der veränderten Belastung sind.
Wir lernen an diesem Beispiel etwas grundsätzlich Wichtiges über die Beziehung der Form zur Funktion: Die Funktion bestimmt die Gestaltung der neuen Knochenmasse, ihr kommt in dem verwickelten Geschehen die Führung zu.
Sogleich drängt sich aber nun die Frage auf: gilt diese Regel nur für pathologische Vorgänge oder auch für normale? Gilt sie insbesondere auch für die Entwicklung des Individuums? Hierauf hat der Begründer der Entwicklungsmechanik, W. Roux, die Antwort erteilt, man müsse zwei Phasen unterscheiden; eine erste, in der funktionelle Einflüsse sich noch nicht geltend machen können und in der einzig die Vererbungsgesetze die Entwicklung bestimmen, und eine zweite, in der die Aufnahme ihrer besonderen Leistungen der Organgestalt den Stempel aufprägt.
Wählen wir als weiteres Beispiel ein Organsystem, das gleichfalls im Wesentlichen mechanische Leistungen zu übernehmen hat, das System der Luftröhren. Seiner Aufgabe, den Lungen die Atmungsluft zuzuführen und die verbrauchte Luft wieder nach aussen zu leiten, erscheint es bestens angepasst. Ein zunächst einheitliches Rohr, das sich in zwei Teile für die beiden Lungen gabelt und sich in diesen immer weiter verästelt und verzweigt. Die Knorpelringe und -platten seiner Wandungen in Verbindung mit den elastischen und bindegewebigen Elementen halten die Lichtung offen; auch die Muskelfasern mit ihrer schrägen Anordnung in den feineren Ästen dienen diesem Zwecke.
Ihre Kontraktion vermag zwar bei verminderten Anforderungen das Rohr zu verengern, ein völliger Verschluss wird indessen verhütet (Braus). Das alles leuchtet als durchaus zweckmässig ein; wir verstehen aber auch ohne weiteres die Störung der luftführenden Funktion bei krankhaft veränderter Form, etwa die Atemnot im asthmatischen Anfalle, wenn übermässige krampfhafte Zusammenziehungen dieser Muskeln das Rohr hochgradig einengen, das zudem noch durch ein pathologisches Sekret verlegt wird. —
In ähnlicher Weise zweckdienlich mutet der Bau der muskulären Herzwand an; nicht nur die tourenförmig gelegten Muskelbänder, die sich zu einem kontraktilen Sack schliessen, der das Blut weiter treibt, sondern auch die feinere Struktur: Im Herzmuskel sind die einzelnen parallel gelegenen Muskelfasern durch zahlreiche Verbindungsbrücken an einander befestigt. Durch diese netzartige Anordnung wird verhindert, dass der seitliche Schub des Blutdruckes von innen auf die Herzwand das Gefüge des Muskels lockert. Dem Skelettmuskel mit seiner anders gearteten Beanspruchung mangeln derartige seitliche Brücken fast gänzlich. So lässt sich schon aus dem verschiedenen mikroskopischen Bau der beiden Muskelarten ihre unterschiedliche Aufgabe erschliessen; Form und Funktion erscheinen in völliger Harmonie. Um hier gleich noch einen Beleg aus der Pathologie des Herzmuskels anzufügen: Erkrankung seiner Fasern, gleichviel welcher Natur, lässt sie erschlaffen, der Druck der Blutmasse im Herzinneren vermag sie zu dehnen oder gar zu zerreissen. Die Folge ist Ausweitung des Herzens, die Dilatation; die Austreibung des Blutes wird ungenügend, der ganze Kreislauf gerät in Not.
Die wenigen Fälle einfachster Art, die gewählt wurden und die sich leicht um Dutzende vermehren liessen, geben zu erkennen, nicht nur wie der Bau der Organe ihrer Tätigkeit angepasst ist, wie Form und Funktion in Übereinstimmung stehen, sondern auch, wie Änderung der Gestaltung Störungen der Tätigkeit nach sich zieht, Störungen, deren Art sich aus der veränderten Struktur zwanglos erklären. Umgekehrt wie beim Knochenbruch
hat aber hier die Morphologie der Organe die Priorität, nicht ihre Tätigkeit. —Die Beziehungen zwischen Form und Funktion sind also vielfältige.
Etwas anderes noch soll uns die Knochenpathologie lehren: Eine ziemlich seltene Skeletterkrankung, die Ostitis deformans, führt zu einer langsam fortschreitenden Umgestaltung des Knochengerüstes. Die äussere Form bleibt zunächst noch einigermassen gewahrt, aber der feine Bau erfährt eigenartige Umwandlungen: die Knochensubstanz erleidet Einbusse an Menge und Güte, und neue Massen, gleichfalls qualitativ minderwertig, dafür aber in um so grösserer Quantität werden herangeschafft und in die Fugen und Lücken eingebaut. Auf diese Weise vermag der betroffene Skeletteil seiner mechanischen Aufgabe noch längere Zeit zu genügen. Also: "Es geht auch anders." Die Funktion ist nicht notwendig an eine ganz bestimmte und sich immer gleichbleibende Form gebunden; sie kann auch bei abgeänderter Gestalt erhalten bleiben. Das ist einer der Sicherheitsfaktoren, mit denen der Organismus arbeitet, und die wir als Ärzte begrüssen müssen. Die vielgerühmte Harmonie aber zwischen Form und Funktion ist gestört. — Schon Metschnikoff hat zahlreiche Belege für solche Disharmonien zusammengetragen, auch aus dem Gebiete des Normalen, um dann aber doch in seinen "Studien über die Natur des Menschen" zu einer optimistischen Auffassung zu gelangen. —
Es ist nun gewiss kein Zufall, dass bei allen bisher angeführten Beispielen gerade nur mechanische Leistungen der Organe in Frage standen. Bei ihnen sind die Verhältnisse leicht zu überblicken, die Zusammenhänge erscheinen daher einleuchtend. Sobald wir nun aber Organe mit anderen Funktionen ins Auge fassen, chemischen, physikalisch-chemischen und physikalischen der verschiedensten Art, alles das, was man etwa mit "Betriebsfunktionen" bezeichnet, dann gelingt es sehr viel schwerer, die Zusammengehörigkeit von Bau und Aufgabe zu erkennen. Ja, die Behauptung geht kaum zu weit, dass es hier nur in den seltensten Fällen möglich ist, aus der Morphologie die besonderen Lebensäusserungen abzulesen. Das gilt nicht nur für die grobe
äussere Gestaltung, sondern auch für die feinen und feinsten mikroskopischen Strukturen.
Schon die Beurteilung der rein quantitativen Verhältnisse birgt überraschende Schwierigkeiten. Gemeinhin erwartet man wohl, mit zunehmender Masse steige auch die Leistungsfähigkeit eines Organes, und der Anblick der schwellenden Muskeln eines Schwergewichtsringers mag uns in dieser Meinung bestärken. Gewiss bringt der Muskel des trainierten Sportsmannes mehr fertig als der des gelehrten Stubenhockers. Indessen sind die Beziehungen von Masse zu Arbeitsleistung bei näherer Prüfung doch recht verwickelt, sie lassen sich durchaus nicht immer in einfachem Zahlenverhältnis ausdrücken, ja oft genug entziehen sie sich überhaupt der Erfassung. Hierzu nur wenige Beispiele:
Bekanntlich führt die operative Entfernung einer Niere in der Regel zu keinen Störungen. Das zurückgelassene paarige Organ übernimmt die Leistungen beider. Kommt nach Jahr und Tag der pathologische Anatom bei einem solchen Fall in die Lage, Organgewicht und -grösse zu bestimmen, so stellt er fest, dass sie bei der zurückgelassenen Niere überwertig sind. Die Belastung mit der doppelten Aufgabe hat zur Vergrösserung, zur Hypertrophie geführt. Wiederum erscheinen Form und Funktion in bester Harmonie. Aber betrachten wir den Fall etwas kritischer! Ist wirklich die Leistung der vergrösserten Niere besser als die der normalen? Streng genommen wissen wir es doch nicht; denn das zurückgelassene Organ hat ja die Tätigkeit des entfernten Paarlings übernommen bereits vom Augenblicke der Operation an, und in jenem Augenblicke war es noch nicht vergrössert! (Tendeloo.) —Man könnte das Gegenbeispiel der krankhaft verkleinerten sog. Schrumpfniere anführen, die grössere Harnmengen liefert als die gesunde; doch lässt sich hier einwenden, dass die Harnmenge nicht das richtige Mass abgebe für die Betätigung des Ausscheidungsorganes, weil auch die Qualität des Sekretes in Rechnung zu stellen sei, die bei der Schrumpfniere gelitten hat. Der Einwand mag gelten.
Aber denken wir etwa an das Gehirn. Wenn gelegentlich besondere Kleinheit des Hirnes mit Geisteskrankheit zusammengeht,
so stehen dem gegenüber die hohen Hirngewichte, die man bei manchen bedeutenden Männern bestimmt hat — Byron, Cromwell, Turgenijeff. Ich weiss nicht, bei wieviel hervorragenden Leuten das Hirngewicht nur ein durchschnittliches war — das wird gewöhnlich nicht veröffentlicht —; jedenfalls aber verlangt die Ehrlichkeit, dass man auch eingestehe: das weitaus schwerste Denkwerkzeug, das je gewogen wurde, stammte — von einem Idioten!
Sie sehen, das Problem ist nicht so einfach, dass man es in ein paar Formeln einfangen könnte. Wer sich, wie etwa Rössle, jahrelang um die Erfassung dieser Beziehungen bemüht hat, urteilt mit grosser Vorsicht.
Wenn aber die Beziehungen zwischen Organgrösse und Leistungsmass so lockere sind, dann kann es kaum mehr überraschen, dass auch die äussere Gestaltung auf die Betätigung oft gar keinen Einfluss gewinnt. Jeder erfahrene Obduzent kennt die ausserordentlich grosse morphologische Variationsbreite beispielsweise der Leber. Systematische Untersuchungen, die ich während mehrerer Jahre gerade über dieses Gebiet durchgeführt habe, lehrten mich aber, dass in keiner Weise Zusammenhänge bestehen können, etwa in der Art, dass eine bestimmte Erscheinungsform regelmässig oder auch nur mit besonderer Häufigkeit zusammentreffen würde mit bestimmten Lebensäusserungen oder Funktionsstörungen der Leber. Ja, es können ganz schwere formale Missbildungen dieses Organes bestehen, ohne dass während des Lebens auch nur die geringste Störung bemerkbar gewesen wäre. Man ist geradezu versucht zu sagen: Dass das Organ nun gerade diese und keine andere Form aufweist, hänge von blossen Zufälligkeiten ab, oder doch von rein äusserlichen Dingen, die mit der Funktion gar nichts zu tun haben. — Stärkeren Eindruck noch macht es, wenn uns an einem Organ wie dem Gehirn mit seiner vielfältigen und so ungeheuer differenzierten Funktion Ähnliches begegnet. In unserem Institut wird ein Gehirn aufbewahrt, an dessen Oberfläche eine Geschwulst der Hirnhaut eine Delle, einen Eindruck, hinterlassen hatte, in dem ein Hühnerei Platz finden würde. Aber weder den Angehörigen
noch den Ärzten, die den Patienten längere Zeit in Beobachtung hatten, war je auch nur die leiseste Beeinträchtigung der psychischen Fähigkeiten oder anderer Hirnfunktionen aufgefallen. Dies nur ein Beispiel anstatt vieler.
Nun liegt hier der Einwand nahe, dass bei den angeführten Fällen eine Leistungsminderung deshalb fehlte, weil bei aller Abweichung der äusseren Gestalt das feine Gefüge der Gewebe unberührt geblieben sei; auf dieses aber komme es an, nicht auf die grobe Form. Dieser Einwurf weicht zwar unserem Probleme etwas aus, doch will ich ihm eine gewisse Berechtigung nicht absprechen. Es lässt sich aber unschwer zeigen, dass auch auf diesem Feld von einer völligen Harmonie zwischen Struktur und Tätigkeit nicht die Rede sein kann. Ich denke dabei an die Fälle, wo eine Lungenentzündung bei der Sektion aufgedeckt wird, die während des Lebens unbemerkt blieb, oder eine schwere Leberzirrhose, trotzdem nicht nur nichts auf eine Funktionsstörung dieses Organes hingewiesen hatte, sondern sogar eine sorgfältig durchgeführte Funktionsprüfung durchaus normale Leistung aufgedeckt hatte; wie auch das umgekehrte Verhalten gelegentlich vorkommt: Beeinträchtigte Tätigkeit bei unversehrter Struktur. —Die Durchuntersuchung von grossen Reihen, die ich seinerzeit an der Bauchspeicheldrüse vorgenommen hatte mit spezieller Hinsicht auf ihr Verhalten bei der Zuckerkrankheit, haben mir Ähnliches gezeigt. Ich musste zur Überzeugung kommen, dass es unmöglich ist, aus dem anatomischen und mikroskopischen Bilde dieses Organes mit einiger Sicherheit auf seine Leistung während des Lebens zu schliessen, und etwa auszusagen, ob Zuckerkrankheit bestanden hatte oder nicht. — Dieses Beispiel von offenkundiger Disharmonie zwischen Form und Funktion führe ich hier noch besonders an, weil gerade die zuckerregulierende Funktion des Pankreas im Leben verhältnismässig einfach und sicher zu erfassen ist, was für die Leber nicht in gleichem Masse gelten kann.
Wir streifen damit das heikle Gebiet der sogenannten Fehldiagnosen des Arztes. Ich bin der Überzeugung, dass manche von ihnen in den eben erwähnten Verhältnissen ihre tiefere
Ursache haben. Freilich möchte ich mit dieser Bemerkung die hier anwesenden Medizinstudenten nicht zum unbekümmerten Frisch-drauf-los-diagnostizieren ermuntern. —
Wir müssen aber noch einen Schritt weiter gehen und fragen, wie weit an den einzelnen Bausteinen unserer Organe und Gewebe, also an den Zellen usw. Übereinstimmung von Form und Leistung zu erweisen ist oder nicht. Diese Frage ist für den Pathologen um so bedeutungsvoller, als ja unser Alt-Meister Rud. Virchow das stolze Gebäude seiner Zellularpathologie eben auf die Überzeugung gründete, dass der menschliche Körper ein Zellenstaat sei, und dass die Zellen als letzte Lebenseinheiten und Träger der Lebensäusserungen zugleich auch die Träger des krankhaften Geschehens, dass sie die ,,sedes morborum", der eigentliche Sitz der Krankheit seien. Und wenn auch diese Lehre in der Folge sich manche Abwandlung gefallen lassen musste, durch Ausbau einerseits, Einschränkung andererseits, so war sie doch in ihren Grundfesten unerschüttert.
Wenn wir also unserem Problem an den einzelnen Bausteinen des Körpers nachgehen, dann finden wir wieder, dass rein mechanische Leistungen ohne Schwierigkeiten abzulesen sind. Ihre Träger, die Fasern und Fasergeflechte usw., haben ja im menschlichen Körper die gleichen Aufgaben zu übernehmen, die uns auch aus Handwerk und Technik geläufig sind; sie tragen, verbinden, halten zusammen, trennen und isolieren aber auch etwa. (Die Fortleitung von Erregungen freilich ist ihnen so wenig anzusehen wie elektrischen Leitungsdrähten.) — Ganz anders bei den Zellen selbst, deren Aufgaben unendlich viel komplizierter sind. Hier ist es fast nie möglich, aus ihrer Gestalt die Funktion zu erkennen; seltene Ausnahmen — ich denke etwa an die Becherzelle — bestätigen nur die Regel. Zellen, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen, dienen ganz verschiedenen Zwecken, wie etwa die Drüsenzellen von Pankreas und Leber. Ich erinnere auch an das von Görttler zitierte Beispiel der glatten Muskelzellen, die bei völlig gleichem Bau in den verschiedenen Organen doch auf ganz ungleiche hormonale Reize abgestimmt sind. Mir scheint, dass auch all' das Wissen, was über den feineren
Bau der einzelnen Zellen und über ihre Einschlüsse zusammengetragen wurde, über die Granula, die Plastosomen, die Mitochondrien usw. uns in dieser Beziehung nicht sehr viel weiter gebracht hat; das Verdienst der Männer, die sich darum bemüht haben, soll dadurch nicht geschmälert werden. —Aus der Pathologie der Zellen liessen sich Beispiele in Menge anführen. Um nur eines herauszugreifen: Es ist immer wieder überraschend, zu sehen, wie auch bei schwersten morphologischen Veränderungen aller Parenchymzellen eines Organes seine Funktion so wenig gemindert war, dass im Leben gar nichts davon in Erscheinung trat und dass erst die Obduktion den Schaden aufdeckt. Mängel der Methodik, der morphologischen wie der funktionellen, tragen gewiss einen Teil der Schuld an diesen Unstimmigkeiten.
Die Lehre von den "Degenerationen" im Sinne der klassischen pathologischen Anatomie hatte hierauf allzu wenig Rücksicht genommen; allzu rasch war sie bereit, rein morphologische Abweichungen an den Zellen mit dem Werturteil "degenerativ" zu belegen, ohne Rücksicht auf die Leistung. Sie bedarf deshalb der Revision. Lehrt uns doch auch die einfache Beobachtung unserer Umwelt, dass der Besitzer eines ,,degenerativen"Zuges durchaus nicht minderwertig zu sein braucht. Die Galerien bedeutender Köpfe aus allen Zeiten liefern uns genügend Gegenbeweise. "Mens sana in corpore sano", dieser Satz, den unsere sportbegeisterte Zeit so sehr liebt, wird immer nur ein Wunsch bleiben. —
Was ich eben sagte über die besonderen Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Zusammenhanges von Form und Leistung der Zellen, führt nun aber zu einer Schlussfolgerung, die auf den ersten Blick überraschen mag. Ich wenigstens sehe darin eine Bestätigung der Zellenlehre und der Zellularpathologie. Oder ist es nicht so, dass die inneren Beziehungen gerade hier so ungemein schwer zu erfassen sind, weil die Zellen die vornehmsten Träger des Lebens sind, dessen letzte Rätsel uns immer verschlossen bleiben?
Unser Wissen auf diesem Gebiete ist im wesentlichen empirischer Natur. Es ist etwa so, wie wenn Sie Ihren Kindern zu
Ostern ein grosses, buntes Ei schenken; das Jüngste hat seine Freude an dem schönen bunten Ding; die ältere Schwester ist nicht mehr so naiv; aus der Erfahrung früherer Jahre weiss sie, dass man das Ei öffnen kann und dass es allerhand Süssigkeiten enthält, dass es die Funktion einer Bonbonnière übernommen hat, so, wie es eine Schachtel von beliebiger anderer Form auch tun könnte. Der älteste Bruder aber, als Gymnasiast bereits Skeptiker, belehrt herablassend seine Geschwister, dass er dem Ei eine Kugel vorgezogen hätte, weil diese ihre Funktion noch besser erfüllt hätte: bei gleicher Grösse hätte sie nämlich für noch mehr Süssigkeiten Platz geboten. — Man darf meines Erachtens bei der Anwendung dieses Vergleiches recht weit gehen. Nur aus Erfahrung wissen wir, dass im menschlichen Körper gewisse Lebensäusserungen an bestimmte Formen gebunden zu sein pflegen. Aber dass es gerade so ist, erscheint doch bei kritischer Betrachtung oft nicht viel anders als ein schöner Osterbrauch. Von recht zahlreichen Betätigungen darf man wohl die Behauptung wagen, dass sie von Organen, Geweben oder Zellen anderer Struktur auch übernommen werden könnten, in gleicher Weise wie von den Gebilden, die für gewöhnlich damit betraut sind, — möglicherweise sogar noch besser; wie auch umgekehrt formal gleich beschaffene Dinge verschiedene Funktionen auszuüben vermögen.
Schlagende Beispiele beider Arten liefert uns namentlich auch das grosse Gebiet der Geschwülste, speziell jener der Drüsen mit innerer Sekretion. Wie gleiche Funktion von Geweben ungleicher Struktur ausgeübt werden kann, dafür sei als Beleg eine berühmt gewordene Beobachtung des Wiener Chirurgen v. Eiselsberg herausgegriffen: Eiselsberg entfernte bei einem Patienten einen Kropf, der sich bei der Operation als krebsig erwies; radikales Vorgehen war daher angezeigt. Es stellten sich nun bei dem Patienten bald die Ausfallserscheinungen ein, die als Folgen allzu ausgiebiger Entfernung des Schilddrüsengewebes in früheren Jahren gelegentlich beobachtet wurden. Nach einiger Zeit jedoch verschwanden diese Ausfallserscheinungen bei dem Manne von selbst wieder, und es stellte sich heraus, dass inzwischen
in einer anderen Körpergegend sich. eine Metastase, ein Ableger des Krebses, entwickelt hatte. Diese Metastase hatte die Funktion des mangelnden Schilddrüsengewebes übernommen, trotzdem ihre mikroskopische Struktur natürlich eine andere war. — Umgekehrt kann in Geschwülsten ein wohldifferenziertes Gewebe zur Untätigkeit verdammt sein, obschon es nach seiner Art zu ganz bestimmten Leistungen berufen erscheint; ich denke hierbei namentlich an Drüsen- und Muskelgewächse. — Man kann gegen die Beweiskraft solcher Beispiele einwenden, dieses Sinn- und Zwecklose, dieses Sich-nicht-einfügen in den anatomisch-physiologischen Bauplan des Organismus sei eben ein besonderes Kennzeichen gerade der Geschwülste, und man dürfe sie deshalb nicht zur Argumentation heranziehen. Wir brauchen an dieser Stelle nicht darüber zu rechten, ob der Einwand stichhaltig sei, sind wir doch um Anschauungsmaterial aus anderen Gebieten der Pathologie nicht verlegen.
Wir sprachen schon wiederholt vom Knochen und seiner Stützfunktion und führten selbst das Skelett als Beispiel besonders schöner Übereinstimmung an. Was sollen wir aber dazu sagen, wenn wir Knochen auftreten sehen an Orten, wo solche mechanische Beanspruchung gar nicht in Frage kommen kann, in Lymphdrüsen, in der Wand von Blutgefässen, am Wurmfortsatz, in abgestorbenen Geweben der verschiedensten Art oder gar in Krebsen? In das rein formale Geschehen bei der Entstehung solcher abwegigen Gewebe haben wir einigen Einblick, aber für das kausale Geschehen funktionelle Momente verantwortlich zu machen, das hiesse den Tatsachen Gewalt antun. —
Ich will indessen nicht weiter Einzelbeispiele häufen, sondern versuchen, unserem Problem noch. auf zwei grossen Gebieten der allgemeinen Pathologie nachzugehen, auf dem Gebiete der Entzündungslehre und verwandter Fragen einerseits, auf dem der Konstitutionslehre andererseits.
Der Entzündungsprozess, der im Gesamtbilde so ausserordentlich zahlreicher Krankheiten eine hervorragende Stellung einnimmt, ist in seinen klinischen wie anatomischen Erscheinungsformen bis zu den feinsten Einzelheiten seit längerer Zeit
genauestens bekannt; die letzten Jahrzehnte haben zu dem bisherigen Wissen noch einige nähere Kenntnisse über die chemischen und physikalisch-chemischen Vorgänge hinzugefügt. Die Ergebnisse dieser verschiedenen Forschungsmethoden stimmen soweit überein, dass sie eine einheitliche Auffassung des Entzündungsprozesses zulassen. Man darf ihn betrachten als eine krankhaft gesteigerte Funktion der Mesodermabkömmlinge, die geeignet erscheint, der schädigenden Wirkung von Fremdstoffen entgegenzutreten und sie auszugleichen. Damit wird der Entzündung der Charakter einer Abwehrreaktion zuerkannt, und man darf eingestehen, dass diese Abwehr in der Regel recht zweckmässig arbeitet. Jedermann weiss auch, dass unter den entzündungserregenden Schädlichkeiten die Infektion mit Mikroorganismen eine besonders wichtige Rolle spielt.
Wir wollen zunächst nur diese infektiöse Entzündung ins Auge fassen. —Nachdem einmal die Bakterien entdeckt waren, gelang es Metschnikoff verhältnismässig leicht, durch die morphologische Analyse des Entzündungsvorganges den Nachweis zu führen, dass ganz bestimmten Elementen, nämlich den Leukozyten des Blutes, die in grosser Zahl in das entzündete Gewebe übertreten, bei der Abwehr der Infektion eine spezielle Rolle zufällt, die Aufgabe nämlich, Bakterien in sich aufzunehmen, sie unschädlich zu machen, zu vernichten. Zu dieser Aufgabe erscheinen sie besonders geeignet infolge ihrer Fähigkeit, Form und Ort verhältnismässig rasch zu wechseln. Die Bedeutung dieser grundlegenden Feststellung Metschnikoffs wird auch nicht beeinträchtigt durch die Tatsache, dass andere Zellarten ähnliche Fähigkeiten besitzen. — Die Tatsache, dass die Leukozyten sich daneben noch anderweitig betätigen können, vermittelt uns weiterhin das Verständnis für ihr Auftreten in gleich grosser Menge bei Entzündungen, die ohne Mitwirkung von Bakterien zustande kommen, wo also die Fresstätigkeit dieser Zellen sich gar nicht auswirken kann, weil kein Objekt dafür zur Verfügung steht.
Diese Vorbemerkungen führen uns zu etwas anderem: Seit einer Reihe von Jahren haben die allergischen Phänomene das besondere Interesse der morphologischen Forschung gefunden,
nachdem sie lange Zeit fast ausschliesslich den Serologen reserviert schienen. Insbesondere haben sich Rössle und seine Schule in hervorragendem Masse um die gewebliche Analyse der sog. hyperergischen Entzündung verdient gemacht. Sie ist in mehrfacher Hinsicht für uns bemerkenswert. Das Wesentliche dabei ist folgendes: Spritzt man, nach dem klassischen Vorgehen der Versuche von Arthus, einem normalen Versuchstier artfremdes Eiweiss, z. B. das Serum einer anderen Tierart, unter die Haut, dann entsteht an der Injektionsstelle eine geringe, bald abklingende Entzündung, die keinerlei Besonderheiten aufweist. Wiederholt man aber den Versuch bei einem Tier, das zuvor in geeigneter Weise mit dem gleichen Serum vorbehandelt war, so tritt das Bild der sogenannten hyperergischen Entzündung in Erscheinung, d. h. einer Entzündung von eigenartig stürmischem Verlauf, die zum Absterben der Haut führt. Bei der mikroskopischen Untersuchung stellen wir fest, dass zwar die gleichen Entzündungszellen auftreten wie sonst, dass sich aber das Gesamtbild doch durch einige besondere Züge auszeichnet. Ohne auf die Einzelheiten eingehen zu wollen, sei festgehalten, dass das eingespritzte Serum durch Zufuhr grosser Flüssigkeitsmengen verdünnt und durch Abriegelung des Kreislaufes am weiteren Eindringen in den Körper verhindert wird. Das alles, ebenso wie die schliessliche Abstossung des ganzen Entzündungsherdes erscheint zweckmässig, —wenn man einmal die Berechtigung finaler Betrachtungsweise in der Biologie zugestehen will.
Die hyperergische Entzündung ist aber nur ein für die morphologische Analyse verhältnismässig leicht zugänglicher Spezialfall aus dem grossen Erscheinungskreis der allergischen Reaktionen; ihnen allen ist folgendes gemeinsam: Durch den ersten Kontakt mit einem bestimmten Stoff, fast stets von Eiweissnatur, wurde der Körper überempfindlich gemacht und abgeändert in seiner Reaktionsweise gegenüber einer nachfolgenden Berührung mit dem gleichen Stoff, der nun ähnlich wie ein Gift wirkt. Die Überempfindlichkeit kann sich dabei, je nach den besondern Verhältnissen an den verschiedensten Organen und Geweben und auf ganz verschiedene Weise äussern: am Bindegewebs-Gefässapparat
in Gestalt der hyperergischen Entzündung, an den glatten Muskeln in Gestalt krampfartiger Kontraktionen im anaphylaktischen Shock, an der Haut in Gestalt verschiedenartiger Ausschläge usw. Diese letztere Tatsache erklärt, dass gerade die Dermatologie allergische Erscheinungen beim Menschen besonders oft studieren kann. Und ich möchte hier namentlich an die hervorragenden Verdienste erinnern, die sich unser verstorbener Kollege Bloch mit seiner Schule auf diesem Gebiete erworben hat.
Nur kurz anführen möchte ich das bekannte Gegenbeispiel, die Herabsetzung der Empfindlichkeit durch die Immunisierung mittels prophylaktischer Impfungen. Jeder von uns hat es ja am eigenen Leibe beobachten können, wie die Pockenimpfung als sichtbare Spuren nur die geringen Hautnarben hinterlassen hat, während doch der ganze Körper in seinen Lebensäusserungen so umgestimmt wurde, dass er für die Pockeninfektion nicht mehr empfänglich ist. — Das ist aber das Gemeinsame aller dieser Immunitäts- und Allergie-Phänomene und zugleich der springende Punkt für unsere Betrachtung: die tiefgreifende Umstellung der Reaktionsart, der Funktion; und demgegenüber die Tatsache, dass an der Form nichts verändert ist. Man kann es einem Menschen nicht ansehen, und auch die minutiöseste Durchmusterung seiner Gewebe und Zellen lässt uns nicht erkennen, ob er etwa gegen eine bestimmte Infektion immun ist, oder ob er gegen irgend einen Stoff allergisch ist.
Tritt uns somit hier wieder eine Diskrepanz zwischen Form und Funktion entgegen, so interessiert auch noch ein weiterer Punkt bei diesen Überempfindlichkeitserscheinungen: sie imponieren uns vielfach als gänzlich zwecklos, ja widersinnig. Oft genug lässt sich in keiner Weise einsehen, dass die Reaktion auf die Erhaltung der Gesundheit des Ganzen oder auch nur einzelner Teile gerichtet sei, wie es sonst die pathologischen Reaktionen zu sein pflegen. Dies gilt besonders auch für manche allergische Phänomene im Verlaufe von Infektionskrankheiten. Und wir verstehen es, dass auf Grund solcher Erfahrungen Miescher kürzlich die Meinung vertreten konnte, die Überempfindlichkeits-Erscheinungen
der Haut, z. B. die Tuberkulide, brauchten mit der Vernichtung der betreffenden Infektionserreger gar nichts zu tun zu haben; beide Dinge könnten voneinander gänzlich unabhängige Parallel-Erscheinungen sein.
So führt also auch die Erfahrung des Klinikers in Verbindung mit der experimentellen Pathologie zu der Vorstellung, dass Vorgänge, die sich am anatomischen Substrat in sichtbarer Form abspielen, nicht notwendig einer bestimmten Verrichtung dienen müssen, trotzdem unter anderen Umständen mit der gleichen Formveränderung ganz spezielle, leicht erfassbare Funktionen verbunden sind. Wenn aber in der geschilderten Weise die örtlichen Vorgänge durch Änderungen des Allgemeinzustandes beeinflusst werden, so darf diese Tatsache wohl den Gedanken an das Wirken eines übergeordneten Prinzips aufkommen lassen, in dessen Art und Wesen uns jedoch noch gar kein Einblick gewährt ist.
Zu ähnlichen Schlussfolgerungen muss man meines Erachtens gelangen, wenn man die Beziehungen von Form und Funktion auf dem Gebiete der Konstitutionslehre kritisch betrachtet.
Lavaters Physiognomik, nach seinen eigenen Worten eine Wissenschaft, die so gut Physik als Arzneikunst und Theologie war und auch den schönen Wissenschaften zugehörte — also eine Universitas litterarum, in der nur die juristische Fakultät fehlte — diese Physiognomik war eine Vorläuferin der Konstitutionslehre. Sie erweckte ein zunächst zwar starkes aber um so rascher verhallendes Echo; denn das, als was sie Lavater bezeichnete, eine Wissenschaft, gerade das war sie nicht und, konnte sie nicht sein, weil sie ganz aufgebaut war auf der rein intuitiven Erfassung der Gesichtsform, ohne greifbare, feste Unterlagen. In dieser Intuition mochte Lavater ein Meister sein, durch sie auch manches richtig sehen. Indessen da, wo er sich wissenschaftlich gebärdet, wirkt er auf uns etwas lächerlich. Sank daher Lavaters Werk bald in die Vergessenheit, — das Grundproblem, aus der körperlichen Erscheinung auf das Geistige schliessen zu können, blieb bestehen. Und als es, knapp 150 Jahre später, der Psychiater Kretschmer erneut und nun mit der
exakten Methode anthropometrischer Messungen anpackte, da konnte er es in ungeahnter Weise fördern. In seinen Studien über "Körperbau und Charakter"gelang es ihm, zu zeigen, wie bei bestimmten Geisteskrankheiten gewisse charakteristische körperliche Erscheinungsformen, Konstitutionstypen, in besonderer Häufung vorkommen, bei anderen Geisteskrankheiten wiederum andere Typen. Über das Gebiet der Psychiatrie hinaus geht dann die Feststellung ähnlicher Parallelen zwischen Körperbau einerseits, Charakter und Temperament andererseits.
Auch hier liegt wiederum der Nachdruck auf dem Wort "Parallelen". Zwar deutet Kretschmer den Gedanken an, dass beide Erscheinungsreihen, die somatische und die psychische, auf gemeinsamer Ursache endokriner Natur beruhen könnten. Vor weitergehenden Schlussfolgerungen hat er sich indessen gehütet. Innere Beziehungen zu suchen, etwa in der Art, dass die Körperform die psychischen Besonderheiten verursache oder umgekehrt, — das wäre wohl im Sinne Lavaters gewesen; aber der Gedanke wäre damit auch sofort ad absurdum geführt. Und wenn Grote in diesem Zusammenhang das Schillerwort zitiert: "Es ist der Geist, der sich den Körper baut", dann dürfte er entweder Kretschmer missverstanden haben —oder Schiller.
Eher scheint es berechtigt, der Frage nachzugehen, ob nicht bei somatischen Erkrankungen ein Einfluss der Körperform, des Habitus, auf die Krankheit, auf ihre Entstehung, ihren Verlauf, ihren Ausgang nachweisbar sei. Das Problem, von der modernen Medizin seit etwa 20 Jahren wieder mit grosser Lebhaftigkeit aufgegriffen, ist schon uralt; geht doch die Bezeichnung "Habitus phthisicus" auf Hippokrates zurück. Mit ihr war in zwei Worten die ärztliche Erfahrung ausgedrückt, dass ein bestimmter Körperbautypus, nämlich der Schmalbrüstige mit den weit auseinander liegenden Rippen, dem spitzen epigastrischen Winkel usw., in besonderem Masse zur Lungenphthise disponiert sei. — Dieses Beispiel darf uns einen Augenblick beschäftigen, weil es ja von vornherein dazu verlocken muss, gerade hierbei zwischen der äusseren Gestalt und der speziellen Erkrankung engere, ursächliche Beziehungen zu suchen. Man
hat sie gesucht, und zwar auf den verschiedensten Wegen. Einen davon, der besonders vielversprechend schien, möchte ich kurz anführen.
Durch näheres Studium waren im Bilde des Habitus phthisicus einige neue Züge entdeckt worden. So hatten Freund und Hart zeigen können, dass bei diesem Habitus der oberste Rippenring besonders eng sei und auf die darunter liegende Lungenspitze drücke. Da nun die Lungenphthise mit einer gewissen Vorliebe gerade in der Spitze beginnt, schien der Zusammenhang recht einfach und klar: die eingeschnürte Lungenspitze, sagte man, wird schlechter durchblutet, wohl auch ungenügend durchlüftet, und dem Haften der Tuberkelbazillen wird so Vorschub geleistet. Diese Hypothese schien zunächst auch noch in experimentellen Untersuchungen von Bacmeister eine Stütze zu finden; aber sie liess sich schliesslich doch nicht halten; allzu viele Tatsachen der Klinik, des Experimentes und der pathologischen Anatomie sprachen gegen sie. Und noch etwas: heute ist das Bild des Habitus phthisicus durch eine Reihe weiterer, neuer Züge und Merkmale bereichert, die freie zehnte Rippe, Formbesonderheiten verschiedener innerer Organe und dergleichen mehr. Sollte das alles mit der Veranlagung zur Lungenschwindsucht in irgend welcher ursächlichen Beziehung stehen? Der Gedanke ist unmöglich! Was für den Habitus phthisicus gilt, gilt aber natürlich auch für andere Konstitutionstypen. Auch hier werden wir uns eben mit der Feststellung bescheiden müssen, dass eine gegebene Konstitution mit der ihr eigentümlichen Körpergestalt zwar zu dieser oder jener Krankheit disponiert, dass uns aber der Einblick in die inneren Beziehungen verwehrt ist. Die Körperform und ihre Einzelerscheinungen dürfen nicht mehr Bedeutung beanspruchen als die von Merkmalen; ihr Nutzen für die praktische Heilkunde kann trotzdem erheblich sein.
Aus diesem Grunde kann aber auch die klinische Medizin auf die Erkennung und Erforschung der Konstitutionen und ihrer Besonderheiten nicht verzichten. Dafür mag das Zeugnis Naegelis gelten: Naegeli tritt zwar mit grösstem Nachdruck für die Variabilität der Erreger als Ursache der verschiedenen Verlaufsart
anscheinend wohl charakterisierter und einheitlicher Infektionskrankheiten ein; auf der anderen Seite aber anerkennt er hierfür auch die Bedeutung der Konstitution und fügt ausdrücklich hinzu, dass im allgemeinen die besondere Verlaufsform einer Krankheit wohl am häufigsten gerade durch die Konstitution des Patienten bedingt sei.
Über Eines müssen wir uns hierbei freilich klar werden: Wenn die Erfassung der Konstitutionen mit der anatomischen Methode bisher keine voll befriedigenden Resultate gezeitigt hat, so hat das seinen tieferen Grund in der Tatsache, dass die Konstitutionsforschung ja in letzter Linie immer das Einmalige, Besondere, das Individuelle zu erfassen sucht. Ob es aber je gelingen wird, dem Einmaligen mit Gewicht und Mass beizukommen, ist höchst zweifelhaft; das Individuelle wird sich nicht in Zahlen einfangen lassen — und das ist wohl gut so.
M. D. u. H.! Die kritische Einstellung zu dem uns hier beschäftigenden Problem mag überraschen im Munde des Pathologen, der die anatomische Methode täglich und stündlich bei seiner Arbeit anwendet. Indessen kann und darf auch der pathologische Anatom nicht an der Frage vorbeigehen, die an die Grundlagen seines Faches rührt: Hat heute noch der anatomische Gedanke für die wissenschaftliche Medizin die fundamentale Bedeutung, die ihm einst durch die Werke eines Vesal, eines Morgagni, eines Bichat und eines Virchow gesichert wurde? Kann als Basis für unsere heutige Krankheitslehre die Vorstellung noch gelten, dass jede Funktion im Organismus an eine greifbare, sichtbare Form gebunden ist, und dass daher auch jeder Abweichung der Form eine Störung der Funktion entsprechen muss?
Das führt tins aber zu einer anderen Frage grundsätzlicher Art, die wir noch kurz berühren müssen: Ist im kranken Körper die anatomische Veränderung, die Störung des organischen Gefüges, das, was der Franzose die ,,lésion"nennt, —ist das die Ursache der Krankheit, wie es die klassische pathologische Anatomie will, oder ist sie die Folge der Krankheit, gewissermassen
ein Symptom, etwa wie der Schmerz? —Man hat viel Scharfsinn auf die Lösung dieser Frage verschwendet, und doch sind die Antworten verschieden ausgefallen. Mir scheint aber, dass eine Antwort gar nicht erteilt werden kann, die für alle Fälle zuträfe. Bei einer einfachen Verletzung, einer Strahlenschädigung, den meisten Infektionen, bei manchen Vergiftungen, kurz bei der Grosszahl der Schädigungen, die auf eine, unmittelbare grobe äussere Einwirkung zurückgehen, liegt die Sache in der Regel durchaus klar: diese Einwirkung setzt die Gewebsschädigung, die ,,lésion", und diese wird zur Ursache der Krankheit. Anders ist es schon bei gewissen Vergiftungen und gar bei den endogenen Erkrankungen, die ohne äusseren Anlass entstehen, bei Geisteskrankheiten, Stoffwechselstörungen und vielem anderen mehr. — Es gibt Vergiftungsfälle, wo der pathologische Anatom ausserstande ist, aus dem Sektionsbefund allein die Todesursache anzugeben, weil oft genug fassbare anatomische Veränderungen überhaupt fehlen; oder aber, wenn sie vorhanden, sind sie nicht derart, dass daraus die Art der krankhaften Störung oder die Ursache des Todeseintrittes hervorgeht. Bei der Phosphorvergiftung beispielsweise mit ihrem charakteristischen Sektionsbild kennen wir zwar durch die Untersuchungen von Lebedeff und Rosenfeld den Mechanismus der eigenartigen Fettverschiebung. Zweifellos ist die resultierende Leberverfettung eine Folge und nicht die Ursache der Störung, der Krankheit, deren eigentlicher Sitz aber nicht erkennbar ist. Das Lokalisationsprinzip lässt sich nicht streng durchführen. — Was die anatomische und histologische, ja die bis ins Feine und Feinste getriebene mikroskopische Durchmusterung des Gehirnes bei den Geisteskrankheiten ergeben hat, das ist — von wenigen Ausnahmen abgesehen — doch recht dürftig; und was an positiven Befunden etwa erhoben wurde, das wird man kaum als Ursache der Geistesstörung betrachten dürfen, sondern wird es als Folge oder — vorsichtiger — als Begleiterscheinung registrieren.
Oder denken wir an Stoffwechselstörungen wie Gicht und Zuckerkrankheit. Gewiss, jeder Kandidat muss im medizinischen Staatsexamen das aufzählen können, was die anatomische
Untersuchung bei diesen Krankheiten zutage fördert; aber er muss auch wissen, dass die Gelenkveränderungen der Gicht wohl Ursache der Schmerzen aber nicht Ursache der Krankheit selbst, d. h. des abwegigen Stoffwechsels sein können. Der "Sitz" der Erkrankung ist nicht fassbar. Es mag sein, dass Rössle Recht hat mit der Vermutung, es sei bei der Gicht die Funktion jeder einzelnen Zelle des ganzen Körpers abwegig, aber eben nur in so geringem Masse, dass es an der Einzelzelle nicht fassbar werde, — eine interessante Arbeitshypothese, die indessen die Lösung des Problems ins Ungewisse verschiebt. — Klarer scheint die Sache beim Diabetes. Seit der Entdeckung des Insulins konnte jeder fleissige Zeitungsleser erfahren, dass man die Ursache der Zuckerkrankheit in Veränderungen gewisser Teile der Bauchspeicheldrüse erblicke, der Langerhansschen Inseln, von denen auch das Insulin seinen Namen erhalten hat. Merkwürdigerweise wird kaum je die Frage aufgeworfen, wie denn die Veränderung dieser Inseln zustande komme; und selbst vielen Spezialisten ist es entgangen, dass der vielleicht beste Kenner der Materie, der Amerikaner Allen, hierauf die Antwort gibt: Die Inseln erkranken, weil ihre zucker-regulierende Funktion durch die Stoffwechselstörung übermässig beansprucht wird, sie gehen an Erschöpfung zugrunde. Somit ist aber ihre Degeneration nicht Ursache sondern Folge, ich möchte geradezu sagen: ein anatomisches Symptom der Krankheit. Und wenn v. Bergmann die Frage aufwirft: "Kann denn aus der gestörten Funktion nicht schliesslich auch das anatomische Substrat hervorgehen?", so möchte ich sie — für diesen Fall wenigstens — bejahen, und glauben, dass es bei manchen anderen sogenannten endokrinen Störungen nicht anders ist.
So führt uns die kritische Prüfung der alten Frage nach den Beziehungen von Form und Funktion schliesslich zur Überzeugung, dass der anatomische Gedanke in der Medizin in seiner alten, etwas starren und wohl allzu einfachen Form nicht mehr voll aufrecht zu erhalten ist, und dass wir das Lokalisationsprinzip, das jeder Krankheit einen ganz bestimmten Sitz im
Körper anweisen möchte, heute nicht mehr voll anerkennen können. Aber müssen wir den anatomischen Gedanken deshalb überhaupt aufgeben, der jahrhundertelang die Grundlage unseres medizinischen Denkens und Handelns war?
Die praktische Heilkunde antwortet hierauf heute vielfach resolut mit Ja; sie will und muss nicht kranke Organe behandeln und heilen, sondern kranke Menschen, wie es im griechischen Altertum schon die hippokratische Medizin tat, die ohne anatomische Kenntnisse ihr hohes Ziel verfolgte. Sie kann auch nicht immer warten, bis ihr Handeln nach allen Richtungen theoretisch gesichert ist. Die medizinische Wissenschaft aber bedarf fester Grundlagen und bestimmter Richtlinien.
Es ist unverkennbar, dass heute, wo die alten Grundlagen erschüttert scheinen, eine gewisse Unsicherheit aufkeimt, die auch eine der Ursachen für die sogenannte Krisis der Medizin bilden mag. Daher die vielfachen Bestrebungen, eine neue Basis und neue Ziele zu finden. Die Erschütterung des anatomischen Gedankens liess den Wunsch wach werden nach Erfassung grösserer Zusammenhänge, übergeordneter Prinzipien usw. Die Arbeit der normalen wie der pathologischen Anatomie hat in dieser Richtung einige Schritte zu tun erlaubt. Ich nenne nur die Namen Heidenhain, Willi. Roux, Braus, Mollier, Aschoff, Rössle. — Auf der anderen Seite zeigen sich Bestrebungen, unter Aufgabe des anatomischen Gedankens die Funktion zur einzigen oder doch wichtigsten Basis allgemein-pathologischer Vorstellungen zu machen, in ihr die Lösung aller Rätsel zu finden. Diese Richtung mag es mit besonderer Freude begrüsst haben, als vor zwei Jahren ein Buch des Klinikers v. Bergmann erschien unter dem Titel "funktionelle Pathologie". Vielleicht erwartete sie, hier das Werk zu finden, das berufen sei, an die Stelle von Virchows Zellular-Pathologie zu treten. — Indessen, wenn man dies Buch liest mit den Augen — und mit dem Herzen — des pathologischen Anatomen, dann wird man mit wachsender Freude feststellen, dass v. Bergmann, immer ausgehend von "funktionellen Gedanken", doch die Funktion nicht vom anatomischen Substrat zu lösen sucht, vielleicht, weil
er sie nicht davon lösen kann. Seine Gedanken haften zwar nicht wie bei manchen anderen (wenn ich so sagen darf) am anatomischen Präparat, aber am lebenden Organ, das uns heute die Röntgenologie in seinem gesunden und kranken Verhalten immer besser erschliesst.
Wenn sich aber die funktionelle Betrachtungsweise nicht vom anatomischen Denken losmachen kann, so muss das einen Grund haben. Diesen Grund lehrt uns die Geschichte der Medizin einsehen. Henry Sigerist hat uns gezeigt, wie der anatomische Gedanke in der Medizin des Abendlandes nach seinem ersten Auftauchen siegreich wurde und seine führende Stellung immer wieder aufrecht erhielt, auch gegen alle anders gerichteten Bestrebungen, die schon in früheren Zeiten nicht fehlten; und wie auch die neuen Entdeckungen über die Funktionen seit Harvey immer von der Gestalt, dem anatomischen Bau der Organe ausgehen. Und Sigerist folgert daraus, dass das anatomische Denken die Denkmethode unserer Medizin ist, die Methode, in der der Abendländer zwangsweise denken muss, aus der er gar nicht heraus kommt. — Mir scheint, solche historischen Lehren sollte auch die Medizin in Krisenzeiten nicht vergessen.
M. D. u. H.! Meine kritischen Bemerkungen, meine skeptische Einstellung zu dem Problem, das uns beschäftigte, mögen manchen von Ihnen vielleicht als mangelnde Achtung vor dem Wunder der Natur erschienen sein. Aber ich meine, die Achtung sei vielleicht grösser, wenn man die Dinge so zu sehen versucht, wie sie sind, als wenn man allzu viel in sie hinein interpretiere. Freilich, das Verlangen, in das lebendige Geschehen tieferen Einblick zu erhalten als die Sinne uns vermitteln, wird man nicht unterdrücken können, solange es denkende, forschende Menschen gibt. Immer wieder wird es aber auch zu Irrtümern führen, die der Korrektur bedürfen. Daher der ständige Wechsel unserer Meinungen. Und so mag wohl v. Uexküll Recht haben, wenn er, gerade als Biologe, sagt: Nicht hinter den Objekten, — hinter den Subjekten liegt das Geheimnis der Welt.






