GEFÄHRDETES UND GESICHERTES LEBEN
JAHRESBERICHT 1961/62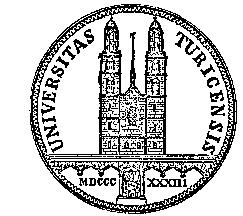
Druck: Art. Institut Orell Füssli AG, ZürichINHALTSVERZEICHNIS Seite
I. Rektoratsrede 3
II. Ständige Ehrengäste der Universität 17
III. Jahresbericht 18
a) Dozentenschaft 18
b) Organisation und Unterricht 26
c) Feierlichkeiten, Kongresse und Konferenzen . . . 44
d) Ehrendoktoren und Ständige Ehrengäste 46
e) Studierende 48
f) Prüfungen 51
g) Preisinstitut 52
h) Stiftungen, Fonds und Stipendien 54
i) Kranken-und. Unfallkasse der Universität . . . . 59
k) Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren der Universität Zürich 60
l) Stiftung zur Förderung der Fürsorgeeinrichtungen für die Professoren der Universität Zürich (SFF) . . 62
m) Zürcher Hochschul -Verein 62
n) Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich 67
o) Jubiläumsspende für die Universität Zürich . . . . 71
p) Julius Klaus-Stiftung 73
IV. Vergabungen 77
V. Nekrologe 84
I. FESTREDE DES REKTORS PROFESSOR DR. ERNST HADORN
gehalten an der 129. Stiftungsfeier der Universität Zürich am 30. April 1962
Gefährdetes und gesichertes Leben
Am Grunde stehender Gewässer lebt ein kleiner Wurm, die Zoologen nennen ihn Tubifex. Sein Vorderende steckt eingegraben im Bodenschlamm, das Hinterende ragt hinaus ins freie Wasser. Mit dem Mund nimmt das Tier die Nahrung auf; durch die Blutkapillaren am Hinterende wird es mit Sauerstoff versorgt. Falls Tubifex zu tief in den nährstoffreichen Grund eindringt, so verliert er den Kontakt mit der noch Sauerstoff führenden Wasserschicht. Bewegt er sich dagegen nach oben in Richtung eines möglichst reichen Sauerstoffangebotes, dann ist ihm die Nahrung entzogen. So ist dieser Organismus buchstäblich ausgespannt zwischen den beiden Lebensschichten der Ernährung und der Atmung. Jede Verschiebung, die eine erhöhte Sicherung in der einen Lebensbedingung bringt, muß mit einer Gefährdung in bezug auf die andere Erhaltungssphäre erkauft werden. Mit diesem anspruchslosen Beispiel haben wir eine Grundeigenschaft der Lebewesen, ein konstitutives Element verdeutlicht: Bedingungen der Lebenssicherung stehen in unvermeidlicher Wechselwirkung mit Möglichkeiten der Lebensgefährdung.
Daß diese Problematik über den Bereich des Biologischen hinausgehend im besonderen auch die menschliche Existenz charakterisiert, sei zunächst nur angedeutet. Als Antinomie erscheint sie in mannigfacher Abwandlung in philosophischen und soziologischen Systemen, in der politischen Alltagsdiskussion, im Kunstwerk ebenso wie im Bereich des Religiösen.
Im folgenden wollen wir uns vornehmlich mit einer Auswahl von Gegebenheiten der Gefährdung und Sicherung befassen,
deren Beurteilung dem Biologen zusteht. So fragen wir zuerst: Ist der Tod des biologischen Individuums eine unvermeidliche Voraussetzung oder gar eine Folge der Lebenssicherung auf dieser Erde? Eine Antwort ergibt sich aus der Stammesgeschichte der Lebewesen. Zweifellos standen die ersten Tiere und Pflanzen noch alle auf der Stufe der Einzeller. In dieser Form waren sie potentiell unsterblich, genau so wie heute eine Amöbe oder ein Flagellat. Denn bei der Vermehrung durch Zweiteilung lebt die gesamte Zellsubstanz des Einzellers in der neuen Generation weiter. Der Tod ist hier keine im System verankerte Notwendigkeit. Wenn Einzeller sterben, so durch «Unglücksfälle und Verbrechen». Sie verhungern, trocknen ein, sie werden vergiftet, zertreten, von Parasiten befallen oder aufgefressen. Erst mit dem Übergang vom Einzeller zum Vielzeller wird der natürliche Alterstod als neues Naturphänomen begründet. Gleichzeitig aber erschließt dieser entscheidende Evolutionsschritt den Lebewesen zahlreiche neue Möglichkeiten.
Die der Einzelzelle gesetzte obere Größenschranke wird überwunden. Es entstehen vielfach vergrößerte Individuen, die sich aus Millionen oder Billionen von Zellen aufbauen. Ihre Vielzelligkeit erlaubt ihnen, die verschiedenartigen Lebensfunktionen, wie Bewegung, Atmung, Verdauung, Exkretion und Reizaufnahme — die im Einzeller noch auf kleinstem Raum vereinigt sind —, auf verschiedene Zellsysteme zu verteilen. So kommt es zu einer wesentlichen Leistungssteigerung durch Spezialisierung der Zellen unter Bildung von Geweben und Organen. Damit sind auch die Voraussetzungen gegeben zur Besiedelung neuer Lebensräume. Vielzeller vermögen das Wasser zu verlassen, sie erobern das Trockene: die Erdoberfläche und die Luft. Von besonders weitreichender Bedeutung ist die im Vielzeller möglich gewordene Entwicklung eines zentralisierten Nervensystems. Dies eröffnet vielgestaltige neue Wege der Reizverarbeitung und Reizbeantwortung und damit der Auseinandersetzung mit der Außenwelt. Außerdem gewinnt der Organismus durch das Nervensystem die Fähigkeit, Erfahrungen zu speichern und nach ihnen künftige Handlungen zu richten. Dabei ist das Ausmaß solcher Gedächtnisleistungen
und Lernfähigkeiten weitgehend von der Zahl der Zellen abhängig, die im Nervensystem zu Funktionseinheiten integriert sind. Im Vielzeller Mensch hat diese Spezialisation vorläufig einen Sondergipfel erreicht.
Doch kehren wir jetzt zu unserer Problemstellung zurück. Die im Vielzeller verwirklichte Leistungssteigerung durch Differenzierung verschiedener Zelltypen und Organfunktionen mußte zu einer Ausscheidung führen zwischen einer nach wie vor unsterblichen Keimbahn und einem sterblichen Körper, dem Soma. Keimzellen lösen sich rechtzeitig aus dem somatischen Verbande des Organismus und begründen eine neue Generation, in der wiederum eine Zellgruppe reserviert bleibt, die in der nächsten Generation weiterleben kann. Das Soma aber altert und bleibt als Leiche zurück auf der Wegstrecke der Generationenfolge. Diese Naturgesetzlichkeit wurde erstmals scharf erfaßt durch den großen Theoretiker der Biologie August Weismann.
Der Unterschied im Schicksal von Soma und Keimbahn führt zu mancherlei Konfliktsituationen zwischen Individuum und Art. Bei Einzellern allerdings fallen die «Interessen» noch zusammen. Denn jede Zelle, d.h. jedes Individuum verwirklicht hier den Arttypus und trägt bei zu seiner Erhaltung. Im vielzelligen Organismus imponiert dagegen nur das sterbliche Soma als gestaltetes Individuum oder gar als Träger eines Bewußtseins. Es steht im Mittelpunkt unserer Beachtung und repräsentiert die Art, setzt sich auseinander mit artgleichen und artverschiedenen Wesen, wie auch mit den Faktoren der unbelebten Natur. Wir Menschen sind geneigt und auch verpflichtet, solchen Individuen einen erhaltungswürdigen Eigenwert zuzuerkennen. Daneben spielen die Keimbahnzellen, die unmittelbar nur der Fortpflanzung dienen, als Komponenten der Individualstruktur keine Rolle.
In der Natur aber sind wesentliche Mechanismen wirksam, die die Artgemeinschaft vor dem Individuum begünstigen. Wir werden später sehen, wie eine übermäßige Sicherung des Individuums die Art gefährden kann und wie andererseits zugunsten der Arterhaltung Individuen geopfert werden. An dieser Stelle sei
lediglich auf eine Tatsache hingewiesen: Bei der großen Mehrzahl aller Tiere und Pflanzen stirbt das Individuum kurz nach Abschluß seiner Fortpflanzungsphase. Solches Platzmachen für die junge Generation wurde offenbar durch die natürliche Selektion gefördert. Der Mensch durchbricht diese Gesetzlichkeit. Sein Leben reicht weit über die den meisten Tieren gesetzte natürliche Schranke hinaus, und einzig bei ihm wird eine solche Lebensverlängerung auch sinnvoll. Worin besteht hier der Unterschied zwischen Tier und Mensch? Das Tier verfügt nur über sehr beschränkte Möglichkeiten, individuelle Erfahrungen und Erfindungen seinen Nachkommen mitzuteilen: ihm fehlen Sprache und Schriftzeichen. Jede Generation hat daher im wesentlichen stets neu und von vorne anzufangen, und dies geschieht nur im Rahmen der Möglichkeiten, die in der chromosomalen Erbsubstanz des Individuums festgelegt sind. Daher kann keine Tiergemeinschaft eine Kultur aufbauen. Dem Menschen aber wird das Erfahrungsgut der vorausgehenden Generationen übermittelt. Er richtet sein Handeln nach dieser Information und schließt neue Erkenntnisse und Erfindungen dort an, wo der Vorfahre stehengeblieben ist. Sö ist der Mensch gegenüber allen Arten ausgezeichnet und begünstigt. Zwar sind auch für ihn — genau wie beim Tier — die Gene der Chromosomenmaterie bestimmend. In der Verwirklichung dieser genetischen Möglichkeiten wird dann aber das angereicherte Kulturgut genutzt als eine nur dem Humanen zukommende Erbsubstanz zweiter Art. Und eben in der Übermittlung dieser kulturellen Erbsubstanz findet die vorhin erwähnte Ausdehnung der Lebensspanne im Sonderbereich der Menschenart ihre Bedeutung und Sinngebung.
Es ist kaum notwendig zu erörtern, daß die Sicherung des Individuums durch Lebensverlängerung mit der Sicherung der Artgemeinschaft nicht in einem unbeschränkten Ausmaße ohne zusätzliche Gefährdung parallel laufen kann. Dieser Generationenkonflikt ist auch uns Menschen nicht erspart. Doch wenden wir jetzt unsere Aufmerksamkeit noch einer weiteren Eigenheit zu, die den menschlichen Lebensablauf auszeichnet. Wir meinen die
ungewöhnlich lange Zeitspanne zwischen Geburt und Geschlechtsreife. Selbst die uns am nächsten stehenden anthropoiden Affen treten schon im Alter von sieben bis neun Jahren in die Fortpflanzungsphase ein. Den Menschenkindern sind dagegen viele gute Jahre der Jugendentwicklung geschenkt, die der Aufnahme des kulturellen «Erbgutes» dienen können. Durch Einflüsse der modernen Zivilisation und Verstädterung, die uns in ihrer Gesamtheit nicht genauer bekannt sind, wird diese unbeschwerte Zeit heute verkürzt. In einem weltweiten Ausmaße läßt sich eine solche umweltbedingte Akzeleration der Entwicklung feststellen. Die Pubertät setzt bei den Kindern durchschnittlich früher ein als bei den Eltern oder gar-den Großeltern. Damit sind wir Zeugen einer Wandlung, die eine bisher spezifisch menschliche Komponente beeinträchtigt. Was scheinbar einer erhöhten Sicherung der Fortpflanzung und damit auch der Arterhaltung dienen könnte, erscheint recht problematisch, indem sich neue Gefährdungsmöglichkeiten für das Individuum wie für die Gemeinschaft abzeichnen.
Wir haben eingangs gesagt, daß ein Dasein im Spannungsfeld der Gefährdung und Sicherung die Lebewesen ganz allgemein charakterisiere. Diese Feststellung müßte nun mit zahlreichen Beweisstücken aus den verschiedensten Teilsystemen der Biologie belegt werden. So wäre etwa zu zeigen, wie im Verhalten teils fertig festgelegte Instinktabläufe, teils aber weitgehend modifizierbare Handlungen zum Einsatz kommen. Instinkthandlungen. sind in der Erbsubstanz bis in alle Einzelheiten programmiert; sie laufen in der Regel fehlerfrei ab und garantieren so eine hohe Sicherheit. Dabei können solche Erbkoordinationen zu imponierenden Spitzenleistungen führen. Wir erinnern an den Nahrungserwerb, die Brutpflege und an das Leben im totalen Sozialstaat der Insekten; wir stellen die instinktgesicherte Technik im Spinnennetz, im Termitenbau und im Nest eines Webervogels fest, oder wir staunen über die Sicherheit, mit der ein Zugvögel seinen nächtlichen Flug nach nie gesehenen Sternbildern richtet. Aus Naturbeobachtungen und Experimenten an Insekten wissen wir, daß solche hochentwickelte Sicherungen jederzeit in Gefährdung
umschlagen können, falls das Unvorhergesehene zu bewältigen ist. Im plastisch-modifizierbaren Verhalten bestimmt die Erbsubstanz lediglich die Rahmenbedingungen. Innerhalb dieses Bereichs wird das individuell Erlernte zum Motiv künftigen Handelns. So ist fur die Bewältigung neuer Situationen — seien sie nun normal häufig oder ungewöhnlich selten — ein anpassungsfähiges Repertoire an Reaktionsmöglichkeiten verfügbar. Doch ergeben sich aus Unbestimmtheit und individuell variabler Motivierung neben den richtigen Lösungen auch häufig die Fehlhandlungen. Starre Instinktsicherung und Sicherung durch adaptive Plastizität der Psyche wirken in jeder Tierart und auch beim Menschen neben- und miteinander. Es wäre daher falsch, etwa die Insekten als reine Instinktwesen zu klassieren und ihnen den Homo sapiens als ein Geschöpf gegenüberzustellen, das die erbmäßig festen Automatismen entbehren könnte. Von Stamm zu Stamm verschieden ist lediglich die Lage des gesicherten Standortes; dieser ist verschiebbar zwischen den noch tragbaren Extremlagen für Instinkt oder Plastizität. Ebenso falsch erscheint — vom Standpunkt des Biologen — eine Wertung im Sinne von «niedriger» und «höher». Beide Prinzipien haben sich bewährt. Die Gliederfüßler entwickelten als artenreichster Tierstamm eine herrliche Mannigfaltigkeit der Formen und Funktionstypen. Sie eroberten alle Lebensräume, sind uns in manchen physiologischen Leistungen überlegen, und einzelne Arten leben in hochorganisierten Staatsverbänden. Daß auch die Säugetiere und —aus ihnen hervorgehend —. die im Extrembereich der Plastizität beheimateten Menschen auf einer Erfolgsseite der Evolution stehen, bedarf keiner weiteren Begründung.
Feste erbmäßige Programmierung und anpassungsfähige Reaktionsbereitschaft wirken nicht nur im Psychischen. Sie charakterisieren vor allem auch die somatischen Entwicklungsprozesse. Dabei bewundern wir mit Recht immer wieder die Zuverlässigkeit dieser Vorgänge. Das wohlgestaltete Kind ist die Regel, die Mißbildung erscheint als Ausnahme. Wir sind weit davon entfernt, all die unzähligen Mechanismen zu durchschauen, die zur Sicherung einer physiko-chemisch doch recht
unwahrscheinlichen Normalentwicklung eingesetzt werden. An dieser Stelle sei nur auf zwei Fähigkeiten hingewiesen: auf das Regulationsvermögen der Entwicklungssysteme und auf die Möglichkeit der lokal kontrollierten Zellvermehrung innerhalb des Gesamtorganismus. Beide Qualitäten sind unerläßliche Komponenten der Lebenssicherung, zugleich können beide auch Anlaß schwerster Gefährdung sein.
Eineiige Zwillinge entstehen aus den Hälften eines Keimes, der auf einem Frühstadium getrennt wurde. In den Fragmenten wird über das zugeteilte Baumaterial regulierend so verfügt, daß nun der Teil die Aufgabe des Ganzen übernehmen kann. Siamesische Zwillinge, doppelköpfige Wesen, Organverdoppelungen und verschiedenartige weitere Mißbildungen sind nichts anderes als halbwegs geglückte oder völlig mißglückte Leistungen des selben Regulationsvermögens, das in der Regel lebenssichernd wirkt.
Mit dem Abschluß von Wachstum und Differenzierung erlischt bei der Mehrzahl der Vielzeller das Teilungsvermögen der Zellen keineswegs. Unsere Oberhaut wird ständig erneuert durch Zellnachschub aus einer Schicht, die bis ans Lebensende teilungsfähig bleibt, und Blutzellen entstehen stets neu in den Teilungsherden des Knochenmarks. Aber auch in zahlreichen weiteren Geweben und Organen bleibt die Teilungspotenz von Zellen als Sicherung für den Notfall erhalten. Diese Fähigkeit der Regeneration wird eingesetzt nach Körperverletzungen und ungewöhnlichen Abnützungsvorgängen, besonders eindrucksvoll in der Heilung von Wunden und Knochenbrüchen. Und jegliche Chirurgie vertraut diesem Regenerationsvermögen. In der Teilungsbereitschaft der Zellen des ausdifferenzierten Organismus lauert andererseits auch eine unheimliche Gefahr. Die Krebsgeschwulst geht stets aus von noch teilungsfähigen Zellen, die ihre Potenz ungehemmt ausleben, ohne sich den regulierenden Ordnungsprinzipien mehr zu fügen. So nahe berühren sich hier Sicherung und Gefährdung!
Diese Spannungslage äußert sich —und damit wenden wir uns einer weiteren Problematik zu — besonders klar in den Eigenschaften
und dem Wirkungsbereich der Erbsubstanz. Die normale Entwicklung und Leistung eines Organismus wird durch Funktionseinheiten gesichert, die wir Gene nennen und die mit den Chromosomen der Zellkerne dem neubegründeten Individuum zugeteilt werden. Je nach Organisationshöhe mag die Zahl der Gene einige Tausend bis einige Zehntausend betragen. Jedem dieser Gene kommt seine spezifische Aufgabe zu, die nur ausnahmsweise durch die Funktion eines anderen Erbfaktors ersetzbar ist. Im einzelnen ist die Erbsubstanz eines jeden Lebewesens das Ergebnis eines Dauerexperimentes, das sich über Jahrmillionen erstreckt hat. Unzählige Genzustände und Genkombinationen. wurden dabei ausprobiert. Was im Normalorganismus existiert und wirkt, hat demnach zahllose Bewährungsproben bestanden. Verlust oder Änderung von Einzelgenen durch Neumutation führt daher in der Mehrzahl der Fälle schon während der Entwicklung zum Tode des betroffenen Individuums, zu mannigfaltigen Mißbildungen oder doch zur Senkung der Lebensleistung. Aus dieser Tatsache folgt, daß die Existenz von Individuum und Art nur dann ausreichend gesichert ist, wenn die Erbsubstanz genügend fest gebaut ist und sich bei jeder Zellteilung auch fehlerfrei vermehrt. Die molekularen Eigenschaften der Gene und die Verteilungsmechanismen, die dieser Sicherung dienen, sind heute weitgehend bekannt. Im einzelnen läßt sich etwa zeigen, daß ein normales Gen der Fliege Drosophila durchschnittlich rund zehntausend Jahre stabil bleibt und in dieser Zeit auch als Matrize dient, an der neue Tochtergene geformt werden, die alle im Molekülbau mit dem normalen Ausgangsmuster übereinstimmen.
Gelegentlich aber — und dies geschieht mit einer voraussagbaren Wahrscheinlichkeit —ereignen sich doch Mutationen in der hochstabilen Erbsubstanz. Und da in der Zelle Tausende von Genen vorhanden sind, kann jede Keimzelle Neumutationen übertragen. Im Genmolekül werden dabei Bauelemente umgeordnet, oder sie gehen verloren; es mögen sich Kopierfehler bei der Genvermehrung einstellen, oder die Verteilung der Chromosomen, d.h. der Genträger wird gestört. Ob nun solche Mutationen
scheinbar ohne äußeren Anlaß spontan auftreten oder ausgelöst werden durch ionisierende Strahlen oder Chemikalien, ändert nichts an ihrer meist fatalen Auswirkung. Warum, so fragen wir jetzt, konnte die natürliche Selektion nicht eine Erbsubstanz begünstigen, die unfallfrei von Generation zu Generation weitergegeben wird? Eine derartige, dem Absoluten zustrebende Sicherheit müßte jede weitere Evolution blockieren; denn unter den zahlreichen Mutationen finden sich doch, wenn auch recht selten, vorteilhafte Genänderungen. Die absolute Stabilität könnte überdies in verhängnisvolle Gefährdung umschlagen, falls sich die Umweltbedingungen ändern. So erscheint jetzt das Mutationsvermögen als Grundlage einer adaptiven Plastizität und als eine Basis der stammesgeschichtlichen Wandlung. Und das Mutationsopfer ist hinzunehmen als ein Tribut, den jede Art und damit auch der Mensch zu leisten hat; es ist ein unvermeidlicher Beitrag an ein arterhaltendes Sicherungssystem.
Durch Wirken der «normalisierenden Selektion» werden die ungeeigneten Genzustände früher oder später aus der Population verschwinden, ein Vorgang, der wiederum der Arterhaltung dient. Die Träger solcher Erbfaktoren sterben früh, oder sie pflanzen sich nicht fort. Trotzdem werden die Erbleiden nicht verschwinden, weil stets neue Mutationen auftreten, die der Elimination entgegenwirken. Aus der Höhe der Mutationsrate und dem Ausmaß der Eliminationsrate ergibt sich für jede Art eine Gleichgewichtslage. Sie bestimmt den Anteil erbmäßig benachteiligter und lebensgefährdeter Individuen in einer Population.
Diese Gleichgewichtslage erscheint heute im besonderen für unsere eigene Art von zwei Seiten her in unerwünschter Richtung verschiebbar. Die Mutationsrate, die zur Vermehrung der destruktiven Erbfaktoren führt, kann ansteigen, und die Eliminationsrate für ungünstige Gene nimmt infolge menschlicher Eingriffe ab. Beide Vorgänge müssen eine Zunahme der erbbedingten Opfer bewirken.
Betrachten wir zuerst die erhöhte Mutationsgefahr! Dabei wollen wir die unabsehbar schrecklichen Folgen eines Atomkrieges
und auch die verderblichen Wirkungen seiner Vorbereitung außer Betracht lassen. Auch im rüstungsfreien Friedensbereich führt die moderne Technik zu einem signifikanten Anstieg ionisierender Strahlen und mutationsauslösender Chemikalien. Wir dürfen uns glücklich schätzen, daß die Genetiker das Ausmaß dieser Gefährdung eben noch rechtzeitig erkannt haben und daß die Forderung nach einer ausreichenden Mutationsprophylaxis heute auch vom Gesetzgeber allgemein anerkannt ist. Im einzelnen ist es allerdings ausgeschlossen, jegliches Unheil zu verhüten, doch läßt sich das Unvermeidliche in tragbaren Grenzen halten, falls überall die Gefahr erkannt und ihr verantwortlich begegnet wird.
Viel schwieriger zu bewältigen ist die Aufgabe, die sich aus der zweiten Bedrohung ergibt. Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die natürliche Selektion gegen die Zunahme und die Verbreitung der verhängnisvollen Gene arbeitet. Diese einfache Aussage ist allerdings sogleich einzuschränken. Es gibt auch in der Natur zahlreiche Gleichgewichtssysteme, die einem Ausmerzen der erbmäßig Bedrohten entgegenwirken. Als erklärendes Modell diene uns die Sichelzell-Anämie des Menschen. Kinder, denen Sichelzell-Gene von beiden Eltern zugeteilt werden, gehen fast ausnahmslos zugrunde, weil bei ihnen die Hämoglobinmoleküle falsch konstruiert sind. Wer aber diesen Letalfaktor nur von einem Elter erbt, vom andern dagegen ein Normal-Gen übernehmen kann, der ist nicht nur völlig gesund, sondern er ist gegen Malariaparasiten resistenter als sein Mitmensch, der mit zwei Normal-Genen ausgerüstet wird. So kann sich das Sichelzell-Gen halten, obschon seine reinerbigen Träger sterben. Das Individualopfer steht hier im naturgesetzlichen Gleichgewicht mit der Wohlfahrt der Population. Erst wenn die Bedrohung durch Malaria verschwindet, verlieren die Gemischterbigen ihren Selektionsvorteil gegenüber den reinerbig Normalen, und jetzt wird auch die Frequenz des todbringenden Gens ständig abnehmen. Wahrscheinlich beruht die Häufigkeit auch weiterer Erbleiden des Menschen auf derartig balancierten Systemen. Jedenfalls ist für zahlreiche Lebewesen nachgewiesen, daß das
Nebeneinander verschiedener Zustände der Erbsubstanz vorteilhaft sein kann. Auf diese Weise gewinnt die Art eine erhöhte Anpassungsfähigkeit gegenüber der Mannigfaltigkeit in der Umwelt. Dabei sind häufig die gemischterbigen Bastardtypen besonders lebenstüchtig; ihr Erhaltungswert kompensiert dann den Ausfall, der sich für bestimmte reinerbige Verwandte ergibt.
Für die nachfolgende Überlegung ist nun gleichgültig, ob ein ungünstiges Gen durch den eben erläuterten Mechanismus vor dem Ausmerzen mehr oder weniger geschützt wird, oder ob der betreffende Erbfaktor — was viel häufiger zutrifft — auch in einfacher Dosis bereits nachteilig wirkt und daher rascher verschwindet. Jede Maßnahme, die die Fortpflanzung der Erbkranken ermöglicht oder begünstigt, muß das Gleichgewicht zugunsten der abnormen Gene verschieben. Mit dieser unausweichlichen Aussage nähern wir uns einer gefährlichen Problematik. Die moderne Medizin rettet heute ungezählte Menschenleben, die in früheren Zeiten ihren Erbleiden erlegen wären. Mit aller Entschiedenheit sei an dieser Stelle sogleich hervorgehoben, daß solche Hilfe niemals in Frage gestellt werden kann, solange wir uns Ärzte wünschen, die dem christlichen oder einem humanistischen Ethos verplfichtet sind. Doch darf uns diese Haltung nicht daran hindern, die möglichen Folgen der Gegenselektion klar zu sehen. Gesichert wird das Leben des Individuums; dadurch werden gefährdet seine Nachkommen, die wiederum der ärztlichen Hilfe bedürfen. Die Therapie korrigiert ja nur die Auswirkung der abnormen Gene, sie heilt nicht die molekulare Fehlstruktur der Erbsubstanz selbst, und sie kann auch nicht verhindern, daß zusätzlich stets neue ungünstige Erbfaktoren durch Mutation in die Population eingeführt werden. Doch lassen wir uns durch diese unheimlich scheinende Perspektive nicht allzusehr schrecken. Zunächst ist hervorzuheben, daß in unserer Zeit die normalisierende Selektion keineswegs aufgehoben ist. Unter Zivilisationsbedingungen scheiden große Teile der Bevölkerung von der Fortpflanzung aus und zudem wird der Mensch neuen Bewährungsproben ausgesetzt. Wir denken an die Streßbelastung, an Rauschgifte und Tablettensucht. Andererseits — und diese Feststellung
ist erfreulicher — sind viele Erbfaktoren, die unter den Bedingungen einer erbarmungslosen natürlichen Selektion in früheren Zeiten das Individuum bedrohen mußten, heute in der nun veränderten Umwelt zu harmlosen oder mindestens tragbaren Varianten der Konstitution geworden. Kurzsichtigkeit, Schwerhörigkeit, leichte Mißbildungen, erbbedingte Schwierigkeiten der Ernährung und des Hormonhaushaltes lassen sich korrigieren. Doch bleibt immer noch ein verhängnisvoller Restbestand an abnormen Genen, die zwar die Art kaum gefährden, die aber den betroffenen Individuen und ihren Verwandten großes Leid bringen. Falls solche Gene unbehindert weitergegeben werden —und dies ist unter den heutigen Bedingungen der Individualhilfe auch vielfach möglich geworden — so müßte tatsächlich die Zahl der schwer Benachteiligten ansteigen. Es gibt wohl keine andere Lösung, als einzelnen Menschen zuzumuten, auf Nachkommen zu verzichten. Dies setzt allerdings eine Verantwortung voraus, die nicht leicht begriffen wird und die von uns verlangt, weltanschauliche Grundsätze stets neu zu überprüfen.
Lassen Sie mich nun noch auf eine letzte und für uns Menschen unmittelbar wichtigste Spannungslage zwischen Sicherung und Gefährdung hinweisen. Wir meinen die überaus erfolgreiche Zunahme der Art Homo sapiens und die sich daraus ergebende Bedrohung durch Übervölkerung. Schätzungsweise hat sich die Erdbevölkerung in den ersten 1650 Jahren unserer Zeitrechnung von 250 Millionen auf eine halbe Milliarde vermehrt. Die anschließende Verdoppelung benötigte noch 200 Jahre und die nächste 80 Jahre. So wurde 1930 die zweite Milliarde erreicht. Für 1975 sind vier Milliarden zu erwarten. Dann mag die Verdoppelungszeit nur noch 35 Jahre betragen, so daß um das Jahr 2010 diese Erde 8 Milliarden zu ernähren hätte. Und hundert Jahre später könnten es sogar 50 Milliarden sein. Dabei sind die Vermehrungsraten in verschiedenen Erdteilen recht unterschiedlich groß. Für Lateinamerika wird vorausgesagt, daß in nur 40 Jahren die 1950 erreichte Bevölkerung vervierfacht werde, und Asien allein soll im Jahre 2000 so viele Menschen tragen wie 1958 die ganze Welt.
Diesen unheimlichen Zahlen, die sich aus Erhebungen und Prognosen der Vereinigten Nationen ergeben, kann man mit zwei Argumenten begegnen. Notwendig sei erstens die Hebung des allgemeinen Lebensstandardes, dann werde nach einer weiteren Phase der Zunahme erfahrungsgemäß später die Kinderzahl von selbst zurückgehen, und so könne sich ein neues weltweites Gleichgewicht einstellen. Und zweitens dürfe man den technisch-organisatorischen Fortschritten zutrauen, daß stets genügend neue Nahrungsquellen und Wohnräume erschlossen würden. Aber niemand weiß, wie und in welcher Zeit die noch unheilvolle Epoche zwischen dem heutigen Zustande des Elendes und des Hungers und dem künftigen Welt-Wohlfahrtsstaat überwunden wird. Und über die Zahl der Menschen, die schließlich noch ernährt werden könnten, besteht keine Einigkeit. Noch nie in der Geschichte stand die Menscheit vor derartig schwierigen Aufgaben. Eine Lösung ist unaufschiebbar. Für Sieg und Niederlage konkurrierender Ideologien und wirtschaftlich-politischer Systeme wird entscheidend sein, wer künftig der Gefährdung durch Übervölkerung besser Meister wird. Und wer heute noch im gesicherten Bereich lebt, muß sich Rechenschaft geben, daß seine traditionsgebundenen Grundsätze versagen können und daß die lokalen Reservate überlieferter Staats- und Gesellschaftsstrukturen dem übermäßigen Populationsdruck kaum dauernd standhalten werden. Wir alle sind Glieder einer Schicksalsgemeinschaft, die alle Völker umschließt.
Wenn Hunger, Pestilenz und' Krieg nicht mehr als Regulatoren der Populationsgröße zum Einsatz kommen sollen, wenn wir weiter und vermehrt «Brot für Brüder» spenden und der Säuglingssterblichkeit entgegenwirken möchten, dann bleibt kein anderer Ausweg als eine wirksame und sinnvoll gerichtete Geburtenkontrolle. So steht jetzt die Menschheit vor der Aufgabe, ihre eigene Vermehrung und Evolution zu steuern. Dieser Verantwortung können wir nicht ausweichen, und da wir zum Handeln gezwungen sind, stellt sich unmittelbar die Frage nach den Grundsätzen, die uns leiten sollen. Mediziner, Biologen und unter ihnen besonders die Populationsgenetiker verfügen über
Erkenntnisse, die zu berücksichtigen sind. Doch kann dieses Wissen allein nicht ausreichen. Die gestellte Aufgabe reicht weit über den Kompetenzbereich des Naturwissenschafters hinaus und erfordert die Zusammenarbeit aller Fakultäten und aller Kulturträger. Alle müssen bereit sein, neue Wege zu wagen und jegliche dogmatische Starrheit zu überwinden. In dieser Freiheit darf aber auch keinem verantwortlichen Menschen verwehrt sein, nach jenen Kriterien zu suchen, von denen er zuversichtlich glaubt, daß sie im göttlichen Gesetz und Weltplan begründet sind.






