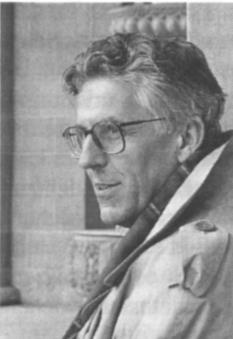
Der Traum an der Grenze
Zur literarischen Phantasie in der Schweiz
«In dreams begins responsibility.» W B. YEATS
Die Phantasie ist unteilbar. Ob sie in Künstlerinnen und Künstlern wirkt oder in Politikern und Politikerinnen — es ist stets die gleiche unberechenbar-ungestüme, zwielichtige Energie. Erst die konkrete Arbeit, mit der sie sich verbindet, schafft die Unterschiede. Die erfinderische List der Phantasie wohnt genauso in den grossen Menschenfreunden, die das Elend bekämpfen, wie in den berühmten Ausbrechern, die aus jedem Gefängnis abhauen. Das Rätsel des plötzlichen Einfalls, dem derjenige, der ihn gehabt hat, so verdutzt gegenübersteht wie alle andern, prägt die Geschichte der Naturwissenschaften nicht weniger als die Geschichte der Literatur. Ein erfolgreicher Taschendieb bedarf der gleichen schöpferischen Imagination wie ein erfolgreicher Finanzminister —die moralische Differenz steht auf einem andern Blatt und wird von den hiefür eingerichteten Lehrstühlen abgeklärt.
Die Erforschung der Phantasiearbeit und ihrer Strukturen kann deshalb unter Umständen Aufschluss geben über Dinge, die dem vordergründigen Gegenstand fernliegen. Aus dieser Vermutung frage ich hier nach der spezifischen Beschaffenheit der literarischen Phantasie in unserem Land.
Ich gehe aus von einem auffälligen Phänomen. Tatsache ist, dass die unbestrittensten Spitzenwerke der Literatur der deutschen Schweiz geprägt sind von der Situation dessen, der aus der Fremde, aus langen Jahren der Fremde heimkehrt und nun in ein dramatisches Verhältnis gerät zur Heimat und zu den Einheimischen. Gotthelfs mächtiger Durchbruchsroman, der «Bauernspiegel», der alles Romanschreiben in diesem Land begründet hat und bis auf den heutigen Tag prägt, ein Buch, entstanden zugleich mit dieser Universität und aus der gleichen politischen Leidenschaft heraus, ist von dieser Gegebenheit gezeichnet wie Kellers «Grüner Heinrich». Und von Dürrenmatts «Besuch der alten Dame» gilt es genauso unübersehbar wie von Max Frischs «Stiller». Daneben findet sich eine erstaunliche Zahl bedeutender Arbeiten, die der gleiche inspirative Stachel treibt: von Spittelers «Imago» bis zu Albert Bächtolds «De goldig Schmid» und Jakob Bührers «Sturm über Stifflis», von Inglins «Wendel von Euw» bis zu Paul Nizons «Untertauchen», von Urs Widmers «Schweizer Geschichten» bis, in jüngster Zeit, Urs Jaeggis «Soulthorn» und Thomas Hürlimanns «Der Gesandte». Der Heimkehrer als Gegenstand des Erzählens vernetzt sich dabei stets bald mit dem Heimkehrer als Erzähler. C. F. Meyers Armbruster im «Heiligen» ist ein Berichterstatter dieser Art und Kellers Pankraz, und in Adolf Muschgs elegantem Erstling, «Im Sommer des Hasen», sitzt der heimgekehrte Erzähler nicht anders in der helvetischen Beiz als einst Gotthelfs Reisläufer Meiss, und während er da von japanischen Gärten und Liebesnächten hinter kühlen Papierwänden schreibt, knallt es rings um ihn dumpf und vaterländisch auf die Jassteppiche. Mit offenem Mund vernimmt der Gefängniswärter Knobel die Lügengeschichten Anatol Stillers, und vor ähnlich offenen Mündern spinnt Inglins Chlaus Lymbacher sein blinkendes Geflunker — bis man ihm auf die Schliche kommt und den Heimgekehrten wieder vertreibt, zusammen mit dem Ärgernis seiner Phantasie.
Nun geht es mir hier keineswegs um das statistische Auflisten eines literarischen Motivs. Ich weiss gut genug, wie viele wohlgeratene Bücher es gibt, in denen nie einer über die Grenze nach Hause kommt. Was mich beschäftigt, sind vielmehr die Fragen, die sich aus der Häufigkeit des Themas und seiner Inspirationskraft erst ergeben. Wir stehen vor einem Erlebnisfeld, das seine eigene Dynamik hat und dessen Voraussetzungen die nähere Betrachtung verdienen.
Die Geschehnisse sind vielfältiger, als die geläufige Meinung es nahelegt. Diese nämlich operiert immer wieder mit dem Begriff der «Enge», der «engen Schweiz», wo ein sensibler Mensch binnen kurzem erstickt und nur Holzköpfe überleben. Nach diesem Muster müsste die Dramaturgie der Heimkehr in der Literatur unausweichlich zusammenfallen mit der Pathogenese einer Asphyxie. Das gibt's, aber es ist nicht alles. Es gibt es allerdings schon seit langer Zeit. Carl Spittelers Roman «Imago» aus dem Jahr 1906, diese witzig-abgründige, anstössig narzisstische Männerstudie vom heimgekehrten Intellektuellen in der Kleinstadt, entwirft allein schon
in ihren ersten paar Kapitelüberschriften die fatale Kurve: «Die Heimkehr des Richters» —«Eine schlimme Enttäuschung» —«In der Hölle der Gemütlichkeit». Und wenn dieser Held seinen Landsleuten gegenüber loslegt, nimmt er alles vorweg, was später in Ludwig Hohls «Notizen» stehen wird und in Frischs «Stiller» und schliesslich in all den nur noch epigonalen Schweiz-Beschimpfungen der letzten zehn Jahre:
«Was für ein Gegensatz! (...) Draussen in der Fremde: offene Arme (...); hier in der Heimat: engherzige Nörgelei (...) Ich will (...) euch die Pharisäermaske herunterreissen (...) Eure <Tugend>? Ein Mundstück, um den Nebenmenschen zu verlästern. Eure <Offenheit>? Ein (...) Vorrecht, dem Nächsten Schnödigkeiten anzuwerfen (...). Eure <Gemütlichkeit>? Egoismus in Herdenformat, schafwollene Oberhautanwärmung (...). Eure Familienseligkeit (...)? Wirf ein Erbschäftlein dazwischen und sieh dann die Liebe! Eure Musik? O ihr jauchzenden Eiszapfen! Eure Bildung (...)? Wenn man euch zur Rechten die Tür zum Paradiese auftäte und zur Linken einen Vortrag über das Paradies ankündigte, ihr würdet sämtlich am Paradies vorbei in den Vortrag laufen. <Interessant, interessant!>»
Das ist er, durchgeformt und ausgebaut, der böse Blick dessen, der über die Grenze zurückkam. Auf ihn bezieht sich Ludwig Hohl ausdrücklich, wenn er schreibt, dass die «Hässlichkeit» der Schweizer —er nennt sie einen ihrer «charakteristischen Züge» — «nur zu erkennen» sei, «wenn man aus dem Ausland kommt; und zwar nach so langem Aufenthalt, dass das Auge neutralisiert wurde.» Und er fügt gleich noch an, dass zu den Zehn Geboten der Schweiz vor allem der Satz gehöre: «Lass dich nicht gelüsten nach deines Nachbars Geist.»
Man kann aus den unterschiedlichen Gestaltungen durchaus ein spezifisches Heimkehrer-Bewusstsein herausarbeiten. Es ist geprägt von der Erfahrung der Grenze. Das Wissen um die Grenze des Landes, und was sie bedeutet und wovon sie trennt, geht durch Leib und Seele. Und dieses körperhafte Bewusstsein der Grenze ist nun nicht nur die Eigenheit einiger literarischer Figuren, sondern es ist die eigentliche Produktionsbedingung für das Schreiben in der Schweiz. Das Bedürfnis, den Heimkehrer an der Grenze zu zeigen, ihn den Grenzübergang erträumen oder erinnern zu lassen, ihn mit seinem «neutralisierten Auge» den Einheimischen entgegenzuschicken, ist nur eine Konsequenz aus dieser umfassenderen Voraussetzung.
Falsch jedoch wäre es, aus den genannten Zeugnissen nun den Schluss zu ziehen, die Dramaturgie der Heimkehr sei unausweichlich ein Weg in die «Hölle der Gemütlichkeit», wo man nur noch ersticken oder toben kann. Im grössten Welterfolg unserer Literatur wird die Erlebniskurve der Heimkehr ebenfalls wie selbstverständlich zum Schlüsselereignis, aber dies führt nicht zur Asphyxie, sondern, im Gegenteil, zum erlösenden Aufatmen, als wäre aller Sauerstoff der Welt hier versammelt. Der Gang über die Grenze wird zum Weg in eine mutterhafte, schosswarm umfangende Geborgenheit. Und dies verdeutlicht sich symbolisch, dass es eine Art hat. Ein kleines
Holzhaus und darin eine tiefe, dämmrige Nische und in ihr wiederum ein Bett in Gestalt einer weichen, mächtig gehäuften Masse, wo man, heimgekehrt aus der weiten Welt, selig versinkt:
«Da (...) war das Bett schon wieder aufgerichtet, prächtig hoch und duftend, denn das Heu war noch nicht lange hereingeholt, und darüber hatte der Grossvater ganz sorgfältig die sauberen Leintücher gebreitet. Heidi legte sich mit grosser Lust hinein und schlief so herrlich, wie es ein ganzes Jahr lang nicht geschlafen hatte. (...) Sein grosses, brennendes Verlangen war gestillt worden: es hatte alle Berge und Felsen wieder im Abendglühen gesehen, es hatte die Tannen rauschen gehört, es war wieder daheim auf der Alp.»
Man komme jetzt nicht gleich mit «Kitsch» und «Trivialität». Was wären wir nicht für traurige Gestalten ohne unsere verschwiegenen Bestände an inwendiger Trivialität! Das Buch der Johanna Spyri, in dem sich Klischee und Genialität so seltsam verbinden, markiert als bedingungslose Erlösungslegende den Gegenpol zu den radikalen Erstickungsgeschichten. In dieser Gegensätzlichkeit waltet die Dialektik des Mutterschosses, und sie wird, als Erlebnisstruktur, auf das Ganze des Landes projiziert. Der eine gerät, kaum ist er über die Grenze, in die Seligkeit des «ozeanischen Gefühls», den andern erfasst die Beklemmung der Ungeborenen beim Einsetzen der Presswehen. Im voraus das eine als wahrhaftig und das andere als verlogen zu bezeichnen, geht nicht an. Entscheidend ist vielmehr, wie die Erfahrung im Einzelfall begründet, wie sie legitimiert wird. Wenn Ludwig Hohl alle Schweizer als hässlich bezeichnet, ist das genauso platt wie die Tatsache, dass es auf Heidis Alp nie regnet.
In der Dramaturgie der Heimkehr sind die kleinen Einzelheiten oft bedeutender als die pauschalen Ergebnisse. Ein Beispiel ist Ulrich Bräker, der Arme Mann im Toggenburg, die brüderlichste Gestalt unserer Literatur. Auch er war ein Heimkehrer und wurde darüber zum Autor. Die Beschreibung, wie er aus den friderizianischen Kriegen zurückkehrt, in die man ihn tückisch verkauft hat, ist unschätzbar in ihrer sittlichen Genauigkeit. Auf den letzten Hügeln über seinem Toggenburg überschwemmt ihn das Glück der Geborgenheit. Da unten, weiss er, ist er daheim, und da erwartet ihn das geliebte Annchen:
«Als ich nun (...) endlich auf die schöne Anhöhe kam (...), bewegte sich alles in mir, und grosse Tränen rollten haufenweis über meine Wangen herab. O du erwünschter, gesegneter Ort! so hab' ich dich wieder (...), dacht' ich so im Heruntertrollen wohl hundertmal (...). Auf der Brücke zu Wattweil, redte mich ein alter Bekannter, Gämperle, an, der vor meinem Weggehn um meine Liebesgeschichte gewusst hatte; und dessen erstes Wort war: <Je gelt! deine Anne ist auch verplempert; dein Vetter Michel war so glückselig, und sie hat schon ein Kind.>. —Das fuhr mirja durch Mark und Bein...»
Auf der Brücke, am scharfen Rand des heimischen Raums, begegnet ihm die Bosheit. Dem Glück antwortet als erstes die menschliche Kälte, die
scheinheilige Schadenfreude. Genau damit aber wird nun auch jene vaterländische Trunkenheit literarisch legitimiert. Sie verwandelt sich nicht ins Gegenteil, sondern wird erkennbar als der Traum vom Ganzen, der nun der Prüfung unterworfen wird. Dieser Traum ist die erste Leistung jenes Bewusstseins der Grenze, und er wird seinerseits produktiv. Das Ganze zu denken und sich selbst darin, dahinter kann der Heimkehrer nicht zurück. Und tatsächlich erkennt Bräker schon in der nächsten Sekunde auch sich selber anders. Er ist überrascht, wie gut er den Schock erträgt. «Zu meinem grössten Erstaunen fasst' ich mich sehr bald und dachte (...): <(...) wenn's so seyn muss, so sey's, und hab' sie eben ihren Michel!>»
Diese Erfahrung, dass der Traum vom Ganzen einer schroffen Prüfung unterworfen wird und dabei auch die eigene Person als umgeschaffen aufdeckt, kehrt wieder in Gotthelfs «Bauernspiegel». Auch da kommt einer heim aus fremden Kriegen und wandert durch leuchtende Landschaften nach Hause:
«Vor mir lag meine Heimat (...) Tief unten im Tale glänzte in der abendlichen Sonne die Wetterstange auf meines Grossvaters Hause, das stolze Bauernhaus auf der Talwand oben sah ich auch mit seinen glitzernden Fenstern, und vor demselben die Elefanten der Schweiz, die stattlichen Kühe auf der Herbstweide. (...) Mein Herz war weit und offen, alle da unten im heimischen Tale hätte es umfangen mögen.»
Das ist der Moment des Traums, die Erfahrung des Ganzen. Hier will der Mann nun leben und etwas nützen. Er tritt ins Wirtshaus; keiner erkennt ihn; man fragt nach Kriegen und Schlachten und schliesslich nach seinem Namen:
«Mir klopfte das Herz, als ich meinen Namen nannte, es klopfte in banger Erwartung, ob freundliche Gesichter mich willkommen heissen würden. Aber fast erschrocken sahen mich die Menschen an. <An dich habe ich nicht gesinnet, es hat niemand geglaubt, dass du wieder kommest>, hiess es von allen Seiten. Einer nach dem Andern schlich sich fort aus Furcht, ich möchte ihn für etwas, vielleicht für ein Nachtlager, ansprechen (...) Der Wirt war bald mit mir allein, (...) auf seinem Gesicht war die Angst zu lesen, ich möchte ihm einstweilen allein zur Last fallen.»
Das ist die gleiche Kälte, wie sie Bräker auf der Brücke von Wattwil entgegenbläst. Nur ist dieser Meiss hier die wildere Natur. Es packt ihn der Zorn und die Rachsucht. Dann aber heisst es: «Da fing leise eine andere Kraft in mir sich zu regen an, die Kraft des Selbstbewusstseins, das Gefühl des eigenen Wertes...» Und es folgt der wunderbare Satz: «Ich verzieh den Vielbeladenen ihre durch Andere erzeugten Ängste.»
Was sich hier abzeichnet, ist ein doppeltes Gericht. Der Heimkehrer zieht die Heimat vor das Tribunal seines Traums und merkt, dass damit auch seine eigene Gerechtigkeit geprüft wird. Der Traum vom Ganzen und das Bewusstsein der Grenze, dem er entspringt, schärfen seinen Blick für die Blindheit der Eingeborenen. Er erkennt ihren verbissenen Pragmatismus, der immer nur die Nuss sieht, die es im Augenblick zu knacken gilt, und nie
den Baum, von dem die harten Früchte herunterhageln. In dem Moment aber, wo sich der Heimkehrer auf den Richterstuhl schwingt, durchaus zu Recht auf den Richterstuhl schwingt, begreift er, dass der grössere Blick nun auch ihn selbst in die Pflicht nimmt.
Dieses Paradox vom gerichteten Richter wird in den Texten selten direkt ausgesprochen. Es erscheint jedoch häufig im Modus des Erzählens, als Ironisierung der Figur und ihrer sittlichen Passion. Sehr auffällig ist dies bei Max Frisch. Seine diversen Heimkehrer, sei es der Mann in «Zürich-Transit», sei es Isidor, der Apotheker und Fremdenlegionär, sei es Anatol Stiller selbst, sind Komödienfiguren, auf die das gleiche böse Licht fällt, in welchem sie ihre Landsleute sehen. Zuckende Intellektuelle am Rand einer zähflüssigen Gesellschaft, partizipieren sie, gescheit, wehrlos und hysteroid, an der Lächerlichkeit, die sie diagnostizieren. Und so erst wird, was sie zu sagen haben, literarisch legitimiert. Wie Bräkers vaterländische Trunkenheit Kitsch wäre ohne den Kälteschock auf der Brücke zu Wattwil, ist die vaterländische Schmährede Kitsch ohne die ironische Relativierung des angemassten Pathos. Selbst Dürrenmatts Alte Dame, deren Richteramt sich doch aus einer kühnen Metaphysik herleitet, tritt auf, von Gelächter umschollert, als käme sie auf Stelzen aus einem phantastischen Karneval. Besonders häufig verdichtet sich solche Komik im Moment der ersten Begegnung mit den Schweizer Polizisten und Zollbeamten. In Inglins fast vergessenem «Wendel von Euw» wird dies prächtig auserzählt. Den klassischen Fall bildet zweifellos Stillers Ohrfeige auf dem Basler Bahnhof, aber auch Urs Widmer arbeitet mehrfach damit, und Hugo Loetscher hat die Situation in seiner Parabel von der Entdeckung der Schweiz durch einen Trupp von Urwald-Indianern gründlich ausgenutzt. Wirklichen Sinn macht dieser eigentümliche helvetische Slapstick jedoch immer erst im übergreifenden Zusammenhang mit dem Traum vom Ganzen und seiner kritischen Überprüfung am lebendigen Objekt.
Eine der geheimnisvollsten Gestalten von Legitimierung der vaterländischen Trunkenheit findet sich in Robert Walsers Prosastück «Die Einfahrt», dem ersten von fünf Texten, die ursprünglich unter dem Titel «Die Heimkehr» als Einheit zusammengefasst waren. Da wird das Idyll aus sich selbst heraus doppeldeutig. Walsers Artistik konstruiert ein naives Geborgenheitsglück, das indessen durch seltsame Untertöne in die Nähe eines unheimlichen Verschlungen- und Verschluckwerdens gerät. Dialektik des Schosses einmal mehr —und nie gläsern-gefährlicher als hier:
«Land und Leute öffneten sich mir so still, so gross (...) und immer fuhr der Zug zart und leise weiter. (...) Göttlich-schön war es, wie ich und die andern Leute so still hineinfuhren, hineingleiteten in die Berge (...). Die Nation trat mir nah; das Vaterland und sein hoher, goldener Gedanke schwebten mir ums Herz. (...) O das war ein schönes Eisenbahnfahren mit mildgesinnten, klugen, ernsten Landsgenossen in die Umschlungenheit hinein. Es umschlang uns mit Felsen und mit Bergen. (...) Ich sah (...) Menschen auf den Wegen gehen, die sich in die Wälder schlängelten. Das
Land öffnete die Arme, und ich, ich sank hinein in die Umarmung und war wieder der Sohn des Landes und seiner Bürger einer. Allmählich wurde es Nacht.»
So endet das Prosastück, und ein geisterhafter Satz am Schluss des ganzen Zyklus gibt nochmals das Echo auf diese Passage: «Eine himmelblaue Welle ist über mich gekommen und hat mich unter ihrem flüssigen, liebevollen Leib begraben.»
Den gewaltigsten Traum vom Ganzen und zugleich das gnadenloseste Gericht über den heimkehrenden Träumer birgt, wer wüsste es nicht, Kellers «Grüner Heinrich». «Traum» ist hier wörtlich zu nehmen. Unmittelbar bevor der verlorene Sohn aus Hunger und Elend nach Hause aufbricht, überrennen ihn die nächtlichen Visionen. Der Traumtext ist nicht nur in seinen äusseren Ausmassen immens, er ist es auch in seinen innern Abgründen und Aufwerfungen und Umstürzen. Er macht eine erotisch-politische Phantasmagorie von solcher Bildergewalt aus, solcher Gefühls- und Denkentfaltung, dass alles Deuten sich darin verliert und der Interpret mit seiner ganzen Wissenschaft absäuft, als wäre er in den Rheinfall gerudert. Das Privateste verknüpft sich mit dem Öffentlichsten, die intime Kindes- und Liebesnot mit der Geschichte des Landes und seiner politischen Kultur. Geschrieben um 1854, ist dieser Traum vom Ganzen unverkennbar genährt vom triumphalen Bewusstsein der liberalen Durchbruchsgeneration, die soeben den fortschrittlichsten Staat Europas, Europas einzige Republik neu geschaffen hat. Und dem entspricht dann auch, dass der einzelne unerbittlich in die sittliche und politische Pflicht genommen wird. Es ist diese komplementäre Unerbittlichkeit —komplementär eben zum grossen Traum —, was den armen Heinrich den Kopf kostet. Die verschärfte Erkenntnis seiner selbst, die zum Bewusstsein der Grenze gehört und die bei Gotthelfs Meiss zu dem tönenden Satz führt: «... ich war in harter Schule, aber als vernünftiges Wesen ging ich daraus hervor, das seinen Schöpfer kennt und sich», diese Erkenntnis führt bei Heinrich zur Selbstverurteilung. Er stirbt, weil er den Tod der Mutter verschuldet hat, stirbt aus sich selbst heraus einfach weg, so sehr schämt er sich gegenüber dem intakten Ganzen.
Keller hat diesen Schluss später gemildert, hat das Gericht über seinen Helden in dem Masse gnädiger ausfallen lassen, als sich herausstellte, dass das Ganze auch nicht hielt, was es im ersten Überschwang versprochen hatte. Der Bezug von Traum und Verantwortung bleibt indessen gewahrt, so, wie er alle diese Geschichten insgeheim bestimmt.
«In dreams begins responsibility», lautet ein merkwürdiger Satz bei W. B. Yeats. Er könnte auch über den meisten Büchern stehen, die aus dem Bewusstsein der Grenze heraus entstanden sind — und damit über dem grössten Teil unserer Literatur. Denn das Heimkehrerbewusstsein färbt diese ein, auch wenn sie keineswegs von weitgereisten Leuten berichtet. Das hat mit der doppelten Staatsbürgerschaft aller schweizerischen Literatur zu tun. Sie gehört zu diesem Land, und ebenso vollgültig gehört sie zur Gemeinschaft aller Länder deutscher Sprache. Wo sie etwas taugt, ist sie
immer schon weit über das Nationale hinaus. Sie hat den europäischen Horizont, oder es gibt sie nicht. Selbst wenn sie in Trubschachen spielt oder in Niederbipp, kommt das gutmütige Dorf nur ins Blickfeld durch einen Zoom-Effekt, der es aus einem länderweit ausgerollten Panorama heranholt — und jederzeit wieder darin verschwinden lassen kann. Als Schweizer allein kann man keine guten Bücher schreiben —als Franzose hingegen wohl und auch als Italiener und Engländer. Das ist nicht so sehr eine Frage der geographischen Ausdehnung als der sachlichen Gegebenheit eines internationalen Sprachraums, der auch der homogene Raum aller Sprachkunst ist. Die Sprache ist ja nicht etwas, das zur literarischen Phantasie irgendwann als äusserliches Vehikel hinzutritt, sie ist mit ihr von Anfang im tiefsten vereinigt. Die kontinentalen Dimensionen der deutschen Sprache schlagen durch in jedes Wort, auch wenn ein Zollinger ein Gedicht über den Bachtel schreibt oder eine Helen Meier ein Prosastück über eine alte Frau in Weisstannen. Mit dem ersten Satz schon kehrt der Schreibende wie aus fernen Provinzen der deutschen Sprache zurück an den Ort, wo er jetzt vor dem weissen Papier sitzt, und er spürt die Landesgrenze im lebendigen Leib.
In den Paralipomena zum «Grünen Heinrich» beschreibt Keller den «beschränkten und einseitigen Patrioten», dem «mit den Landesgrenzen die Welt mit Brettern vernagelt ist». Von diesem sagt er: Wenn das Land «mit dem Jahrhundert und der Welt in Berührung tritt, so wird er sich in der Lage eines Huhns befinden, welches angstvoll die ausgebrüteten Entchen ins Wasser gehen sieht». Dieses Hühnerschicksal ist mit der genuinen literarischen Phantasie in der Schweiz grundsätzlich unvereinbar. Ludwig Hohls sarkastisches Gebot: «Lass dich nicht gelüsten nach deines Nachbars Geist», wird von der Schweizer Autorin, dem Schweizer Autor in dem Augenblick schon gebrochen, wo es sie überhaupt zu schreiben gelüstet.
Auf diesem Hintergrund werden die vielen Heimkehrer in unseren Büchern fast zu allegorischen Emblemen der literarischen Phantasie. Und es stellt sich heute mehr als je die Frage, ob es ohne ihre spezifische Beschaffenheit eine schöpferische Phantasie irgendwelcher Art hierzulande überhaupt noch geben kann, sei's eine politische, sei's eine ökonomische, sei's eine wissenschaftliche. Das Heimkehrerbewusstsein mit seinem Traum vom Ganzen, seinem Verantwortungsgefühl und seiner Selbsterkenntnis, mit seiner Richtergeste, die selber vor Gericht gerät, mit seinem Pathos, seinem Spott und seinen Lächerlichkeiten, ist es nicht der Prototyp jener weit umfassenderen wachen, witzigen und weltläufigen Phantasie, von der wir uns als schweizerische Europäer allein noch den Ausweg aus der Klemme erhoffen können? «In dreams begins responsibility.» Die Verantwortung beginnt in den Träumen. Das war bisher nicht unbedingt ein eidgenössisches Sprichwort. Aber vielleicht kommt es noch soweit.






