Ueber
Religionsfreiheit helvetischen Republik
besonderer Berücksichtigung der kirchlichen Verhältnisse
in den deutschen Kantonen.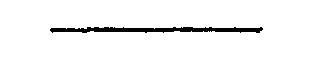
Studien zur Rektoratsrede anlässlich des Stiftungsfestes der Berner
d. Zt. Rektor der Hochschule.
Bern, Druck und Verlag von K. J. Wyss. 1884. in der mit
Anmerkung: Die in Klammern gesetzten Nummern bezeichnen die Aktenbände des helvetischen Archivs im Bundesrathhause zu Bern.
Allgemeine Ideen und konstitutionelle Bestimmungen über Religionsfreiheit in der helvetischen Republik.
Prof. Hilty vergleicht in seinen "Vorlesungen über die Helvetik" (Bern, Fiala, 1878) die Zeit der helvetischen Republik mit einer scheu gemiedenen und halb vergessenen Insel. Die Erinnerung an die helvetische Periode verdiene aber auch desshalb aufgefrischt zu werden, weil jene merkwürdige Episode in der Geschichte unseres Landes so reich sei an fruchtbaren Gedanken staatlichen Lebens, an Ideen und Problemen, die noch heute unsere Generation bewegen. — Die Männer, auf deren Geistesarbeit die neuen Gedanken vorzüglich zurück zu führen waren, wussten es übrigens selber recht wohl, dass ihre Revolution die einzelnen Kantone Helvetiens auf sehr verschiedenen Stufen der Kultur "übereilt" habe. (Vrgl. Abt, Johann Rudolf Fischer von Bern, Frauenfeld, 1882, S. 47.) So dürfen wir uns nicht darüber wundern, dass viele Gedanken, die vor achtzig Jahren bereits klaren Ausdruck gefunden hatten, später fast in Vergessenheit geriethen und erst nach einigen Jahrzehnten wieder aufzuleben und allgemeineres Verständniss zu finden vermochten.
Wie verhält es sich mit den Formen unseres öffentlichen Lebens, die für unsere moderne Kultur besonders charakteristisch sind und die wir unter dem Ausdruck Religionsfreiheit zusammen fassen können?
In der alten Eidgenossenschaft hatte, im Allgemeinen, jeder Kanton seine Staatsreligion, welcher sich der Bürger bei schwerer Strafe unterwerfen musste. Selbst aufgeklärte Männer sahen hierin nichts Unbilliges. Im Jahr 1747 war in Luzern ein Mann Namens Jakob Schmidli von Wohlhausen hingerichtet worden, weil er in seinem Hause religiöse Versammlungen gehalten und dabei Erbauungsschriften frommer Basler Protestanten vorgelesen hatte. Die Berechtigung des Staates zu solcher Massregel anerkannte noch um das Jahr 1788 der aufgeklärteste katholische Eidgenosse, der berühmte Verfasser der Schrift Helvetiorum jura circa sacra, Felix Balthasar von Luzern. "Einmal", so schreibt er (Gügler, Zeichen der Zeit, 4. Heft, S. 384 ff.), "man würde mich nicht bereden, dass es einem wirklich katholischen Staat gedeihlich oder anständig ständig wäre, einer solchen Religionsfreiheit Thür und Thor zu öffnen. Zum Glauben würde ich Niemand zwingen; doch so lang er in dem Land, wo ich zu befehlen hätte, lebete, so müsste er um der gemeinen Ruhe und zur Aufweichung des Aergernisses sich nach den Landesgesetzen und den Gebräuchen gemäss verhalten, oder aber dürfte er meinetwegen sein Glück ungehindert und ungekränkt anderswo suchen". Die Religion sei wohl ein "freies Ding" und der Glaube eine "Gabe Gottes": auch wolle er zugeben, dass das Naturgesetz einem Jeden gestatte, zu glauben, was ihm beliebe. Allein wenn sich Jemand nicht damit begnüge, die "Denkungsfreiheit" für sich zu geniessen, sondern seine von der Staatsreligion abweichenden Meinungen auch Andern beizubringen suche, so würde er "den
Urheber sothaner Missethat beim Kopf nehmen und Andern zum Beispiel und zum Schrecken mit schwerer Hand züchtigen." "Im Uebrigen", fügt Balthasar noch bei, "bin ich gänzlich der Meinung, dass die christliche Religion alles Blutvergiessen, alle Gewaltsamkeiten verwünsche. Wie könnte es anderst sein, da sie den Geist der Verträglichkeit — die Tolérance zur Begleiterin hat."
Diesem Geist entsprechen nun die Verordnungen der helvetischen Konstitution offenbar besser als das Staatskirchenthum der alten eidgenössischen Kantone. Sie enthielt in Art. 6 folgende Sätze: "Die Gewissensfreiheit ist uneingeschränkt, jedoch muss die öffentliche Aeusserung von Religionsmeinungen die Eintracht und Ruhe nicht stören. Jede Art von Gottesdienst ist erlaubt, wenn er die öffentliche Ordnung nicht stört und nicht Herrschaft oder Vorzug verlangt."
Die feierlichste Anwendung dieser Grundsätze war das Gesetz vom 12. Februar 1799. Der Sohn jenes im Jahr 1747 in Luzern hingerichteten Jakob Schmidli lebte immer noch in der Verbannung, obwohl er beim Tode seines Vaters erst ein Jahr alt gewesen war, sich also der Häresie noch nicht schuldig gemacht hatte. Er wünschte nun Wiedereinsetzung in sein Bürgerrecht. Sie wurde ihm und Allen, welche sich in gleichen Verhältnissen befanden, durch das erwähnte Gesetz zugesprochen. Denn, sagen die helvetischen Gesetzgeber, es komme nur der Gottheit allein zu, über die Gedanken und Meinungen der Menschheit zu richten; die Konstitution sichere allen Religionen Duldung zu und verpflichte deren Bekenner zu gegenseitiger Verträglichkeit und Bruderliebe. Durch die religiösen Verfolgungen der ehemaligen Regierungen seien die Rechte der Menschheit verletzt worden. Daher wurden "alle in Helvetien noch vorhandenen Strafgesetze der ehevorigen Regierungen gegen
religiöse Meinungen und Sekten" als aufgehoben erklärt und alle der Religion wegen verbannten Helvetier in "den Schooss des freigewordenen Vaterlandes" zurückgerufen. Auch musste die Schandsäule entfernt werden, welche die Luzerner Regierung auf dem Platze, wo das niedergebrannte Haus des Jakob Schmidli gestanden war, hatte errichten lassen.
Schwieriger, als derartige Folgen des frühern Religionszwanges aufzuheben, war es, ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung den Einzelnen den Genuss der Religionsfreiheit möglich zu machen.
Noch am 3. Januar 1799 forderte das Vollziehungsdirektorium der helvetischen Republik den Minister der Künste und Wissenschaften auf, dem Direktorium einen Bericht vorzulegen "über die Verhältnisse. welche zwischen dem Staate und der Religion überhaupt anzunehmen seien." Zu einer gesetzlichen Regelung dieser Verhältnisse kam es aber nie. Darüber herrschten nämlich schon im Schoosse der ersten helvetischen Regierung sehr verschiedene Ansichten. Wie Peter Ochs, der Vater der helvetischen Konstitution, so wollte Laharpe, seit dem Juni 1798 die Seele des Direktoriums, die Kirche als eine völlig isolirte Gesellschaft betrachten, um die sich der Staat nicht weiter zu kümmern habe. Darum wurde schon in der Verfassung von "Kirche" gar nicht gesprochen, sondern nur von der Aeusserung "religiöser Meinungen", von "Arten des Gottesdienstes", von "Dienern verschiedener Religionen", von dem Verhältnisse, in welchem eine "Sekte" zu "fremden Gewalten" stehen könne. Demgemäss wurde die Religionsfreiheit lediglich als ein den Individuen zukommendes Recht aufgefasst. Laharpe wollte nicht einmal eine förmliche Autorisation zur Feier des eidgenössischen Bettags ertheilen, sondern veranlasste
das Vollziehungsdirektorium, auf ein bezügliches Gesuch den Bescheid zu geben, die Verfassung gestatte die freie Ausübung aller Kulte, daher dürfe auch eine Bettagsfeier stattfinden; übrigens sehe es die Regierung mit Vergnügen, wenn jeder Bürger die Gebräuche seiner Religion beobachte, indem sie überzeugt sei, dass die Grundsätze einer gereinigten Religion diejenigen der Freiheit und der Tugend nicht beeinträchtigten. (Direktorialbeschluss vom 16. Aug. 1799.) Als nun aber der Minister der Künste und Wissenschaften auf den Bettag desselben Jahres ein Kreisschreiben verfasste, in welchem er die moralische Bedeutung des Christenthums verherrlichte, untersagte ihm das Direktorium die Verbreitung des bereits gedruckten Aktenstückes. Wie nützlich, heisst es in der betreffenden Zuschrift, die moralischen Grundsätze sein mögen, die Stapfer entwickelt habe, so könne doch die Regierung an deren Verbreitung keinen Antheil nehmen, denn sie sei nicht in der Lage, die Principien irgend einer Religion oder Philosophie zu proklamieren.
Der Justizminister Meier wollte die Kirchen nicht so einfach ihrem Schicksal überlassen, sondern denselben zuerst eine Verfassung geben. Unterm 26. Mai 1798 setzt er in einer langen Abhandlung dem Direktorium seine Anschauungen auseinander und schlägt ein Dekret vor, nach welchem eine völlige Trennung von Kirche und Staat hätte vorgenommen werden sollen. Jede Kultusgemeinschaft sollte ein "Seminar", wie er sich ausdrückt, errichten. Dieses hatte "die betreffende religiöse Meinung und Alles, was auf die Ausübung des Kultus Bezug hat", zu lehren. Die Regierung der Kirche sollte einer "Verwaltungskammer" von fünf und einem Gerichtshof von dreizehn Mitgliedern übertragen werden. Der Gerichtshof bekam die Befugniss, "religiöse Funktionäre abzusehen und solchen, die eine andere religiöse Meinung annehmen
würden", die Anerkennung zu entziehen. Die Einwohner einer Gemeinde, die sich zu einer bestimmten Religion bekannten, hatten auf dreifachen Vorschlag des Seminars den Pfarrer zu ernennen u. s. w. (Nr. 566.) Von der Ausführung dieses Projektes versprach sich der Minister eine Beruhigung der geängstigten Gewissen und eine friedliche Lösung aller kirchenpolitischen Schwierigkeiten. Die Berathung über das Projekt wurde vertagt und nachher niemals mehr aufgenommen.
Anderer Meinung war Stapfer, der Minister der Künste und Wissenschaften. Ihm war mit der Aufsicht über die Lehrer auch diejenige über die Geistlichen und damit überhaupt über die kirchlichen Angelegenheiten übertragen. In dieser Stellung, erklärt er im Jahre 1800, ("Einige Bemerkungen über den Zustand der Religion und Ihrer Diener", Bern, Nationalbuchdruckerei, 1800, S. 6) habe er sich stets bestrebt, "die unselige Maxime eines gänzlichen Religionsindifferentismus des Staates, deren verheerenden Einfluss er für sein Vaterland befürchtete, nach Kräften zu bestreiten und zu untergraben" , dagegen habe er sich "die gewissenhafte einstweilige Erhaltung des Status quo der christlichen Kirche zur Pflicht gemacht." Die helvetische Nation habe sich die Umänderung der Staatsform "nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des damaligen Bestands der kirchlichen Anstalten gefallen lassen"; die gesetzgebende Gewalt habe daher nicht einen Schatten von Recht gehabt, die bestehenden kirchlichen Einrichtungen zu modificieren oder gar umzuschmelzen. — Das ist auch nicht ernstlich versucht worden, — es sei denn von Stapfer selbst. In dieser Hinsicht beschäftigte ihn namentlich der Plan, die Kirche "repräsentativ zu organisiren." Schon unterm 3. Januar 1799 entwickelt er diesen Gedanken in einer Botschaft an das Vollziehungsdirektorium (Nr. 563). Er sagt darin:
Si un évêque national, un consistoire protestant, un Synode permanent ou périodique s'adapteraient mieux à un tel but, sont des questions qui méritent bien d'être ensuite approfondies. En général ii est certain que, si un Tribunal ecclésiastique secondoit, sanctionnait les mesures du Gouvernement qui sont relatives à l'Eglise, à sa police, au culte, aux attributs des ci-devant monastères, aux réformes introduites dans l'administration de leurs revenus et dans les nominations des ministres du culte: le peuple accueillerait alors ces changements avec une confiance illimitée et le gouvernement mettrait en évidence l'observation stricte et réligieuse du 6me article de la constitution. Thatsächlich erliess Stapfer wenigstens an die reformirte Geistlichkeit der helvetischen Republik die "freundschaftliche" Einladung, "sich selbst in völlig repräsentative Verhältnisse" zu setzen. Allein nur der bernische Kirchenrath antwortete zustimmend. In Folge dessen liess der Minister sein Projekt fallen und sorgte dafür, dass wenigstens die kantonalen Kirchenrathe ihre Existenz retteten. Stapfer bekennt nach dem Sturz des Direktoriums (7. Januar 1800, dass er zu diesem Zwecke äusserst vorsichtig habe verfahren müssen. Gewisse Mitglieder des Direktoriums (Laharpe) hätten von der fortgesetzten Existenz und Auktorität der kantonalen Kirchenrathe nichts erfahren dürfen, weil sie sonst dieselben durch einen Machtspruch vernichtet hätten. "Bald dem Direktorium zum Trotz und bald ohne sein Vorwissen wurde das Ansehen der kirchlichen Behörden behauptet, und ihnen alle Hülfe, die möglich war, geleistet" (A. a. O. S. 22).
Eine durchgreifende, systematische Neugestaltung der kirchlichen Verhältnisse oder auch nur der Beziehungen zwischen Kirche und Staat haben wir also aus der Zeit der Helvetik
nicht zu erwarten. Immerhin ist doch eines der bleibenden Verdienste der helvetischen Republik das, der Religionsfreiheit auf dem Boden der Eidgenossenschaft zum ersten Mal eine Heimath bereitet zu haben. Das geschah weniger durch das Grundgesetz der Republik als durch eine Reihe von praktischen Massregeln. In Wirklichkeit war ja die helvetische Konstitution gar nicht das, was wir heute unter Verfassung verstehen, sondern ein von Alt-Zunftmeister Peter Ochs von Basel verfasster Aufsatz über die Grundsätze, nach welchen die neue Eidgenossenschaft organisirt und regiert werden sollte und die den 12. April 1798 auf einer Versammlung von Repräsentanten des Volkes in Aarau ohne Diskussion anerkannt wurden.
Schon in dieser sogenannten ersten helvetischen Verfassung wurde in sehr wichtigen Punkten die graue Theorie des in religiösen Dingen Indifferenten Staates verlassen und der praktische Boden der gegebenen Verhältnisse betreten. Mit vollem Recht machte am Anfang des Jahres 1799 der Archivar des Ministers der Wissenschaften, der berühmte Freiburger P. Girard, in einem ausführlichen Gutachten über die Organisation des Schulwesens darauf aufmerksam, dass ein Staat. dessen Verfassung von jedem activen Bürger die Eidesleistung fordere, consequenter Weise die Pflege der Religiosität voraussetze, also der Religion gegenüber nicht indifferent sein könne. Viel deutlicher, als diese logische Folgerung aus Art. 24 der Konstitution, brachte es Art. 26 den kirchlichen Gemeinschaften in Helvetien zum Bewusstsein, dass doch auch die Gründer der helvetischen Republik die Rücksicht auf die bestehenden kirchlichen Verhältnisse nicht ausser Acht gelassen hatten. Obwohl nämlich nach Art. 6 die Gewissensfreiheit gewährleistet und die freie Ausübung aller gottesdienstlichen Handlungen, die nicht gegen die öffentliche Ordnung verstiessen, gestattet war, lautete Artikel
26 gleichwohl: "Die Diener irgend einer Religion können keine Staatsämter bekleiden, noch den Primarversammlungen beiwohnen." Damit waren eben doch Tausende der einflussreichsten helvetischen Bürger einzig mit Rücksicht auf ihre kirchliche Stellung des Activbürgerrechtes beraubt, was um so verletzender war, weil eine derartige Zurücksetzung der Diener der Kirche unter den bisherigen Regierungsformen nicht existirt hatte. Stapfer erklärte die angeführte Verfassungsbestimmung "als einen solchen Widerspruch mit den Rechten des Menschen, als eine so augenscheinliche Ungerechtigkeit, dass darüber unter Denkenden nur eine Stimme sein könne." Wiederholt drang er desshalb beim Vollz.-Direktorium darauf, dass es die gesetzgebenden Räthe zu einer Revision des Artikels 26 der Verfassung veranlasse. In einer Zuschrift vom 3. Jan. 1799 hob er insbesondere hervor, dass in den Kantonen Luzern, Oberland und Leman der Klerus aufrührerische Bewegungen beruhigt und grosses Unglück verhütet habe, dass Kultusdiener den grössten Eifer zur Verbesserung des öffentlichen Unterrichtes an den Tag legten und dass es Kantone gebe, in welchen auch der katholische Klerus ein Licht verbreite, das er nur bewundern könne. Der Klerus könne es verschmerzen, dass ihm die Revolution die Einkünfte genommen, nicht aber, dass man ihn in bürgerlichen Dingen zur sclavischen Nullität erniedrigt habe (Nr. 563). Diese Vorstellungen blieben ohne Wirkung. Die Anhänger der aus Frankreich herüber genommenen Grundsätze über Religion und Kirche hielten die möglichste Zurückdrängung des Klerus für nothwendig zur Herstellung der in der Verfassung verheissenen Religionsfreiheit. Diese bestand und besteht nämlich nach der Meinung Vieler einfach darin, dass man es dem Einzelnen möglich macht, alle Wohlthaten des gesellschaftlichen Lebens zu
geniessen, ohne jemals mit einer Kirche in Berührung zu kommen, falls er diese Berührung nicht wünscht.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass zur Verwirklichung der Religionsfreiheit auch die Beseitigung jeden Zwanges, der von den Kirchen auf die Einzelnen ausgeübt werden könnte, nothwendig ist. Allein man wird doch nicht vergessen dürfen, dass gar Viele, ja die Meisten, ihre persönliche Religiosität im Verein mit Andern bethätigen wollen und darum einer kirchlichen Genossenschaft angehören. In Folge dessen identifiziren dieselben in der Regel ihren persönlichen Glauben mit dem Glauben ihrer Genossenschaft und richten sich in den Formen ihrer Religionsübung nach dem Kultus ihrer Kirche. Sie müssen desshalb auch für ihre Kirche Existenzberechtigung und freie Bewegung verlangen und sehen in jeder Beeinträchtigung der Freiheit der Kirche, welcher sie angehören, gewöhnlich auch einen Eingriff in ihre individuelle Religionsfreiheit. Es ist also damit noch keineswegs eine Allen genügende Freiheit in religiösen Dingen hergestellt, dass es jedem Einzelnen möglich gemacht wird, sich kirchlichen Genossenschaften gegenüber in jedes beliebige Verhältniss zu setzen. Im Gegentheil können Massregeln, die zu diesem Zwecke getroffen sind, unter Umständen geradezu als Beschränkung der Freiheit in religiösen Dingen empfunden werden. Wenn wir uns also ein einigermassen vollständiges Bild davon verschaffen wollen, wie die in der helvetischen Konstitution proklamirte Religionsfreiheit konkret verwirklicht worden sei, so werden wir diese nach ihrer individuellen und kirchlichen Seite kennen zu lernen haben.
Spezielle Verordnungen und Massregeln der helvetischen Behörden zur Verwirklichung der verfassungsmässigen Religionsfreiheit.
I. Individuelle Religionsfreiheit.
a. Civilstands-Verordnungen.
An mannigfaltigen gesetzgeberischen Versuchen und praktischen Massregeln zum Zwecke, die Individuen jedem kirchlichen Verbande gegenüber unabhängig zu machen, falls ihnen diese Unabhängigkeit erwünscht war, hat es in der helvetischen Republik keineswegs gefehlt.
Wir denken bei solchen Dingen zunächst an ein Gesetz, das die bürgerliche Kontrolirung der Geburten, Sterbefälle und ehelichen Verbindungen so ordnet, dass bei den genannten Anlässen kein Kirchendiener in Anspruch genommen werden, keine religiöse Handlung vollzogen werden muss, wenn Jemand die Kirchendiener nicht liebt und keine religiöse Handlung vorzunehmen wünscht. Den Ansatz zu einer solchen Verordnung finden wir in der helvetischen Republik im Gesetz vom 15. Febr. 1790 (Nr. 1337), das in § 53 zu den Pflichten der Municipalbeamten auch die rechnet, "Lebens- und Todesscheine, Zeugnisse der Wahrheit u. s. w." auszustellen, und in § 54 vorschreibt: "Die Municipalitäten beschäftigen sich mit den Geburts-, Sterbe-
und Eheregistern der Bürger," — freilich "ohne die Pfarrer der Pflichten zu entledigen, die sie bisher über diese Gegenstände gehabt." Diese letztere Bestimmung wurde in das Gesetz aufgenommen, weil, wie Rengger, der Minister des Innern, fürchtete, "bei einem grossen Theil der Municipalverwaltungen keine hinreichend fähigen Sekretärs zu finden seien, um diese Register mit der erforderlichen Genauigkeit zu führen." Rengger machte desshalb unterm 25. März 1799 dem Minister Stapfer den Vorschlag, da, wo es nöthig sei, die Pfarrer "als Sekretairs der Municipalverwaltungen" zu beauftragen, bis auf Weiteres "die bürgerlichen Register ganz abgesöndert von allen kirchlichen Verhältnissen nach einer bestimmten Vorschrift zu besorgen." Daneben dürften sie ihre besondern Pfarrbücher gleichwohl weiterführen. Stapfer ging jedoch auf diesen Vorschlag nicht ein. Er hörte bereits so manche Klage über die Municipalitäten, die, wie Diakon Schulthess von Zürich schreibt. "aus bäurischem Hochmuth, aus Unwissenheit oder Unverstand, ja auch aus wahrer Bosheit dem Pfarrer gegenüber die Aristokratenriecherei auf's Aeusserste trieben," dass er nicht hoffen durfte, den Pfarrern wirklich ein Sekretariat der Municipalverwaltungen übertragen zu können. So begnügte sich der Minister der Künste und Wissenschaften damit, den Pfarrgeistlichen in einem Cirkular vom 2. April 1799 eine Anweisung zur genauen und einheitlichen Führung der Tauf-, Ehe- und Sterbebücher zu übersenden (Nr. 1345). Dabei blieb es. Nur erinnerte der Vollziehungs-Rath der helvetischen Republik durch einen Beschluss vom 20. Jan. 1801 die helvetische Geistlichkeit nochmals an ihre Pflicht und Verantwortlichkeit bezüglich der Pfarrbücher (Nr. 1594).
b. Religionsunterricht in der Schule; Schulgesetz.
Wenn den Einzelnen die Möglichkeit verschafft werden soll, sich ohne jeglichen bürgerlichen Nachtheil den kirchlichen Genossenschaften gegenüber in ein völlig unabhängiges Verhältniss zu setzen, so werden auch die öffentlichen Schulen jedes konfessionellen, ja auch jedes religiösen Charakters entkleidet werden müssen. Damit die Väter jeder kirchlichen und jeder unkirchlichen Richtung ihren Kindern die Theilnahme an der öffentlichen Erziehung gestatten können, ohne dass die Kinder mit Anschauungen bekannt gemacht werden, welche denen der Väter widersprechen, muss jede Form des Religionsunterrichtes aus der Schule entfernt werden. Diese theoretisch richtige, aber praktisch sehr bedenkliche Folgerung aus den Grundsätzen der Konstitution war den Staatsmännern der helvetischen Republik recht wohl bekannt. Man versuchte, wenn auch nur schüchtern, die Frage zu lösen. —
Schon den 23. Juli 1798 erhielt das Vollz.-Direktorium von den gesetzgebenden Räthen den Auftrag, die für die öffentlichen Erziehungsanstalten erforderlichen Gesetze zu entwerfen. Der Minister der Künste und Wissenschaften zog zu diesem Zweck aus allen Theilen Helvetiens Männer zu Rathe, denen er ein Urtheil in dieser Sache zutraute. Eine Unmasse von Gutachten und Projekten liegt bei den Akten. Inzwischen suchte er durch besondere Verordnungen die Volksschule, so gut es ging, mit der Verfassung in Einklang zu bringen. Ein von Fischer, dem Sekretär des Ministers für Wissenschaften und Künste, entworfenes Circulars vom 30. Oktober 1798 "an die Religionslehrer Helvetiens" ist für den Plan, der dem Minister vorschwebte, so bezeichnend, dass die Hauptstellen des
interessanten Aktenstückes hier mitgetheilt werden dürfen. Zunächst werden die Geistlichen ermuntert, die Schulen fleissig zu besuchen und die Religionsunterweisungen mit "Sanftmuth und Milde" fortzusetzen; man wolle sie durch die Einsetzung besonderer Schulkommissäre nicht aus der Schule verdrängen. Dann heisst es wörtlich: "Ihr besorget vielleicht, dass man die christliche Religion verdrängen wolle, weil man weniger davon spricht als von andern Theilen des Unterrichts. Ihr seid irrig in dieser Meinung; denn wenn man für beide Kirchenpartheyen in unserer Republik sorgen will so muss man die Religion wenig berühren, weil doch immer Verschiedenheiten darin sich darbieten, welche die Regierung unangetastet lassen will. Künftig sollen einzig die Geistlichen den Religionsunterricht besorgen, nicht mehr die Schulmeister, welche unmöglich die religiöse Einsicht haben können, welche man bei einem aufgeklärten Geistlichen, der immer noch fortstudirt, erwarten kann... Diese Massregel soll Euch über Vieles beruhigen. Ihr könnt den Schluss leicht ziehen, dass es von Euch abhangen wird, ob Ihr die Religion ferner in einem ehrwürdigen Ansehen behalten werdet, oder nicht. So viel gestehe ich indess freymüthig, dass diejenigen, welche bloss als dogmatische Eiferer auftreten und nicht nach Jesu Beispiel Gehorsam gegen die Gesetze, Vertrauen gegen die Vorsehung und allgemeine Bruderliebe predigen wollten, wenig Anspruch hätten an die Zufriedenheit des Staates und ihrer nächsten bürgerlichen Vorsteher." Nr. 1342.)
Aehnliche Weisungen erhielten auch die Erziehungsräthe der einzelnen Kantone. Nachdem nämlich durch Direktorialbeschluß vom 5. Juli 1798 den Verwaltungskammern der einzelnen Kantone gestattet worden war, sich der bisherigen akademischen und Kirchenrathe als untergeordneter Verwaltungsbehörden
zu bedienen, wurde durch ein anderes Dekret des Vollziehungsdirektoriums vom 24. Juli 1798 die Einsetzung besonderer kantonaler Erziehungsräthe angeordnet. Nach dem ersten Beschluss hatten die Verwaltungskammern den akademischen und Kirchenräthen einen Kommissär beizuordnen, der den Sitzungen beiwohnen und darüber wachen sollte, "dass die Räthe ihre Pflichten im Geiste der Konstitution beobachteten und über ihre Untergebenen keinen mit den Rechten der Bürger unverträglichen scholastischen oder kirchlichen Despotismus" ausübten (Nr. 1342). Dagegen war für die vom Minister der Künste und Wissenschaften zu ernennenden kantonalen Erziehungsräthe ein solcher Kommissär nicht mehr nothwendig. Diesen wurde eine von Fischer entworfene und auf Stapfer's Antrag den 22. Dezember 1798 vom Vollziehungsdirectorium genehmigte Instruktion mitgetheilt (Nr. 1423), in welcher u. A. den Schulinspektoren aufgetragen wurde, eine Kontrole zu führen "auch über die Geschäfte des Schulmeisters, d. h. seine ordentlichen Unterrichtsstunden sowohl als die ausserordentlichen ihm etwann zufallenden Verrichtungen." "Es ist sehr nützlich", heisst es da, "dass sich der Schulinspektor darnach erkundige, ob der Schulmeister eines Ortes sich mit Kinderlehren abgebe u. s. w., weil viele von ihnen aus Fanatismus und Begierde, sich durch Verrichtungen auszuzeichnen, welche in ihren Augen vornehm sind, sich dazu drängen, und die Bequemlichkeit der Pfarrer oder die Entfernung ihrer Wohnung von den Filialen diese opera supererogatoria der Schulmeister veranlasset und begünstiget" (S. 43). "Der Schulinspektor soll auch nachfragen, ob der Schulmeister eigenen Unterricht in der Religion ertheile, oder ob dieser ausschliessend dem Pfarrer der Gemeinde überlassen sei."
Allein trotz dieser Massregeln blieben die Verhältnisse ziemlich so, wie sie waren. Die evangelischen Schulinspektoren der deutschen Schweiz nennen einstimmig unter den Schulbüchern, die im Gebrauche waren, den Heidelberger Katechismus, Der Inspektor des Bezirks Kulm meldet zwar unterm 30. März 1799, der Religionsunterricht sei gänzlich dem Pfarrer überlassen, sagt aber gleich darauf, die Kinder hätten in der Schule den Heidelberger Katechismus, Psalmen und einige Kapitel aus dem Neuen Testament auswendig zu lernen, und rühmt den Lehrer von Unterkulm, der alle Samstag Abend und im Winter am Sonntag für Erwachsene Christenlehre halte. Während einige Inspektoren an der Stelle des Heidelberger Katechismus ein anderes Religonshandbuch wünschen, erklärt er, das Volk würde die Entfernung des Katechismus als "einen Eingriff in die Religion selbsten betrachten", hingegen schlägt er Gellerts moralische Lieder zur Einführung vor (Nr. 1423). Der Inspektor des Obersimmenthals, der wackere Pfarrer Lauterburg in der Lenk, übersandte dem Minister Stapfer im Frühjahr 1799 über Schuleinrichtungen ein ausführliches Gutachten, in welchem er voraussetzt, dass der Religionsunterricht erstes Lehrfach bleibe. Dazu macht er die Anmerkung: "Ich weiss nicht, was für ein Unhold iii meiner Gemeinde das Gerücht ausgestreut: Es soll künftig in den Schulen die Religion nicht mehr gelehret werden. Was ich desswegen schon für Verdruss zu erdulden hatte, mag ich nicht melden. Das Traurigste ist, dass man solchen Gerüchten mehr glaubt, als unsern Gegenerinnerungen." An einer spätern Stelle aber sagt er: "Als das Gerücht ausgestreut wurde, es werde von den Schullehrern inskünftig keine Religion mehr gelehret werden, so hatte ich hin und wieder die Aeusserung zu hören: "Ja, ja; man wird uns unsere Religion ändern, oder gar, wie bei
den Franken, wegnehmen wollen; aber das lassen wir nicht geschehen" (Nr. 1422).
Auch die Schulinspektoren katholischer Distrikte klagen häufig genug über das Misstrauen, mit welchem das Volk die Neuerungen im Schulwesen entgegen nahm. So sprach man im Kanton Luzern von der "Sulzjoggi-Schule", d. i. von der Schule, in welcher die Glaubensansichten des schon erwähnten Jakob Schmidli von Wohlhausen gelehrt würden, oder auch von der "Franzosenschule", denn im "Namenbüchlein", das die Kinder gebrauchten, ständen ja französische Buchstaben (Nr. 1451). Es wird sogar erzählt, dass in einer Gemeinde der Pfarrer selbst durch den Gemeindepräsidenten am Schulhalten verhindert worden sei, weil es "um die Religion gehe". Und doch scheint in katholischen Gegenden auch nicht ein Versuch gemacht worden zu sein, den Religionsunterricht aus der Schule zu verdrängen. Stapfer wusste wohl, warum er nicht auf der konsequenten Durchführung seiner Verordnung bestand und war so vorsichtig, dass er z. B. den trefflichen Pfarrer Imhoof von Schinznach ersuchte, er möchte auf dem Titelblatt des Abc-Büchlein, das dieser herausgegeben hatte, den Druckort Aarau nicht nennen, weil sonst das Büchlein in katholischen Gegenden nicht eingeführt würde. Jmhoof erwiderte, die Furcht des Ministers sei wohl begründet, ja er habe selber in seiner eigenen Gemeinde den Kredit verloren, weil man ihm wegen des Büchleins vorwerfe, er stehe mit Aarau in zu genauer Verbindung. Er schlug nun vor, statt Aarau "Helvetien" zu setzen (Nr. 1422).
Thatsächlich lag einstweilen weder für das evangelische noch für das katholische Volk ein Grund vor, gegen die Schule aus religiösen Gründen misstrauisch zu sein, sofern es nur Vertrauen auf die eigenen Geistlichen hatte. Der
eben genannte Pfarrer Imhoof von Schinznach war Schulinspektor des so übel beläumdeten Distrikts Aarau. Einem Berichte vom Frühjahr 1799 zufolge waren sämmtliche Lehrer des Distrikts vor ihrer Anstellung durch den Ortspfarrer geprüft worden. Dasselbe ergibt sich aus vielen andern Berichten (Nr. 1423). Manche Inspektoren fügen harmlos bei, dass der Lehrer vorzüglich die eingeführten Religionshandbücher habe auswendig lernen lassen. Die Schulinspektoren sämmtlicher 9 Distrikte des Kantons Luzern waren katholische Geistliche. Ihre Ausbildung erhielten die angehenden Lehrer dieses Kantons entweder im Kloster St. Urban oder beim patriotischen Pfarrer Häfliger von Hochdorf und dem dreiundsiebenzigjährigen Schulmeister Wyss daselbst. So lange es an Lehrern fehlte, übernahm an manchen Orten der Geistliche das Schulhalten. Aus eigennützigen Absichten konnte dies nicht geschehen; denn, wie ein officielles Bericht aus dem Jahr 1801 sagt, betrug das Minimum der Jahresbesoldung im Kanton Luzern 80 Fr. Nun accordirten die Gemeinden aber bisweilen noch willkürlich mit dem Schulmeister; denn, sagt der Bericht, "es gibt beinahe in jeder Gemeinde einen ausgedienten Soldaten oder alten Schulpraktikus, der es um ein Geringes übernimmt, im Winter als Schulmeister zu dienen". Von solchem Lehrerpersonal waren keine sehr gefährlichen Neuerungen zu befürchten. Auch waren die Schulen so überfüllt, dass man sich wundern muss, wie die Kinder nur überhaupt etwas lernen konnten. Nach demselben Bericht gab es im Kanton Luzern Schulen, die 185, 203, 365, 408 u. s. f. Kinder (natürlich unter je Einem Schulmeister) zählten (Nr. 1451).
Während des Jahres 1799 sollte wenigstens das Volksschulwesen durch ein Gesetz allgemein geregelt werden. Ein Entwurf, der bei den Akten liegt (Nr. 1422), ist vom
20. März datirt; in abgeänderter Fassung wurde er den 20. November 1799 vom Grossen Rath angenommen und dem Senat überwiesen. (Protokoll Nr. 3.) Nach §5 ist den Pfarrern, wie bisher, die Lehre der Religion überlassen, während der Schulmeister im Lesen, Schreiben, Rechnen Unterricht ertheilt. Nach § 13 sollen vor einer Lehrerwahl die angemeldeten Kandidaten vom Pfarrer in Gegenwart der Municipalität geprüft werden. Die Wahl selbst nimmt nach § 16 auf den Bericht des Pfarrers die Verwaltungskammer des betreffenden Kantons vor. Der § 24 überträgt dem Pfarrer die Aufsicht über die Schule; "dem Pfarrer vereint mit der Municipalität" lautet der Entwurf, wie er aus der letzten Berathung hervor ging und überhaupt steht in allen folgenden Artikeln die "Municipalität" neben dem Pfarrer. Im ursprünglichen Projekt war dem Pfarrer für den Fall hartnäckiger Pflichtversäumniss im Schulwesen "Verminderung des Einkommens" angedroht. Da nun aber in jenen Jahren das Pfarreinkommen ohnehin ganz ausblieb, so wurde der Strafartikel 34 schliesslich in folgender Fassung angenommen: "Das Vollziehungs-Direktorium wird denjenigen Pfarrern oder Municipalbeamten, die ihre Pflicht nicht erfüllen, ihre Nachlässigkeit verweisen; bei fortdauernder strafbarer Nachlässigkeit kann das Vollziehungsdirektorium die Strafbaren ihrer Stelle entsetzen". Die zwei letzten Artikel des Gesetzes bezogen sich auf die Privatschulen. Darnach waren von der Pflicht, die öffentlichen Schulen zu besuchen, diejenigen Kinder ausgenommen, deren Eltern den Municipalbeamten und den Schulaufsehern die Beweise vorlegten, dass sie denselben eine sorgfältige Privat erziehung verschafften, "worin sie auch mehr als bei dem öffentlichen Unterricht gebildet werden können." Die betreffenden Eltern hatten aber
gleichwohl an die Besoldung des öffentlichen Schulmeisters ihren Beitrag zu leisten. — Das erste Traktandum, welches der Senat der helvetischen Republick in der ersten Sitzung dieses Jahrhunderts am 2. Januar 1800 zu Bern behandelte, war das eben charakterisirte Schulgesetz. Nach dem Antrag der vorberathenden Kommission verwarf er die Vorlage (Senatsprotokoll Nr. 62).
Wäre das Gesetz auch angenommen worden, so würde es doch an den thatsächlichen Verhältnissen wenig geändert haben. Stand es mit dem Religionsunterricht in der Schule so unter der Herrschaft des Direktoriums, so war vom 8. Januar 1800 an noch weniger zu befürchten, dass die helvetische Centralregierung durch rücksichtslose Durchführung der Theorie von der konfessionslosen Schule die Gewissen beunruhigen werde. Im Gegentheil ging von da an das lebhafte Bestreben der Regierung dahin, dem Volke namentlich jeden religiösen Grund oder Vorwand zu nehmen, mit der neuen Ordnung der Dinge unzufrieden zu sein. Den Wendepunkt bezeichnet das Dekret des nunmehrigen Vollziehungs-Ausschusses vom 22. Januar 1800 (Nr. 296). Der zweite Artikel dieses Dekretes lautet: "Die Verwaltungs-Kammern treten an die Stelle der Behörden der alten Ordnung der Dinge, um alle diejenigen Rechte auszuüben, die jenen Behörden in kirchlichen Angelegenheiten sowohl über Personen als Sachen zukamen." Das bedeutete eine Entlastung der Central- und Neubelebung der Kantonalregierungen, namentlich auch in Schulsachen. Das Misstrauen gegen die Schule war damit freilich noch nicht überall gehoben. Noch unterm 5. Februar 1801 erliess der Erziehungsrath des Kantons Luzern eine Proklamation, in der es heisst: "Man hat nicht die Absicht, aus den Kindern Gelehrte zu machen, oder sie in Sachen zu unterrichten, welche
unnütz sind, oder ihnen gar schädlich werden könnten. Aber darum ist's zu thun, sie im Lesen, Schreiben, Rechnen und vorzüglich im Christenthum und allem dem, was einem vernünftigem Menschen und freien Bürger wohl ansteht und erspriesslich ist, bestens zu belehren..... Es sagen zwar Viele, dass man nicht mehr lehre wie vor Altem, und dass es darum gefährlich sein könne, die Kinder in die Schule zu schicken. Diese Leute verstehen nicht, was sie sagen. Man lehrt jetzt noch das, was man vor Altem gelehrt hat; aber man gibt sich Mühe, es den Kindern auf eine leichtere Art beizubringen." Gleichzeitig wurde den Landschullehrern vom Erziehungsrath eine ausführliche und eindringliche "Anweisung und Aufmunterung" zugesandt, in der es S. 9 heisst: "Den vorgeschriebenen kleinen Katechismus von St. Urban soll der Schullehrer nicht nur zum Auswendiglernen brauchen, sondern denselben den Kindern auch erklären. Er soll sich besonders befleissen, die Schulkinder auf die Kinderlehren, welche sonntäglich in den Pfarrkirchen gehalten werden, vorzubereiten und den Inhalt derselben nachzuholen.".... "Der Schullehrer habe Aufsicht über die Jugend der Gemeinde in der Kirche, unterstütze in Erhaltung der Ordnung bei den Gottesdiensten den Pfarrer und gehe in erbauendem Betragen in der Kirche Jungen und Alten der Gemeinde mit dem guten Beispiele vor" (Nr. 1451). Die Seele des Erziehungsrathes, der diese Verordnungen erlassen hat, war der patriotische Stadtpfarrer von Luzern, der viel angefochtene Thaddäus Müller. Der Versuch, überall in Helvetien Schulen zu errichten, denen Gläubige und Ungläubige, Orthodoxe und Heterodoxe ihre Kinder anvertrauen konnten, ohne dass zu befürchten war, die Kinder könnten in der Schule religiöse Dinge lernen, welche von den Eltern nicht gebilligt wurden, war definitiv aufgegeben.
c. Die Sittengerichte.
In einer andern Hinsicht gelang es freilich, die individuelle Freiheit gegenüber den Kompetenzen kirchlicher Genossenschaften sicher zu stellen, wir meinen hinsichtlich der sog. Sittengerichte. Die alten Regierungen betrachteten sich dem unmündigen Volke gegenüber als Träger der väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt und schrieben sich darum die Befugniss zu, die obrigkeitliche Autorität auch in Fällen zur Geltung zu bringen, in denen es sich einfach um Aufrechthaltung von Wohlanständigkeit und guter Sitte handelte. Das geschah namentlich in protestantischen Gegenden durch die staatlich anerkannten Sittengerichte. An der Spitze derselben stand jeweilen der Geistliche des betreffenden Ortes. Stapfer, ein eifriger Vertheidiger dieses Institutes, bemerkt in einem Gutachten vom 24. Januar 1800 (Nr. 1345): "Es ist nicht zu leugnen, dass diese Verfahrungsart des Staates (für gute Sitte zu sorgen) und die geistliche Vormundschaft, die seine Häupter gegen ihre Untergebenen ausübten, der Willkürlichkeit Raum geben und in Verbindung mit despotischen Maximen der bürgerlichen oder äusserlichen Freiheit der Bürger zu nahe treten konnten. Allein der wohlthätige Einfluss auf Volksbildung und Sittlichkeit, welcher daraus entsprang, überwog beträchtlich den Nachtheil, welchen diese moralische Zucht für die streng bürgerlichen Rechte der Staatsmitglieder nach sich zog."
Man sollte glauben, der nach Massgabe der helvetischen Konstitution eingesetzten Exekutiv-Behörde sei ein Institut wie die Sittengerichte sehr willkommen gewesen. Niemals hat es nämlich ein schweizerisches Grundgesetz gegeben, das in so moralisierendem, fast erbaulichem Tone geschrieben gewesen wäre wie die erste helvetische Verfassung. So heisst es im 5. Artikel:
"Das Gesetz verbietet alle Art von Ausgelassenheit; es munterer auf, Gutes zu thun." Der Artikel 14 aber nimmt sich beinahe aus wie eine Predigt: "Der Bürger ist sich dem Vaterlande, seiner Familie und den Bedrängten schuldig. Die Freundschaft ist ihm heilig; er opfert ihr aber keine seiner Pflichten auf. Er schwört allen persönlichen Hass und alle Eitelkeit ab. Er will nur die moralische Veredlung des menschlichen Geschlechtes; er ladet ohne Unterlass zur süssen Bruderliebe ein; sein Ruhm ist die Achtung guter Menschen, und sein Gewissen entschädigt ihn, wenn man ihm ungerechter Weise diese Achtung versagt." Sobald man derartigen Gedanken bürgerliche Gesetzeskraft verleiht, muss man auch die Organe schaffen, bezw. erhalten, welche über die Befolgung derselben im öffentlichen Leben wachen. Damit kommt man aber nothwendig zu Sittengerichten.
Es ist nun von den gesetzgebenden Behörden der helvetischen Republik niemals ein Gesetz erlassen worden, durch welches dieses bereits vorhandene Institut abgeschafft worden wäre. Auch hat das Vollziehungsdirektorium niemals ein derartiges Dekret erlassen. Freilich wurde auch niemals ein Beschluss gefasst, durch den die Sittengerichte in die neue Regierungsform herüber genommen worden wären. Thatsächlich aber verschwanden sie bei der Entstehung der helvetischen Republik.
Der Berner Kirchenrath verurtheilt in einer Klageschrift vom 14. Januar 1800 (Nr. 576) die Preisgebung der Sittengerichte in der denkbar schärfsten Weise. Er leitet dieselbe von der bewussten Absicht her, "das Ansehen der Geistlichen zu zerstören, ihnen den Einfluss auf die Volkstugend geflissentlich abzugraben und der wildesten Ausgelassenheit alle Dämme aus dem Wege zu räumen"; ja er rechnet sie zu den Mitteln, mit
welchen man "die Zerstörung des Christenthums in Helvetien", "die Organisirung der Unsittlichkeit und des Verbrechens und die Erschaffung eines Vorwandes bezweckte, das absichtlich zur Verwilderung gebrachte Volk mit einem eisernen Scepter beherrschen zu können."
Stapfer erklärt zwar ("Bemerkungen über den Zustand der Religion", S. 23) die Abschaffung der Sittengebote auch als eine "der beweinenswürdigsten Calamitäten. die unser armes Vaterland getroffen haben", widerspricht aber doch mit Entschiedenheit dem Berner Kirchenrath, wenn dieser jene Abschaffung aus der angegebenen, ruchlosen Absicht herleitet. Viel richtige: erklärt er sich offenbar dieselbe "aus einer übel verstandenen, unvermeidlich geglaubten Anwendung des Grundsatzes von der Trennung der Gewalten." Die Sittengerichte konnten nur fortexistieren, wenn sie von den helvetischen Behörden förmlich anerkannt wurden. Es verhielt sich mit denselben ganz anders als mit den kantonalen Kirchenräthen. Diese wurden zwar auch lange nicht förmlich anerkannt; das Vollziehungsdirektorium wollte eben überhaupt von keiner kirchlichen Organisation und Autorität amtliche Kenntniss nehmen. Aber die Kirchenrathe waren getragen vom kirchlichen Bewusstsein des Volkes und behielten ihr Ansehen auch ohne bürgerliche Sanktion, während die Sittengerichte ohne diese Sanktion ihre Funktionen unmöglich fortsetzen konnten — aus dem einfachen Grunde, weil sich gerade Diejenigen ihrer Jurisdiktion entzogen, welche nach der alten Ordnung vor ihr Forum geladen worden wären. So erfreuten sich denn allerdings auch Solche der individuellen Freiheit gegenüber der Kirche, welchen die kirchliche Zucht ganz nützlich gewesen wäre.
Nach dem Sturz des Direktoriums verlangten die Kirchenräthe aller evangelischen Kantone in eindringlichen Petitionen
die rasche Wiederherstellung der Sittengerichte und ergingen sich dabei in den bittersten Klagen über die traurigen Folgen, welche die Preisgebung derselben nach sich gezogen habe. "So viele Ehen", klagt z. B. der Berner Kirchenrath, "werden durch Untreue oder Zweytracht zerrissen, das Ansehen der Eltern über ihre Kinder wanket; Uebelhausen, Verschwendung, Völlerey bei den sich täglich mehrenden Gelegenheiten dazu nehmen überhand. Die Bessern werden durch ärgerliches Fluchen, durch Unwesen an den Sonn- und Festtagen geärgert; die Steuern durch nächtliches Gelärm in und ausser den Weinhäusern beunruhigt; die verderbliche Spielsucht wird allgemeiner, befördert den Ruin so vieler Familien und wird ein häufiger Anlass zu Schlägereien und blutigen Händeln. — Wenn auf der einen Seite das Landvolk die vorigen Regierungen beschuldigt, dass sie ihm die Belehrungsmittel vorenthalten und es absichtlich darauf angelegt haben, es im Stande der Unmündigkeit zu erhalten, so beweist eben dieses Landvolk auf der andern Seite, wie wenig ihm an der Bildung seiner Kinder gelegen sei. Die Schulen werden hin und wieder nicht von der Hälfte der zu ihnen gehörenden Kinder besucht; die jungen Leute entziehen sich den öffentlichen Religionsunterweisungen oder Kinderlehren; die Schulmeister und Pfarrer sind ohne Ansehen und Einfluss und alles eilet einer gänzlichen Auflösung der Zucht und der Sitten entgegen" (Nr. 1345).
Damit sind auch die Dinge angegeben, welche in die Kompetenz der Sittengerichte fallen sollten. Stapfer hielt die Klagen der Kirchenräthe für wohl begründet. "Der Schaden ist fürchterlich und unübersehbar", schreibt er schon unterm 24. Januar 1800 (Nr. 1345), "welcher wie der Krebs um sich greifen und die edleren Bestandtheile der Volkswohlfahrt zerstören muss, wenn keine Sorge mehr angewendet, keine Anstalt
getroffen wird, ärgerliche, aber ausser dem Kreise bürgerlicher Vergehen befindliche Auftritte zu ahnden oder zu verhüten." Der Minister verlangt daher ein förmliches Gesetz, durch das die Sittengerichte wieder ins Leben gerufen werden. Da er einsah, dass dies kaum so rasch geschehen werde, forderte er den 5. Februar 1800 in einer äusserst energischen Zuschrift an den Vollziehungsausschuss, dass dieser vorläufig das der Konstitution völlig entsprechende, durch kein Gesetz förmlich aufgehobene Institut durch ein provisorisches Dekret wieder herstelle (Nr. 1345). Dieser Forderung wurde zwar auch keine Folge gegeben. Allein Stapfers Vorstellungen hatten doch die Wirkung, dass der Vollziehungsausschuss schon unterm 19. Febr. 1800 den gesetzgebenden Räthen ein Gesetzesprojekt übermittelte, das die Wiederherstellung der Sittengerichte zum Gegenstande hatte (Protokoll des Vollziehungsrathes Nr. 297). In der Botschaft, die dem Gesetzesentwurf beigegeben wurde, sagt der Vollziehungsausschuss den Volksrepräsentanten u. A.: "Sie werden aus dem beigefügten Entwurf sehen, dass der Vollziehungsrath auch die Religionslehrer zur Mitwirkung bei der allgemeinen Wiedergeburt beruft. Bürger Gesetzgeber! Es ist Zeit, jene verhängnissvollen Theorien aufzugeben, die zwischen Gott und den Menschen, zwischen der Religion und dem Gesetze eine Scheidewand aufführen wollen. Geben Sie dem letztern Kraft und Stärke durch allen Einfluss der erstern und lassen Sie Hand in Hand beide die öffentliche Wohlfahrt befördern." In der That hatte nach dem Gesetzesvorschlag der Pfarrer in der zu errichtenden Behörde eine sehr einflussreiche Stellung. Es sollte in jeder Pfarrgemeinde ein Sittengericht eingeführt werden; Präsident desselben war der Pfarrer; die sechs Mitglieder sollten zwar von der Gemeindeversammlung gewählt werden, aber der Pfarrer hatte für jede Stelle einen
dreifachen verbindlichen Vorschlag zu machen. Die Gegenstände, die in die Kompetenz dieses Gerichtshofes fallen sollten, sind: "Aeusserungen und Handlungen, wodurch die Ehrerbietung gegen den religiösen Kultus verletzt wird und welche auf die Störung der Religionsübungen abzielen", sodann die bereits oben angegebenen. Das Gericht sollte die Befugniss haben, Leute, die durch unanständiges Betragen Aergerniss gaben, vor sich zu bescheiden, zu censuriren, zu rügen und eventuell mit einer Geldbusse bis zu 4 Fr. zu bestrafen. Rückfällige oder Widersetzliche waren den Municipalitäten und durch diese dem bürgerlichen Gericht zu überweisen.
Der Gesetzesentwurf ging an die vorberathende Kommission. Aber erst unterm 4. September 1801 stossen wir im Protokoll des Grossen Rathes der helvetischen Republik (Nr. 82, S. 298) wieder auf eine Notiz, welche auf den Gegenstand Bezug hat. Die Notiz lautet: "Zufolge des Antrags der Unterrichtskommission über den bei ihr zurückgebliebenen Gegenstand der Sittengerichte werden daherige Schriften zu den Akten gelegt." Die gesetzgebenden Räthe sind niemals auf eine Berathung des Entwurfs eingetreten; die Sittengerichte blieben aufgehoben; durch dieses Institut war also in der helvetischen Republik die individuelle Religionsfreiheit niemals beeinträchtigt.
d. Befreiung der Ordensleute vom klösterlichen Verband.
Die Geschichte der Sittengerichte zeigt, dass man die individuelle Freiheit gegenüber kirchlichen Behörden auch für Solche nicht beschränken wollte, welche von ihrer persönlichen Freiheit einen zu masslosen Gebrauch machten. Auf der andern Seite ist anzuerkennen, dass sich das Vollziehungsdirektorium
alle Mühe gab, die Freiheit auch Solchen wieder zu schenken, die darauf verzichtet hatten, — den katholischen Ordensleuten. Das klingt wie eine spöttische Bemerkung über die von den helvetischen Behörden verfügte Aufhebung der Klöster und geistlichen Stifte; allein wir meinen es ganz buchstäblich: die helvetische Regierung unterliess nichts, was geeignet sein konnte, den Ordensmitgliedern den Austritt aus dem Ordensverband möglichst zu erleichtern, und man hat keinen genügenden Grund, zu behaupten, dass sie dabei nur von dem Motiv geleitet worden sei, die Klostergebäude so rasch wie möglich zu entvölkern.
Der Klostergüter hatte sich die helvetische Republik ohnehin schon in rascher Abfolge verschiedener Gesetze und Dekrete versichert. Den 8. Mai 1798 war "das Vermögen aller geistlichen Klöster, Stifte und Abteien von Stunde an mit Sequester belegt worden." Am 18. desselben Monates wurde durch ein Gesetz verfügt, dass über die in den Klöstern vorhandenen Vorräthe an Korn und Wein ein genaues Verzeichniss aufgenommen werden soll und dass die fränkischen Truppen im Thurgau auch fernerhin aus den Klostergütern erhalten werden dürften. Den 20. Juli 1798 wurde die Aufnahme eines genauen Verzeichnisses aller Klosterbewohner dekretirt. und am gleichen Tage das Gesetz erlassen: "Den Klöstern in Helvetien beiderley Geschlechtes soll provisorisch bis auf weitere Verfügung verboten sein, weder Novizen noch Processen anzunehmen." Weitere Verfügungen wurden schon am 17. Sept. erlassen: Die Verwaltung der Klostergüter wird den Verwaltungskammern der betreffenden Kantone übertragen, fähigen Mönchen gestattet, sich um Pfründen zu bewerben, austretenden Ordensmitgliedern eine angemessene Pension zugesichert, aber das Verbot der Novizenaufnahme wiederholt. Den 6. .
Mai 1799 sodann fanden die gesetzgebenden Räthe, es müsse den die Klöster verlassenden Personen angenehmer sein, statt einer jährlichen Pension "für ein und alle Mal ein Kapital zu erhalten, mittelst welchem sie bei ihrer Rückkehr in die Welt ihren Kunst- oder Gewerbsfleiss bethätigen, sich ein gewisses Schicksal verschaffen und so sich über alle Besorgnisse für die Zukunft hinaussetzen können." Das Vollz.-Direktorium wird darum bevollmächtigt, austretenden Ordensleuten unter Vorbehalt der Genehmigung der gesetzgebenden Räthe eine angemessene Aussteuer zu bezahlen. Hievon machten sogleich drei freiburgische Minoritenmönche Gebrauch; jeder erhielt 480 Fr. und die Möbel seiner Zelle, was die gesetzgebenden Räthe den 26. Juni 1799 genehmigten.
jm Uebrigen aber scheinen die Mönche und Nonnen nicht sehr sehnsüchtig nach der Freiheit der Welt gewesen zu sein; denn auch die Massregeln des Vollziehungsdirektoriums, die Ordensleute zum Austritt aus dem klösterlichen Verband zu bewegen, waren von äusserst geringem Erfolg. Das Direktorium vermuthete, es erkläre sich das aus dem Terrorismus, der in den Klöstern über die einzelnen Personen ausgeübt werde. Daher verordnete es den 18. Oct. 1798, dass sich die Unterstatthalter in die Klöster ihrer Bezirke zu begeben, sämmtliche Personen, die zur Korporation gehörten, zu versammeln und denselben das Gesetz vom 17. September, das den Austretenden eine Pension verhiess, vorzulesen hätten. Hierauf sollten sie sofort ein Verzeichniss der Ordensmitglieder aufnehmen, die bereit wären, dem Klosterleben zu entsagen; junge Leute aber, die die Gelübde noch nicht abgelegt hatten, mussten auf der Stelle nach Hause geschickt werden; nur solche durften einstweilen noch bleiben, die sich ihrer Ausbildung wegen in klösterlichen Instituten befanden. Endlich sollte den
im Orden verbleibenden Mönchen und Nonnen unter scharfer Androhung verboten werden, die Austretenden irgendwie zu belästigen. — Auch diese Massregel blieb erfolglos. Bessere Wirkung versprach sich das Direktorium von dem Gesetz, das austretenden Ordensleuten nicht eine Pension versprach, sondern blankes Geld in die Hand gab. Minister Stapfer wollte diesem Gesetze dadurch einen guten Erfolg sichern helfen, dass er in einem von Bronner entworfenen begeisterten Aufruf den Mönchen und Nonnen auseinander setzte, die Zeiten hätten sich geändert, die Voraussetzungen, unter denen die Ordensleute ihre Gelübde abgelegt hätten, seien nicht mehr vorhanden. Darum, "Bürger und Bürgerinnen, die ihr noch Kraft und Muth in euch fühlt, euern Mitmenschen nützlich zu sein, empfanget das Gesetz, welches Alle in den Stand setzet, mit einer Aussteuer in die bürgerliche Gesellschaft zurück zu kehren und euch durch Fleiss und Thätigkeit ein unabhängiges Leben zu bereiten."
Stapfer wusste indessen recht wohl, dass viel wirkungsvoller als dieser Aufruf ein kirchlich er Erlass gewesen wäre, der den Ordensleuten die Klosterpforten geöffnet hätte. Es würde heute Niemanden einfallen, an die Möglichkeit eines solchen Erlasses auch nur zu denken. Aber vor 86 Jahren waren die Verhältnisse anders. Der Minister der Künste und Wissenschaften wandte sich schon unterm 30. Nov. 1798 mit einem von Fischer entworfenen Gesuch an den Fürstbischof von Konstanz, "sich ungesäumt an die höheren kirchlichen Behörden, von denen eine völlige Dispensation von geistlichen Gelübden abhängig sein möge," zu wenden und diese Dispensation insonderheit für die Klostergeistlichen der Konstanzer Diözese zu erwirken. Fast boshaft klingt der Schluss des merkwürdigen Schreibens: "Sie erhalten einen neuen Anlass,
der helvetischen Regierung einen Beweis Ihrer freundschaftlichen, aufgeklärten und klugen Gesinnung zu ertheilen und ich freue mich, Ihnen diese Gelegenheit darbieten zu können. Gruss und Hochachtung!" Weniger wird sich über diese "Gelegenheit" der Fürstbischof selber, Max Christoph Freiherr von Rodt, gefreut haben. Er antwortete unterm 21. Dez. 1798, er nehme an, dass man ihm nichts zumuthe, "was denen Grundsätzen der katholischen Religion und denen Begriffen unserer Kirche unmittelbar entgegenstehe." Er habe "daher die erforderlichen Schritte bei höherer geistlicher Behörde bereits einschlagen lassen, die ihn mit weiterer Gewalt versehen möge, die Klostergelübde nach der Lage derer Umstände entweder aufzulösen, oder in eine solche Form zu bringen, die der allgemeinen Verhältniss und der Gewissensberuhigung einzelner Personen und Individuen angemessen sein mag." Von der höhern geistlichen Behörde, die der Fürstbischof meint, wird sonst in der helvetischen Republik wenig gesprochen. Selbstverständlich verlieh dieselbe dem Konstanzer Bischof die gewünschte Befugniss nicht (Nr. 1343). Ein Jahr später beantragte Stapfer, einen Delegirten, den Luzerner Stadtpfarrer Thaddäus Müller, an den Konstanzer Bischof zu senden und die Angelegenheit mit ihm persönlich verhandeln zu lassen (Nr. 563). Allein Müller war nicht geneigt, eine solche Mission zu übernehmen. Er anerkennt allerdings in einem ausführlichen Schreiben vom 3. Dez. 1799 (Nr 1344), dass ohne kirchliche Genehmigung ein auftretendes Ordensmitglied beim Volk nur Verachtung finde und dass es für die Einzelnen meistens physisch und moralisch unmöglich sei, die Säkularisation zu erwirken. Bezüglich der Berufung der Bischöfe auf den Papst bemerkt er: "Die Regierung befehle den Bischöfen, eine Gewalt, welche sie nicht selber zu besitzen glauben, sich zu erwerben.... Ich finde nicht Vorstellungen
und Ausdrücke genug, um die Regierung dahin zu vermögen, die Säkularisationen für alle helvetischen Klosterleute, welche austreten wollen oder ausgetreten sind, so bald als möglich und mit dem grössten Nachdruck zu betreiben." Er wisse wohl, dass sich im Allgemeinen der Staat um die religiösen Verpflichtungen der Einzelnen nicht kümmere, aber der Staat habe die Ordensmitglieder in Verhältnisse gebracht, die den Wunsch nach Befreiung von den Ordensgelübden nahe legten, und so sei der Staat auch verpflichtet, diese Befreiung zu ermöglichen.
Wie wir gesehen, hatte es schon bisher die Direktorialregierung nicht an bezüglichen Schritten fehlen lassen; einen Monat nach Müller's Brief aber wurde sie gestürzt. Ihre Nachfolgerin liess die Angelegenheit fallen, denn die Erleichterung des Austritts aus einem Orden hatte in einzelnen katholischen Gegenden ebenso grosse Unzufriedenheit erregt wie das Verbot der Novizenaufnahme. Auch der Unterstatthalter Martin Kaiser von Zug äussert in einem Schreiben vom 9. Nov. 1799 grosse Unzufriedenheit darüber, "dass man den Religiosen und Klosterfrauen volle Freiheit gestattet, nach Willkür aus dem Kloster zu treten, einen neuen Stand zu wählen und so ihr Gott gethanes Versprechen zu brechen, ja dass man sogar alles gethan, sie hiezu zu vermögen. Eine Sache ist dieses," fügt der Bürger Unterstatthalter hinzu, "welche schnurgerad wider unsere Religion streitet" (Nr. 563).
Die Unzufriedenheit des katholischen Volkes über die Massregeln, die den Austritt aus einem Kloster hätten möglich machen sollen, ist einer der vielen Beweise dafür, dass, um auf die oben erwähnte Unterscheidung zwischen individueller und kirchlicher Religionsfreiheit zurück zu kommen, das
Volk im Allgemeinen die letztere viel höher schätzte als die erstere. Wenn die helvetische Regierung noch so viele Mönche und Nonnen gegen deren Willen mit Gewalt im Kloster zurück gehalten hätte, so wäre darüber im katholischen Volk gar keine Unzufriedenheit entstanden, wohl aber verursachte es eine bedenkliche Gährung, dass die Regierung zuwider den kirchlichen Satzungen und ohne Einwilligung der kirchlichen Behörden jedem einzelnen Ordensmitglied gestattete, nach eigenem Belieben in die Welt zurück zu kehren.
II. Kirchliche Religionsfreiheit.
a. Gefährdung des dogmatischen und kirchenrechtlichen Lehrgebäudes; Bürgergeld.
Es muss zugestanden werden, dass insbesondere die erste helvetische Regierung, das Vollziehungsdirektorium, die kirchliche Religionsfreiheit wenig rücksichtsvoll behandelte und von derselben nur insoweit Notiz nahm, als politische Gründe dies unbedingt geboten.
Schon der 6. Artikel der helvetischen Konstitution, der von der Religionsfreiheit handelt, konnte schwere Bedenken erregen durch die Sätze "Jeder Gottesdienst steht unter der Aufsicht der Polizei, welche das Recht hat, sich die Lehren und Pflichten , die gepredigt werden, vorlegen zu lassen. Das Verhältniss, in welchem irgend eine Sekte gegen eine fremde Gewalt stehen mag, darf weder auf Staatssachen, noch auf den Wohlstand, noch die Aufklärung des Volkes Einfluss haben." — Welche "Sekte" und welche "fremde Gewalt" die Verfasser der Konstitution vorzüglich im Auge gehabt haben, bedarf
keiner weiteren Erläuterung. Man schrieb sich also von vornherein die volle Berechtigung zu, ohne Rücksicht auf jene "fremde Gewalt" alle staatlichen Gesetze und Verordnungen zu erlassen, die man zur Beförderung des "Wohlstandes und der Aufklärung des Volkes" für nöthig oder zweckdienlich hielt. Neben einer solchen Verfassungsbestimmung hatte die sog. Lehrautorität der Kirche keine civilrechtliche Gültigkeit mehr. Es wurde im Gegentheil die kirchliche Lehrthätigkeit, wie jede andere öffentliche Erscheinung im Volksleben, der bürgerlichen Gewalt unterworfen. Wir werden bald sehen, dass diese Verfassungsbestimmung nicht todter Buchstabe blieb, sondern z. B. in der Kontrolirung der Predigten und dem sog. Placet eine sehr konkrete Gestalt annahm.
Man konnte von derselben noch viel Schlimmeres befürchten. Waren es denn nicht Freunde der französischen Revolution, die die Verfassung entworfen, und hatte man denn in Frankreich nicht alle Religion abgeschafft?! Thatsächlich fürchtete man vor 86 Jahren, namentlich in einzelnen Theilen der katholischen Schweiz, durch die Franzosen die Religion zu verlieren. Nach den Schreckenstagen von Stans sollen die Leute freilich geklagt haben: "Die Franzosen haben uns Alles geraubt; nur die Religion haben sie uns gelassen!" Anderthalb Jahre später hat indessen auch der Berner Kirchenrath das Direktorium der "überdachtesten Zerstörungsentwürfe" zur Beseitigung der christlichen Religion beschuldigt, aber doch keine einzige Thatsache erwähnt, aus der hervorginge, dass Jemand an der Verkündigung des Evangeliums verhindert worden sei.
Gerade der Minister, dem die Aufsicht über die kirchlichen Dinge übergeben war, Stapfer, erklärt in seinen "Bemerkungen", mit denen er die Klagen des Berner Kirchenrathes
auf ihr richtiges Mass zurück führt: "Seid überzeugt, helvetische Religionsdiener aller Klassen, Bekenntnisse und Grade, dass mir nie nur der geringste Gedanke aufstieg, der christlichen Kirche irgend eine Neuerung aufzudrängen oder mich als Werkzeug irgend eines theophilanthropischen Umbildungs-Planes des Christenthums gebrauchen zu lassen" (S. 60). Sein ganzer bisheriger Lebenszweck sei gewesen, "das Christenthum, und zwar nicht diesen oder jenen Philosophismus, sondern das wahre Christenthum des Neuen Testamentes.... zu empfehlen und zu vertheidigen." Seine Freunde wüssten es, dass er bei jeder Gelegenheit, schriftlich und mündlich diese Vertheidigung gewagt habe "vor deutschen Aufklärungströddlern wie vor pazifischen Religionsspöttern" (S. 47). Gleichwohl verwundern wir uns gar nicht darüber, dass man insbesondere den Minister Stapfer beschuldigte, er wolle die Philosophie an die Stelle der christlichen Offenbarungsreligion setzen. Man konnte sich bei dieser Beschuldigung auf die Thatsache berufen, dass Stapfer bei jedem Anlass erklärte, der Religionsdiener komme für den Staat nur in so weit in Betracht, als er ein Morallehren sei. Unterm 15. October 1798 erliess er an die gesammte helvetische Geistlichkeit sogar eine Art Hirtenbrief, in welchem er diese Anschauung ausführlich entwickelte (Nr. 1342). Zunächst wird im Geiste der kantischen Philosophie das Dasein Gottes gelehrt. Der Glaube daran sei die Voraussetzung der Moralität in der Welt. Zur Belebung und Erhaltung des Glaubens bedürfe man einer Anstalt, der Kirche. Aber der einzige Zweck, den die Kirche zu verfolgen habe, sei Pflege der Moralität. Jede Religionsübung, die diesem Zwecke nicht diene, sei ein "unwürdiges und unsittliches Spiel". Schliesslich fordert er die Geistlichen auf, diesen Grundsätzen besonders an den kirchlichen Festtagen nachzuleben.
Stapfer war auf Grund dieser Anschauung gar nicht damit zufrieden, dass im Beschluss, durch welchen für die reformirten Mitglieder der helvetischen Behörden in Luzern protestantischer Gottesdienst eingeführt wurde, ausdrücklich auf die bestehende konfessionelle Verschiedenheit Rücksicht genommen war. Diese Verschiedenheit gehe den Staat nichts an. Der Staat habe sich bloss um die Moralität der Bürger zu kümmern und für ihn seien die Geistlichen einfach Lehrer der Moral. Glaube ein Geistlicher, die Moralität auf religiöser Basis befestigen zu können, so sei das seine Sache. Er würde jedem Pfarrer bei der Amtseinführung sagen Citoyen, la république, pour se conserver.. n'a besoin ni de tes dogmes, ni de tes rites, ni des autres particularités quelconques du culte dont tu es ministre, mais elle a besoin d'une bonne morale.... et ce n'est qu'en enseignant la morale et en servant la cause sacrée de la vertu que tu t'acquitteras de ta dette envers la patrie, et que la République pourra te considérer comme un de ses fonctionnaires (Nr. 563).
Dem Volke, ja auch der Geistlichkeit konnte Stapfer's Belehrung über die richtige Auffassung des Christenthums ebensowenig Vertrauen einflössen wie der Indifferentismus Laharpe's. Dies würde auch dem P. Girard, der in Stapfer's Ministerium angestellt war, nicht gelungen sein. Er trat zwar z. B. mit ganzer Seele dafür ein, dass man den christlichen Religionsunterricht nicht aus der Schule verdränge. Allein seine Vertheidigung des Christenthums mochte gewissen kirchlichen Parteien fast noch gefährlicher erscheinen als der Indifferentismus des von Laharpe geleiteten Direktoriums. Man höre seine eigenen Worte: Si l'on veut confondre le christianisme avec toutes ces décorations gothiques, toutes ces pratiques superstitieuses, ces extravagances, ces
maximes intolérantes et impures que les vices et l'ignorance des hommes y ont ajouté depuis sa naissance: alors j'hésiterai de dire s'il ne vaudrait pas mieux le mettre dans l'oubli que de l'enseigner encore. Mais si l'on entend parler du christianisme dans sa simplicité et sa pureté primitive, alors je confesserai hautement que de l'écarter de l'enseignement public, ce serait porter le coup le plus funeste à la vertu, aux moeurs, à la société (Nr, 1422).
Wenn also auch die Männer, die an der Spitze der helvetischen Republik standen, nicht so Schlimmes anstrebten, wie vielfach befürchtet wurde, so ist es doch keineswegs auffallend, dass Viele die neue Ordnung der Dinge als eine Gefahr für die Religion in Helvetien ansahen und desshalb zauberten, den durch die Verfassung geforderten Bürgereid zu leisten. Das war namentlich bei einem grossen Theil des katholischen Klerus der Fall. Die gesezgebenden Räthe wussten das zum Voraus und fügten darum dem Gesetz vom 12. Juli 1798, durch das die Eidesleistung angeordnet wurde, die ausdrückliche Bemerkung bei, "die Diener der Religion seien von der Pflicht der Eidesleistung nicht ausgenommen." Die Weigerung, dieser Pflicht nachzukommen, zog den Verlust des Aktivbürgerrechtes nach sich. Obwohl das für Solche, denen man ohnehin das Aktivbürgerrecht genommen hatte, keine schwere Strafe war, wurde doch der Eid in den französischen Theilen Helvetiens geleistet. Der Bischof von Lausanne hatte nämlich unterm 2. August einen Hirtenbrief veröffentlicht, in welchem er den Katholiken die beruhigende Erklärung gab, der Eid sei nicht gefährlich, denn die französischen Generäle hätten versprochen, die Religion werde nicht genommen; auch forderten die helvetischen Behörden keinen Verzicht auf die Religion und selbst wenn sie
den Eid in diesem Sinne forderten, so verständen ihn die Katholiken beim Schwören nicht in diesem Sinne (Nr. 534). Die Konstanzer Kurie verschmähte diese feine reservatio mentalis und bat den 11. August 1798 um die Erlaubniss, der Eidesformel die Klausel beifügen zu dürfen "unnachteilig der katholischen Religion" (Nr. 534). Das Gesuch wurde unterm 22. August 1798 wiederholt, aber vom Direktorium abschlägig beschieden Da nun der über den Rhein geflüchtete päpstliche Nuntius dem mit ihm in Beziehung stehenden Klerus förmlich verboten hatte, ohne Klausel zu schwören (Nr. 851, Schreiben des Abtes von Rheinau an den Abt von St. Gallen vom 14. August 1798), wurde der Eid von vielen katholischen Geistlichen verweigert. Um "die Geistlichen, welche Helvetien noch als seine Söhne anerkennen könne, von denen zu unterscheiden, die es als seine ärgsten Feinde aus seinem Schoosse werfen müsse", verordneten unterm 17. September 1798 die gesetzgebenden Räthe, dass die noch nicht beerdigten Geistlichen durch die Regierungsstatthalter abermals zur Eidesleistung aufgefordert und im Falle der Weigerung augenblicklich über die Grenzen Helvetiens gebracht werden sollten. Der Pfarrer von Bünzen, der einige Regierungsagenten im Kanton Baden hatte bewegen können, den Vorbehalt zu gestatten, wurde abgesetzt, und die Klostergeistlichen von Muri und Andere, die nur bedingt geschworen hatten, durch Direktorialbeschluss vom 26. September 1798 aufgefordert, den Eid ohne Klausel zu wiederholen. So wurde endlich auch der katholische Klerus der deutschen Schweiz mit geringen Ausnahmen für die neue Ordnung der Dinge in Eid und Pflicht genommen. Indessen wird man annehmen dürfen, dass Viele, welche der Eidesformel eine Klausel beizufügen wünschten, nun nur mit geheimem Vorbehalt geschworen haben, der "Sache der Freiheit und Gleichheit anzuhangen."
Solche Katholiken, für welche die Grundsätze des kanonischen Rechts einen integrirenden Bestandtheil der katholischen Religion bilden, hatten allerdings in der helvetischen Republik oft Veranlassung, über Gesetze und Verordnungen zu klagen, welche der Religion zuwider waren. Hierhin gehört das Gesetz vom 2. August 1798, das alle Verordnungen der früheren Regierungen aufhebt, durch welche die sogen. gemischten Ehen verboten oder erschwert waren, das Gesetz vom 31. August 1798, durch welches die Immunität der Geistlichen aufgehoben und diese in allen Sachen der bürgerlichen und peinlichen Gerechtigkeitspflege den staatlichen Behörden unterworfen wurden, das Gesetz vom 17. October 1798, das die Ehe zwischen Geschwisterkindern erlaubt, ebenso die Verordnung nach welcher Ehestreitigkeiten vor die bürgerlichen Gerichte zu bringen waren. Letztere Massregel erweckte besonders grosse Unzufriedenheit. Im Tone höchster Entrüstung schreibt z. B. der Unterstatthalter des Distriktes Zug unterm 9. Nov. 1799 an's Direktorium: "Man hat uns Verordnungen zugeschickt, welche die Religion des Glaubens widrig verwirft. Man hat uns in Ehehändeln an weltliche Beamte, als wenn sie hierin Richter wären oder sein könnten, gewiesen, damit sie dieselben schlichten möchten. Es scheint also, man wolle nach und nach alles der weltlichen Obrigkeit unterwerfen, da doch bei Katholiken in Religionssachen oder in Sachen, welche einen Bezug haben (auf Religion) . einzig die geistliche Obrigkeit zu reden hat und zu hören ist. So redt man im Distrikt Zug und so redt man, wie ich vernehme, in andern Distrikten des Waldstetter Kantons... Daher, will man willige, gehorsame und geneigte Mitbürger unter den Katholiken haben, so muss man ihre Religionsdiener, die unumgänglich nothwendig, — und die Ordensgeistlichen, die zu grossem Nutzen sind, wohl
behandeln; man muss sie als den fürnehmsten Theil begünstigen und ihre Fortdauer so viel möglich befördern. — Man muss endlich sich in das, was ins Religionsfach einschlägt, nicht im Geringsten einmischen, weil hierin einzig die Kirche und die Bischöfe die rechtmässigen Obern sind" (Nr. 568).
Einen andern Rath gibt, was Ehesachen betrifft, der bischöfliche Kommissarius Müller von Luzern in seinem Memorandum vom 3. Dezember 1799. Er verhehlt auch seinerseits nicht, dass die bürgerliche Ehegesetzgebung bei Katholiken viel Bedenken errege. Es gebe sogar Bezirksgerichte, die immer noch Skrupel hätten, Ehestreitigkeiten zu behandeln. "Es sagt nämlich", fährt er fort, "ein ausdrücklicher Lehrsatz unserer Kirche, dass die Ehehändel nicht sollen vor die weltlichen Gerichte gezogen werden, und sogar wurde alle Jahre zwei Mal in unserer Diözese von öffentlicher Kanzel in allen Kirchen verkündet, dass unter Strafe des geistlichen Bannes niemand als das bischöfliche Gericht die Ehesachen vor seinen Gerichtszwang ziehen dürfe. Wie leicht könnte ein unbescheidener Geistlicher in einer sonst ruhigen Gemeinde mit dieser Lehre die Zweytracht und den fanatischen Eifer auf's neue erwecken!" Müller meint nun, am leichtesten könnten die Schwierigkeiten dadurch gehoben werden, dass man die sog. klandestinen Ehen untersage und jedes Eheverlöbniss, das nicht ordentlich vor dem Pfarrer und vor Zeugen gefeiert worden sei, als ungültig erkläre. Die Ehehändel rührten nämlich meistens von leichtsinnig und geheim abgeschlossenen Eheverlöbnissen her. Wäre diese Quelle der Ehestreitigkeiten verstopft, so kämen nur noch die Ehescheidungsgeschichten in Betracht, die aber selten seien. Es sollte die Regierung auch den Bischof ersuchen. die geheimem Eheversprechen als ungültig zu erklären (Nr. 1341). — Auch die dem Direktorium folgenden helvetischen Exekutivbehörden
hatten manchen Konflikt mit den Bischöfen bezüglich der Jurisdiktion in Ehesachen; sie blieben aber bei den von den helvetischen Räthen erlassenen Gesetzen und Dekreten. Ein zwingender Grund, dieselben zu ändern, lag auch desswegen nicht vor, weil der Justizminister, wie Mohr im Januar 1801 erklärt, "nirgends verbietet, dass die Parteien sich nicht (sic!) vor ihrem geistlichen Richter stellen sollen, um nach ihrer Gewissensüberzeugung der Ehe im Verhältniss zur Kirche und zur Religion die nöthigbeglaubte Vollständigkeit zu geben."
b. Handhabung der Kirchendisziplin durch die bürgerlichen Behörden.
Die Behörden der helvetischen Republik haben sich auf keine Diskussion darüber eingelassen, welches die richtigen Grenzen. zwischen staatlicher und kirchlicher Jurisdiktion seien, sondern einfach die eigene Gerichtsbarkeit auf jede Erscheinung des öffentlichen Lebens ausgedehnt, die in ihren Augen für die Gesellschaft von Bedeutung war. Viel zahlreicher als die prinzipiellen Eingriffe in das Gebiet kirchlicher Dogmen und kirchenrechtlicher Satzungen sind darum auch die praktischen: Massregeln, welche die helvetische Regierung in Fällen zu treffen für gut fand, die in das Gebiet der Kirchendisziplin gehören. Auch da hätte man jeweilen, namentlich auf katholischer Seite, Veranlassung gehabt, über Beeinträchtigung der kirchlichen Freiheit zu klagen. Allein man war im Allgemeinen von den früheren Regierungen her zu sehr daran gewöhnt, in solchen Dingen die väterliche Hand der "gnädigen Herren und Oberen" zu spüren, als dass es dem Volke auffällig erschienen wäre, wenn nunmehr die Bürger Direktoren oder die Bürger Minister oder die Bürger Vollziehungsräthe die Kirchendisziplin handhabten. Das helvetische
Archiv enthält über diesen Punkt eine erstaunliche Menge Material. Wir müssen uns darauf beschränken, einige für die damaligen Verhältnisse charakteristische Vorgänge zu erwähnen.
Den 20. Aug. 1799 entsetzte das Vollziehungsdirektorium den Bürger Roman Heer, katholischen Pfarrer in Basel, seines Amtes, weil derselbe einer im Elsass nach französischem Gesetze bürgerlich kopulieren Frau im Beichtstuhl die Absolution, nach der Niederkunft die Aussegnung und die Lesung von zwei Messen verweigert und ihr überdies zugemuthet hatte, so lange vom Manne zu gehen, bis derselbe sich vor ihm, dem Pfarrer von Basel, in kirchlich gültiger Weise kopulieren lasse. Der Pfarrer war ohne alle Mitwirkung von Seiten der bürgerlichen Behörden von der Gemeinde gewählt und besoldet. Diese trat bei den gesetzgebenden Behörden einstimmig für ihren Pfarrer ein. Thatsächlich wurde von denselben das Vollziehungsdirektorium den 17. Oct. 1799 eingeladen, die Gründe der Absetzung anzugeben. Den Räthen schien die Absetzung nicht gerechtfertigt; den 17. Dez. 1799 annulierten sie den Beschluss des Direktoriums, denn Bürger Heer habe der Vollziehung der betreffenden Ehe "keine Hindernisse als bürgerlichem Kontrakte, sondern nur geistliche (Hindernisse) als ungültigem Sakramente" in den Weg gelegt und auch diese seien nur von der Art gewesen, "dass sie zur Beruhigung für ihn, den Seelsorger, sowohl als für die Beichtkinder leicht hätten können gehoben werden." Ausserdem seien Kirchendiener, "wenn sie die Ruhe und Sicherheit des Staates stören oder sich gegen die Gesetze vergehen, dennoch nach den gleichen Rechten und Gesetzen wie andere Bürger" anzuklagen, zu beurtheilen und zu bestrafen (also nicht einfach auf administrativem Weg des Amtes zu entsetzen). — Stapfer war mit
diesem Entscheid sehr unzufrieden. In einem neun Folioseiten umfassenden Gutachten vom 24. Dez. 1799 widmet er der Angelegenheit eine prinzipielle Erörterung. Die Republik könnte den Klerus als einen Theil der öffentlichen Verwaltungsbehörden betrachten. Das scheine wirklich der Fall zu sein; der Staat bestimme ja die Wahlart der Geistlichen; er besolde sie; ja, fügt er satyrisch bei, er gehe so weit, sie zu Inspecteurs nés de toutes les écoles chacun dans sa paroisse, zu machen — sûr moyen de ne jamais voir se perfectionner l'instruction élémentaire. Und nun soll die Aufsicht über die Geistlichen als solche den Staat nichts angehen?! —Stapfer selbst und mit ihm auch Rengger, Minister des Innern, betrachteten freilich die Kirche nur als Privatgesellschaft, die den Schutz der Gesetze geniesse, pourvu qu'elle se soumette aux réglements de police et que ces rites ou dogmes soient compatibles avec l'ordre civil établi et avec la moralité du peuple. Nach dieser Anschauung sei auch der Geistliche nur eine Privatperson und sofern er sich eines Vergehens schuldig mache, dem gewöhnlichen Richter zu überweisen. Ein Vergehen habe der Pfarrer von Basel sicher verübt, indem er den Mann der betreffenden Frau eines Rechtes beraubte, auf das er gesetzlichen Anspruch hatte. Dass nun gleichwohl der Pfarrer vom Direktorium und nicht von einem Gericht zur Rechenschaft gezogen wurde, habe seinen Grund in politischen, nicht eigentlich in rechtlichen Erwägungen. Die katholische Religion könne in den Händen unwissender und fanatischer Priester nur zu leicht "ein plausibler Vorwand und gefährliches Instrument fortwährender Opposition gegen die politischen Gesetze des Landes werden." Eine Besserung könne nur von den geistlichen Obern ausgehen und werde erst eintreten, wenn die Katholiken des
Landes keinen auswärtigen Kirchenfürsten mehr unterworfen, sondern national organisirt seien. Die Regierung befinde sich gegenwärtig in der allerschlimmsten Lage. Si le Directoire se permettait la centième partie de ce que Joseph II. s'est permis: les conseils — er meint die Conseils législatifs — crieraient à l'aéantissement de la religion catholique romaine. Um nun in der Angelegenheit des Pfarrers von Basel wenigstens nicht ganz zu unterliegen, schlägt Stapfer vor, sich an die kirchlichen Behörden zu wenden und durch deren Vermittlung die fernere Wirksamkeit des Bürgers Heer in Basel unmöglich zu machen. Dabei könne man auch auf die Nähe Frankreichs hinweisen, dessen Gesetze Heer missachte u. s. w. — Allein das Direktorium antwortet dem Minister unterm 4. Jan. 1800, nach den Beschlüssen der gesetzgebenden Räthe bleibe nichts übrig, als die Angelegenheit fallen zu lassen; Stapfer möge daher dem inzwischen nach Solothurn übersiedelten Bürger Roman Heer melden, dass seiner Rückkehr nach Basel kein Hinderniss im Wege stehe (Nr. 566).
Gleichen Misserfolg hatte Stapfer mit der Absetzung der Pfarrer von Breitenbach, Beinwyl und Erschwyl im Kanton Solothurn. Auch diese Gemeinden petitionirten bei den gesetzgebenden Räthen um Belassung ihrer Pfarrer (Sept. 1799). Der Pfarrer Edmund Bürgi von Breitenbach bekundete dabei eine rührende Loyalität. Er schreibt dem Direktorium: "In Ihren oder deren Bevollmächtigten Ministers Händen liegt es Pfarrer abzudanken und andere an dero Stelle zu setzen. Ich verehre die Hohen Befehle. Jez noch wie allzeit verbleib ich gesetzliebender Bürger, der allem dem, was die neue Ordnung befihlt, sich unterwirft und nachzuleben gesinnt ist." Die Seelsorge sei sein "Lieblingsgeschäft" und falls man ihn für
würdig halte, länger Pfarrer einer Gemeinde zu sein, werde er, wie bisher, seine Pflicht streng erfüllen. Zur Berichterstattung eingeladen, warum diese Pfarrer abgesetzt worden seien, rechtfertigt sich unterm 13. Sept. 1799 das Direktorium gegenüber den gesetzgebenden Räthen mit der Mittheilung, es handle sich um Mönche des Klosters Mariastein, deren Abt zu den Oesterreichern gegangen und deren Gegenwart an der französischen Grenze zu mannigfachen Reklamationen Seitens der französischen Behörden Veranlassung gegeben habe (Nr. 567). Unterm 24. Dez. klagt Stapfer darüber, dass man in den gesetzgebenden Räthen unter dem stürmischen Beifall der ganzen Versammlung gegen den Despotismus des Direktoriums "deklamire", aber doch nun die Sache liegen lasse. Das Dekret des Vollziehungsdirektoriums wurde nicht annulliert; aber die abgesetzten Pfarrer blieben auf ihren Posten (Nr. 566).
Die nachfolgenden Executivbehörden verfuhren übrigens in diesen Dingen nicht viel sanfter. Unterm 10. Mai 1800 denunciren fünf Geistliche beim Regierungsstatthalter des Kantons Luzern den Vikar Gut von Buttisholz, der anlässlich eines sog. Kreuzgangs in Wohlhausen in einer vor grosser Volksmenge gehaltenen Predigt die Regierung heftig angegriffen hatte. Namentlich hatte Gut der Regierung zum Vorwurf gemacht, dass sie den Geistlichen keine Besoldung mehr gebe. Man beabsichtige, sagte er, die Priester durch Schulmeister zu ersetzen. Die Predigt machte grossen Eindruck auf das Volk; die klagenden fünf Geistlichen schreiben: "Wir bekennen es Ihnen gerade von der Brust weg, dass, wenn Jeder ungeahndet daher schwätzen kann, was ihn gelüstet, wir gar keine Lust mehr haben, neben einem fanatischen Dummkopf für öffentliche Ruhe und Ordnung zu arbeiten, der in einer Stunde niederreisst, was wir mit vielem Fleiss und möglichster Behutsamkeit
in einem Jahre aufgebaut haben" (Nr. 564). Die Sache gelangte schliesslich vor den Vollziehungsausschuss, der den 21. Juni 1800 dem Vikar Gut für ein Jahr lang in der ganzen helvetischen Republik die Ausübung des Lehramtes untersagte und ihn anwies, "sich während dieser Zeit mit den Pflichten eines Volkslehrers gegen die wirklich bestehende Obrigkeit besser bekannt zu machen und sich nach Umlaufs eines Jahres vor demjenigen Kirchenrath zu einer neuen Prüfung zu stellen, an welchen ihn der Minister der Wissenschaften zu weisen für gut finden werde" (Nr. 566).
Aber viele andere Geistlichen beider Konfessionen machten sich ähnlicher Vergehungen schuldig. Den 7. Nov. 1800 schreibt der Vollziehungsrath an den Minister der Wissenschaften, er habe in Erfahrung gebracht, dass öffentliche Religionslehrer "sich bei ihren Kanzelvorträgen und andern geistlichen Unterhaltungen mit politischen Gegenständen auf eine Weise befassen, wodurch die Gemeindemitglieder nicht sehr erbaut, ihnen vielmehr die offenbarsten Wahrheiten entstellt und selbst Grundsätze von grösster Wichtigkeit verdächtig gemacht werden." Der Minister der Wissenschaften werde daher beauftragt, einen Dekretsentwurf auszuarbeiten, "wie diesem gemeinschädlichen Missbrauch beim Volksunterricht gesteuert und der Religionslehrer in die Grenzen seines Berufes zurück gewiesen werden könne" (Nr. 1342).
Zu einem neuen gesetzlichen Erlass über diesen Punkt kam es nicht. Es war auch nicht nothwendig. Man hatte schon in ältern Gesetzen und Dekreten eine hinreichende Handhabe, aufrührerischen Geistlichen entgegen zu treten; lautet ja doch §6 eines Gesetzes vom 28. April 1799 folgendermassen: "Jeder Pfarrer einer aufrührerischen Gemeinde verliert auf der Stelle seine Pfründe, wenn er nicht beweisen kann, dass
er alles Mögliche angewandt habe, um den Aufruhr zu verhüten" (Nr. 1337).
Auch gegenüber den höhern kirchlichen Behörden machte die helvetische Centralregierung ihr staatliches Oberaufsichtsrecht von Anfang an geltend. Das Vollziehungsdirektorium hielt sich an die Weisung der gesetzgebenden Räthe vom 7. Sept. 1798, "gegen fremde und einheimische Emissarien und Aufwiegler, auch gegen Verbreitung aufrührerischer und verläumderischer Schriften aller Art in ganz Helvetien die kräftigsten und zweckmässigsten Massregeln zu ergreifen."
Auf Grund dieses Dekretes wurden namentlich auch die öffentlichen Kundgebungen kirchlicher Behörden strenge überwacht. Beim Herrannahen der Fastenzeit des Jahres 1799 suchte der bischöfliche Kommissar Müller zu Luzern um die Erlaubniss nach, einen aus drei Zeilen bestehenden bischöflichen Erlass an den Kirchthüren der Stadt Luzern anschlagen zu dürfen. Das Edikt enthielt einfach die Erklärung, dass in der Stadt Luzern an allen Samstagen des Jahres mit einziger Ausnahme des Charsamstags das Fleischessen gestattet sei. Das Vollziehungsdirektorium ertheilte denn auch den 26. Jan. 1799 die Erlaubniss zur Publikation der Dispense. Gleichzeitig wurde aber eine Untersuchung angeordnet darüber, auf wessen Befehl das Aktenstück bereits an einigen Thüren angeschlagen sei. Der Justizminister berichtet den 2. Febr., es sei voreilig durch den bischöflichen Kommissar selbst geschehen. Aehnliches werde aber in Zukunft nicht mehr vorkommen (Nr. 564).
Derartige Verstösse waren in der zweiten Periode der helvetischen Republik nicht mehr so leicht möglich.
Der Vollziehungsausschuss erliess nämlich in Folge eines heftigen Hirtenbriefes des Bischofs von Lausanne, in welchem Joseph II. beschuldigt wurde, die Häresie in's Heiligthum
verpflanzt zu haben, unter'm 5. Febr. 1800 das förmliche Dekret, dass Bischöfe, bischöfliche und päpstliche Kommissarien, Dekane und Kirchenrathe ihre Hirtenbriefe, Kreis- und Pastoralschreiben, religiöse Ermahnungen und andere Schriften dieser Art vor der Bekanntmachung den Regierungsstatthaltern der betreffenden Kantone vorzulegen hätten; sofern diese fänden, dass die Publikation zu beanstanden sei, müssten die Erlasse der vollziehenden Gewalt übermittelt werden; letzteres habe immer zu geschehen, wenn ein Erlass für mehr als einen Kanton bestimmt sei (Nr. 563). Dieses Dekret interpretierte der Vollziehungsausschuss den 26. Febr. 1800 allerdings in dem Sinne, dass Erlasse der geistlichen Obern an die Mitglieder des Klerus frei cirkuliren dürften. Allein er sah sich bald veranlasst, diesen Beschluss thatsächlich wieder zurückzunehmen.
Der Pfarrer Hübscher von Muri im Kanton Baden hatte zwei Broschüren drucken lassen, die die Titel führten: "Kann man zugeben, dass den Mönchen überhaupt Seelsorge überlassen werde?" und "Erläuterungen über die altkatholische Antwort auf die neukatholische Frage." Hübscher war der Ansicht, die Klostergeistlichen seien von jeder Pastoration auszuschliessen. Die kleinen Schriften machten sehr grosses Aufsehen. Der Regierungsstatthalter von Luzern, Vincenz Rüttimann, meldete den 13. Mai 1800 dem Vollziehungsausschuss, es herrsche seit einiger Zeit eine gefährliche Spaltung unter der Geistlichkeit des Kantons. "Sie definiren sich", fügt er wörtlich bei, "die Neukatholischen und Altkatholischen; ich wollte sie lieber die Vernünftigen und Fanatischen nennen. Ein lebhafter Federkrieg begann, dessen Feuerstoss auch die Hütte des friedlichen Landmanns zu entzünden droht". Zur Vollziehung geeigneter Gegenmassregeln empfiehlt er das Haupt
der damals sog. Neukatholischen, den Kommissar Thaddäus Müller (Nr. 564).
Dieser war es gerade, der dem Justizminister ein Rescript übermittelte, mit welchem sich die bischöfliche Kurie von Konstanz, ohne das Placet eingeholt zu haben, in den Streit gemischt hatte. Es handelte sich um eine Zuschrift des geistlichen Rathes von Konstanz an die Kommissarien der Diözese. Hübscher's Schriften wurden darin als "irrig, anstössig und beleidigend" bezeichnet und die Geistlichkeit aufgefordert, der Verbreitung derselben nach Kräften zu wehren (Nr. 1344). Der Justizminister referiert darüber den 10. Juni 1800 dem Vollziehungsausschuss; er sah in dem Vorgehen der Konstanzer Kurie eine Verletzung der Gewissensfreiheit und der Pressfreiheit und eine unberechtigte Einmischung in die öffentliche Polizei. Bereits stellt er die Frage, ob es nicht zeitgemäss wäre, sich von der Konstanzer Diözese loszulösen (Nr. 563).
Auch Stapfer begutachtet den 23. Juni 1800 die Angelegenheit. Auf seinen Antrag verbietet der Vollziehungsausschuss den 4. Juni 1800 den bischöflichen Kommissarien die Uebermittlung des bischöflichen Erlasses an die Mitglieder des Klerus und diesen den Vollzug derselben. — Aber noch mehrere Monate lang hielt die kleine Geschichte die Gemüther in gewaltiger Aufregung. Es wurden nämlich nun in allen katholischen Theilen der deutschen Schweiz durch die Regierungsstatthalter und Unterstatthalter Verhöre mit den Geistlichen angestellt, die ihren Pfarrgenossen von dem Erlass der Konstanzer Kurie bereits Kenntniss gegeben und irgend etwas zur Unterdrückung der Broschüre des Pfarrers Hübscher gethan hatten. Die Regierung schadete sich damit weit mehr als ihr das bischöfliche Edikt selbst jemals zu schaden vermocht hätte. Auch Geistliche, die sich mit der neuen Ordnung der Dinge
ausgesöhnt hatten, fingen an, unwillig zu werden. Charakteristisch ist z. B., was der Dekan Diethelm von Altendorf unterm 8. Sept. 1800 dem Regierungsstatthalter des Kantons Linth schreibt: "Wahrhaft, es kam mir recht fremd vor, dass unsere helvetische Regierung den Bischöfen das von dem höchsten Gesetzgeber anempfohlene und übergebene Pasce oves meas... confirma frates tuos so glatterdingen streitig machen und dieselben in ihrem wesentlichen Hirten- und Lehramte hemmen wollte, da doch die katholische Religion und die freie ungehinderte Ausübung derselben vermittelst der Konstitution so ausdrücklich garantirt wurde. Uebrigens will ich mir als ein ehrlicher rechtschaffener Bürger, welcher immer in Worten und Werken die neue Ordnung der Dinge öffentlich vertheidigte, derley missbeliebige oberkeitliche Neckereyen feierlichst bescheiden haben" (Nr. 1344).
Dieser Konflikt nahm aber schliesslich ein gutes Ende. Den 28. Juli 1800 richtete der neue Fürstbischof von Konstanz, Karl Theodor Freiherr von Dalberg, an die helvetische Regierung ein sehr freundliches Schreiben, in welchem er versprach, als Bischof und Fürst die guten Beziehungen mit Helvetien aufrecht erhalten zu wollen (Nr. 563). Bevor er den ersten Hirtenbrief veröffentlichte, ersuchte er durch den Kommissar Müller in förmlicher und höflicher Weise den helvetischen Vollziehungsrath um sein Placet (10. April 1801). Dieser antwortete "Die Regierung gibt ihre Zustimmung zur Publikation einer so lehrreichen und merkwürdigen Schrift mit wahrem Vergnügen. So wenig ihr etwas Edelgedachtes von einem Dalberg unerwartet sein kann, so angenehm ist es ihr doch, auch hier ihre Erwartung so schön befriedigt zu sehen. Auch von der loyalen Art, wie das Placet eingeholt wurde, ist die Regierung angenehm berührt." Müller meldet dies nach Konstanz
und erhält darauf wieder eine äusserst verbindliche Antwort (30. April 1801, Nr. 1344). Der Friede mit Konstanz war hergestellt.
Der Papst war weniger nachgiebig als der Bischof von Konstanz. Den 3. April 1801 theilt der Justizminister Meier dem Unterrichtsminister Mohr mit, dass er vom Regierungsstatthalter von Luzern eine Encyklika Pius' VII. erhalten habe. Für die Publikation sei kein Placet eingeholt worden; demgemäss habe der Regierungsstatthalter alle noch vorhandenen Exemplare "fasteten" lassen. Dieses Verfahren wurde gebilligt und der Regierungsstatthalter des Kantons Luzern beauftragt, dafür zu sorgen, "dass kein weiterer Missbrauch wie z. B. durch Verlesung von den Kanzeln" mit dem päpstlichen Kreisschreiben getrieben werde (Nr. 1344).
c. Beschränkung der Kirchenregierung.
I. Stellung der helvetischen Republik zur päpstlichen Autorität.
Die vielen disziplinären Massregeln, welche die helvetische Regierung gegen Geistliche sogar in Fällen ergriff, in denen es sich uni rein kirchliche Dinge handelte, bekunden schon hinlänglich, dass die kirchlichen Verwaltungsorgane in der Zeit der Helvetik sehr in den Hintergrund getreten waren und kaum noch Gelegenheit fanden, ihre frühern Befugnisse auszuüben.
In den protestantischen Landeskirchen machte sich dies viel weniger fühlbar, weil dieselben von jeher daran gewöhnt waren, mit der Landesregierung in allen administrativen Dingen in unmittelbarster Beziehung zu stehen. Indessen beklagt sich der Berner Kirchenrath unterm 14. Jan. 1800 doch auch bitter darüber, "dass man die vorigen kirchlichen Behörden nicht
anerkannte und es bloss stillschweigend duldete, dass sie die Besorgung der religiösen Angelegenheiten ohne einige Leitung und Handbietung fortsetzten."
Weit lebhafter musste die Schwächung und Beschränkung, um nicht zu sagen Sistirung der Kirchenregierung auf katholischer Seite empfunden werden. Wenn schon die Ignorierung der evangelischen Kirchenräthe aus der Absicht erklärt wurde. das Christenthum in Helvetien auszurotten, so wurde die Zurückdrängung der Regierungsorgane in der katholischen Kirche vielfach geradezu als ein direkter Angriff auf die Religösen gedeutet. Welches ist aber die Stellung, die in der helvetischen Republik den Autoritäten der katholischen Kirche eingeräumt wurde?
Wir beginnen mit dem Papst.
Von Beziehungen zwischen der helvetischen Republik und dem Papst kann kaum gesprochen werden. Sofern zu den wesentlichen Bedingungen kirchlicher Religionsfreiheit in einem Land auch das gehört, dass von der Landesregierung der römische Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche anerkannt und in allen die Kirchenregierung betreffenden Fragen gehört und berücksichtigt wird, hat in der helvetischen Republik die Religionsfreiheit für die Katholiken nicht existirt.
Der sonst in Luzern residirende päpstliche Nuntius hatte sich zur Zeit der helvetischen Staatsumwälzung nach Memmingen in Schwaben geflüchtet und die Besorgung der Geschäfte dem damaligen bischöflichen Kommissar Krauer übertragen. Allein den 28. Sept. 1798 zeigte das Vollziehungsdirektorium dem Bischof von Konstanz an, Krauer habe das Vertrauen der Regierung verloren, der Bischof sei ersucht, das Amt eines Kommissars dem Stadtpfarrer von Luzern, dem Bürger Thaddäus Müller, zu übertragen. Das Ordinariat von Konstanz
bewilligte das Gesuch, wofür ihm unterm 8. Nov. 1798 das Vollziehungsdirektorium seine volle Satisfaktion aussprechen liess. — Allein jetzt gab es zwei Kommissarien; denn Krauer funktionierte nunmehr in der Eigenschaft eines päpstlichen Kommissars neben Thaddäus Müller und begreiflicher Weise unter Beanspruchung höherer Kompetenzen. Diesen Zustand suchte das Vollziehungsdirektorium durch seinen Beschluss vom 26. Jan. 1799 zu heben. Darin erklärte es. dass es aucun autre Commissaire du Nonce anerkenne als den Citoyen Müller (Nr. 563). Nun war aber Bürger Thaddäus Müller mit dieser Würde gar nie bekleidet worden. Der Minister der Künste und Wissenschaften wandte sich desshalb unterm 16. Febr. 1799 direkt an den Nuntius mit der schriftlichen Erklärung: "Die helvetische Regierung kann es nicht zugeben, dass in Helvetien irgend eine kirchliche Autorität auf einem Manne ruhe, welcher ihr Zutrauen verloren hat; in diesem Fall befindet sich aber Ihr bisheriger Kommissar Krauer in Luzern." Der Nuntius möge ihn daher entlassen; es könne aber alsdann nicht leicht ein anderer dessen Nachfolger werden als der Mann, den schon das bischöfliche Vertrauen zu einem Vorsteher der helvetischen katholischen Kirche berufen habe, Thaddäus Müller (Nr. 1344). Der Nuntius ging hierauf natürlich nicht ein und Krauer funktionierte auch ohne staatliche Anerkennung weiter. Die Situation wurde dadurch für den bischöflichen Kommissar eine recht unangenehme.
Hievon handelt u. A. die vierte Vorstellung seines Memorandums vom 3. Dezember 1799. "Der römische Nuntius behaltet noch immer einen Agenten in Luzern, welcher sammt seinen Substituten nichts anderes zu thun hat, als Geld einzunehmen (für Ehedispensen).... Sollten solche päpstliche Agenten noch ferner in Helvetien nöthig sein? Würde es ein
patriotischer Bischof nur dulden, dass neben ihm noch eine andere geistliche Behörde in seinem Sprengel wäre, welche vielleicht von ganz entgegengesetzten Grundsätzen, als er selbst, belebt sein könnte?" Der bischöfliche Kommissar meint, die Regierung sollte, wie es in andern Ländern auch geschehen sei, den Bischöfen einfach befehlen, bei dispensablen Ehehindernissen von sich aus die Dispense gratis zu ertheilen. So sei kein päpstlicher Agent mehr nothwendig (Nr. 1344).
Der Kommissar des päpstlichen Nuntius zog freilich auch noch andere Geschäfte an sich. Namentlich funktionierte er als letzte Instanz in Ehestreitigkeiten. Der Regierungsstatthalter des Kantons Waldstätten theilt der Regierung unterm 29. April 1801 einen derartigen Fall mit. Sein Schreiben lautet sehr unpäpstlich: "Ich kenne bis dahin, sagt er, weder eine römische Nuntiatur, noch einen apostolischen Kommissarius, der von der helvetischen Regierung anerkannt sein soll, noch weniger einen zweitinstanzlichen geistlichen Gerichtshof... Ich finde in diesem Schritt etwas von einem alten verwegenen Versuch der transalpinischen Politik, den Triumph der sog. geistlichen Rechte in diesem Moment zu behaupten" (Nr. 1345). Es war aber schwierig, diesen Gerichtshof zu beseitigen; denn es war Niemand gezwungen, vor demselben zu erscheinen; diejenigen aber, die erschienen, gaben in der Regel den helvetischen Behörden von den Akten der geistlichen Nebenregierung keine Kenntniss.
Als der Kommissar des päpstlichen Nuntius am 31. März 1800 gestorben war, kam Thaddäus Müller wieder auf den Gedanken zurück, das bestehende Missverhältniss durch eine Personalunion beider Kommissariate zu heben. "Das Kommissariat des Nuntius", schreibt er den 1. April 1800 an Stapfer (Nr. 1344), "ist um desto wichtiger, da die Klöster unter demselben stehen. Ich muss frei zugestehen, dass, wenn es auf
einen Mann fiele, der, wie sich vermuthen lässt, obwohl von Krauer's Grundsätzen beseelt, doch in so mancher Rücksicht dem immer respektablen seligen Krauer zurückstände, ich bei anderweitigem vielem Verdruss nicht Lust hätte, demselben auf irgend eine Weise untergeordnet zu sein." Der Vollziehungsausschuss lud nun unterm 7. April 1800 Müller ein, selber an den Nuntius das Gesuch zu richten, ihm auch das päpstliche Kommissariat zu übertragen. Allein Müller fand, dass ein solcher Schritt unbescheiden wäre und sprach den 8. April 1800 den Wunsch aus, der Sache ihren Lauf zu lassen.
Sie war bald entschieden. Schon den 13. April konnte Müller dem Minister der Wissenschaften melden, der päpstliche Nuntius habe den Stiftskaplan Steinach zu seinem Kommissar ernannt. Müller's Urtheil über diesen Mann lautet nicht günstig: "Die Wahl hätte in mancher Rücksicht auf keinen schädlicheren Mann fallen können. Er ist das Centrum der Obscurantenpartei, frech und übermüthig. Neben ihm kann und will ich nicht arbeiten, sondern eher meine Stelle als bischöflicher Kommissar renuntieren. Denn durch diesen Mann ist sowohl mein Wirkungskreis eingeschränkt als der Fortgang aller meiner Unternehmungen gehindert. Jedem Guten, das ich thun könnte, wird er durch Ausübung seiner, wer weiss wie unbestimmten, aller bischöflichen Autorität trotzenden Vollmachten entgegen arbeiten. Ich halte es auch unter meiner Würde, von diesem Grossinquisitor abhängig zu sein und als Kommissarius mit Suppliken an ihn zu gelangen. Die ganze besserdenkende Geistlichkeit, deren Geissel er ehemals als Sekretär der bischöflichen Kommissarien gewesen ist, würde mich verachten, wenn ich mit diesem Mann mich in Verbindung einlassen könnte.... Nach langen Revolutionsunannehmlichkeiten will ich jetzt nicht aufs neue der Sklave eines Popen
sein. So spricht aus mir der Sinn für Freiheit und Wahrheit" (Nr. 1344).
Obwohl Müller am Schlusse seines Briefes wünscht, es möchte von seinen Mittheilungen nichts in die Oeffentlichkeit gelangen, konnte doch die, vom römischen Standpunkt aus betrachtet, sehr unkirchliche Haltung des bischöflichen Kommissars nicht lange unbekannt bleiben. Die päpstlich gesinnte Geistlichkeit des Kantons beschuldigte ihn der Häresie und forderte laut seine Absetzung. Der Vollziehungsausschuss sicherte ihm aber unterm 5. Mai 1800 ihren vollen Schutz zu (Nr. 563).
Auch der neu ernannte päpstliche Kommissar Steinach nimmt sich den 17. Mai 1800 mit "ehrerbietigster Ergebenheit" die Freiheit, in einem an den Vollziehungsausschuß gerichteten Schreiben, seine "Gewaltsbriefe in geistlichen Sachen zu dispensiren Hochdero Gnädigsten Einsicht und Genehmigung zu übersenden." Das geschähe so spät, weil er sich nicht erinnern konnte, dass sein Vorfahr Karl Krauer Aehnliches gethan habe, "und weil Ich nur in diesem Nothfall ein substituirter Kommissarius bin, so befürchtete Ich, man dürfte mihr solchen schritt für eine frechheit oder stolz ausdeuten, obwohl ich schon vor etwas zeit von diesen beiden (nämlich der bischöflichen und päpstlichen Vollbedacht) auss zutraulichen Vorsorg Copien an Bürger-Vollziehungsrath Dürler abgegeben" (Nr. 1344).
Stapfer hatte Steinach's Gesuch zu begutachten. Merkwürdiger Weise bekundet hiebei der protestantische Minister der Wissenschaften und Künste eine viel entschiedenere Ueberzeugung von der Nothwendigkeit des Papstes in der katholischen Kirche als der bischöfliche Kommissar Müller in Luzern. Er sagt, die Regierung habe jede Religionspartei in Helvetien bei der Ausübung ihres Gottesdienstes zu schützen. "Da nun zum Wesen der katholischen Kirchenlehre gehört, dass die Glaubensgenossen
in beständiger und genauer Verbindung mit dem Papst oder dem sichtbaren Oberhaupt derselben bleiben: so kann die Regierung nicht nur diesen nothwendigen Verkehr nicht unterbrechen, sondern sie soll die Möglichkeit desselben und die desswegen erforderlichen Massregeln beschützen." Daraus würde also gefolgt sein, dass die helvetische Regierung dem päpstlichen Kommissar, der in so devoten Weise die obrigkeitliche Anerkennung nachsuchte, das Exequatur nicht vorenthalten dürfe. Allein Stapfer flüchtete sich nun sogleich auf den politischen Boden und fand, die Würde der Regierung fordere, "dass sie keinen Agenten einer fremden Macht in ihrem Lande anerkenne. die sich nicht zuvor (bei der Regierung des Landes) legitimirt" habe. Nun habe aber der Papst bisher noch keinen Schritt gethan, der darauf schliessen lasse, dass er die helvetische Republik anerkenne. Er warte vermuthlich auf den Ausgang des grossen Weltprozesses, um sich für oder wider sie zu erklären. So wurde denn im Juni 1800 das Gesuch des päpstlichen Kommissars oder, wie er sich selber bezeichnete, des Commissarius Apostolicus Steinach abgewiesen.
Stapfer's Nachfolger, Minister Mohr, kam dem Kommissar des päpstlichen Nuntius noch weiter entgegen. Er schreibt den 10. März 1801 dem Stiftskaplan Steinach in Luzern: "Wer katholisch sein will, wird und muss Ihre Gewalt anerkennen; der Bürger anerkennt sie nicht; der erstere wird sich derselben unterziehen, der andere thut es nicht.... an ihm aber ist es dann, sich über seine Weigerung vor seinem Gott und seinem Gewissen zu verantworten." Nochmals gibt er dem apostolischen Kommissar die Versicherung, die Verhältnisse würden sich ändern, sobald der Papst die helvetische Republik anerkenne (Nr. 1344).
Recht eigenthümlich nehmen sich angesichts solcher Zugeständnisse die jahrelangen Bemühungen der helvetischen Regierung aus, das päpstliche Kommissariat einem Manne zu übertragen, der, wie man wusste, es als patriotische Pflicht ansah, "die beständige und genaue Verbindung mit dem Papst" möglichst illusorisch zu machen. Sobald die Regierung zugab, dass das Wesen des Katholizismus ausser der von Niemanden angefochtenen hierarchischen Ordnung, wie sie durch den Episkopat gebildet war, eine unmittelbare Verbindung der Katholiken mit dem Papst erfordere, war die Nichtanerkennung des päpstlichen Repräsentanten eine Beeinträchtigung der Religionsfreiheit zum Nachtheil der wahren Katholiken. Mit vollem Recht schreibt den 2. November 1801 ein gewisser Baumlin, der inzwischen als "Kanzler und Generalkommissar der Nuntiatur" an Steinach's Stelle getreten war, es sei niemals verlangt worden, dass die helvetische Regierung den Repräsentanten des über den Kirchenstaat gebietenden Souveräns, sondern nur, dass sie den Stellvertreter des Oberhauptes der katholischen Kirche anerkenne. Die Nothwendigkeit einer solchen Stellvertretung habe die Regierung selbst mit ihrem Vorschlag, den Stadtpfarrer Thaddäus Müller zum päpstlichen Kommissar zu ernennen, thatsächlich anerkannt. Leider sei dieser Vorschlag schon desswegen unpraktisch, weil den Katholiken die Möglichkeit geboten werden müsse, von der bischöflichen Autorität an die päpstliche zu appelliren. Da nun die Freiheit des katholischen Kultus ausdrücklich gewährleistet sei, lasse sich die Verweigerung der nachgesuchten Anerkennung nicht rechtfertigen.
Wenn es gleichwohl nicht sofort zur förmlichen Anerkennung des päpstlichen Delegirten kam, so wird dies wohl ein Mann bewirkt haben, der gerade jetzt seinen Aufenthalt in Bern genommen und mit grösstem Eifer an der Verbesserung
der kirchlichen Verhältnisse zu arbeiten angefangen hatte, Jgnaz Heinrich Freiherr von Wessenberg, Generalvikar des Fürstbischofs von Konstanz. Wie Dalberg selbst, so legte auch Wessenberg auf "die beständige und genaue Verbindung" mit dem Papst kein sehr grosses Gewicht. In den Hirtenbriefen, die er in den Jahren 1801 bis 1808 erscheinen liess und die im Jahr 1808 in einer vollständigen Sammlung neu herausgegeben wurden (Konstanz, Thadd. Waibel), finden sich recht verschiedenartige Dinge, z. B. sogar eine oberhirtlichen Empfehlung der Impfung, deren Entdeckung auch ein göttliches Gnadengeschenk sei; aber umsonst sucht man eine Erörterung der Pflicht, dem römischen Stuhle unterwürfig zu sein.
II. Stellung der helvetischen Republik zur bischöflichen Autorität.
Der Fürstbischof Dalberg hatte den Freiherrn von Wessenberg im September 1801 zu seinem ausserordentlichen Gesandten bei der helvetischen Republik ernannt. Für die freundliche Aufnahme Wessenbergs in Bern war durch den Hirtenbrief vom 8. September 1801 gesorgt. Dieses bischöfliche Schreiben beginnt mit dem Satze: "In gegenwärtigen äusserst bedenklichen Zeiten entsteht für die katholische Geistlichkeit die erneuerte Pflicht, die Reinheit der evangelischen Lehren, die Ermahnungen zu christlicher Liebe, Folgsamkeit gegen allgemeine Gesetze und schuldige Achtung für obrigkeitliche Personen mit verdoppeltem Eifer zu empfehlen." Die gesammte Geistlichkeit wird daher ermahnt, diese Pflicht gewissenhaft zu erfüllen. Zuwiderhandelnde sollten durch die Kommissarien dem Bischof sofort angezeigt werden (Nr. 1344). In Bern selbst begann Wessenberg seine Wirksamkeit mit der Erklärung, dass der Bischof von Konstanz nicht daran denke, sich in die innern politischen Einrichtungen
Helvetiens zu mischen, dass er aber der Meinung sei, die Wohlfahrt eines Volkes ruhe bei jeder politischen Verfassung wesentlich auf der Religiosität, der Gerechtigkeit und Billigkeit der Bürger. Solche Tugenden wolle er befestigen helfen (Schreiben vom 27. September 1801; Nr. 1344). Den 5. October 1801 überreichte er ein ausführliches Promemoria, in welchem er die Nothwendigkeit einer allmäligen Reform des Gottesdienstes, der Abstellung von Missbräuchen, der Errichtung guter Erziehungsanstalten für den Klerus, der Umgestaltung nützlicher Orden, strengerer Kirchendisziplin erörtert. Andere Gutachten ähnlichen Inhaltes sind oom 22. Ort. 1801 und 1. April 1802 datirt (Nr. 1344). Es ist beklagenswerth, dass die Herstellung der guten Beziehungen zu der Kurie von Konstanz erst so spät stattfinden konnte — zu spät, als dass man noch etwas Bleibendes hätte schaffen können. Die "eine und untheilbare helvetische Republik" war bereits in der Auflösung begriffen.
Wäre von Anfang an eine Kirchenregierung möglich gewesen, wie sie Wessenberg versuchte, so wäre die Klage über Beinträchtigung der Religionsfreiheit früher verstummt und manches Gute erreicht worden. Allein Dalbergs Vorgänger kümmerte sich, wie Thaddäus Müller schon 1799 klagt, mehr um seine weltliche Regierung und seine Kommissarien hatten haupsächlich die Aufgabe, "Geld einzuziehen" (für die Dispensen). Der Abt von St. Gallen, der über sein bisheriges Fürstenthum die bischöflichen Rechte ausübte, war in's Ausland geflohen, und es dauerte bis zum 22. September 1800, bis sich der Bischof von Konstanz definitiv zur Uebernahme der bischöflichen Jurisdiktion über den Kanton Säntis bereit erklärte (Nr. 563). Der Bischof von Basel war ebenfalls in's Ausland geflohen. Der italienische Theil Helvetiens stand
unter den Bischöfen von Mailand und Como. Ausserdem trugen auch die Kriegsereignisse, deren Schauplatz Helvetien war, die mannigfaltigen Erhebungen gegen die Centralregierung in den verschiedensten Theilen der Republik, die vielen, immer wieder missglückenden Versuche zur Herstellung einer allgemeiner zusagenden Staatsordnung wesentlich zum Fortbestand der kirchlichen Anarchie bei.
Zur Ermöglichung einer geordneten kirchlichen Verwaltung sollte nach Stapfer's Idee, wenigstens provisorisch, das Institut der bischöflichen Kommissarien dienen. Auf seinen Antrag ordnete das Vollziehungsdirektorium den 27. November 1798 eine Untersuchung an, wo es solche Kommissarien in Helvetien gebe und welches deren Kompetenzen seien. Sodann bestand die Regierung darauf, dass nur ihr genehme Persönlichkeiten dieses Amt bekleiden dürften. Wie der missbeliebige Kommissar von Luzern durch einen andern Geistlichen zu ersetzen war, so wurden für den Kanton Lugano durch Direktorialbeschluss vom 19. April 1799 die Pfarrer Ragutti und Torriani zu Kommissarien ernannt und für den Kanton Bellinzona den 24. April 1799 die von den Bischöfen von Como und Mailand gewählten Kommissarien Fontana und Sacchi bestätigt (Nr. 563).
Die wichtigsten Kompetenzen dieser Kommissarien ergeben sich aus dem merkwürdigen Direktorialbeschluss vom 5. März 1799. Er lautet wörtlich (Nr. 1342): "In Erwägung, dass die Einweihung der jungen Geistlichen den bischöflichen Kommissarien übertragen werden könne", wird beschlossen:
"1. Alle Reisen aus dem helvetischen Gebiete, um die priesterliche Einweihung zu erhalten, sind verboten und zwar für den Widerhandelnden unter der Strafe, von der Pfründe, die ihm von der Civilobrigkeit übertragen worden, verstossen zu werden.
2. Alle Gebühren von Seite desjenigen, der zu irgend einer Pfarrei oder Pfründe ernannt ist, um die Weihe von den geistlichen Obern zu erhalten, sind abgeschafft, mit Ausnahme der Ausfertigungsgebühren für die Kanzleien, die für jeden Gegenstand nicht mehr als 8 Franken betragen sollen.
3. Diejenigen, welche von der Civilobrigkeit zu Pfründen ernannt werden und die Priesterweihe verlangen, sollen sich einzig und allein und in allen Fällen an die den Bischöffen verzeigten in Helvetien sich aufhaltenden Commissarien zu wenden haben."
Der Beschluss ist nicht ganz verständlich. Vermuthlich hat wenigstens der deutsche Sekretär oder Uebersetzer den Begriff von Ordination und kanonisches Institution nicht gekannt. Vor der Priesterweihe kann in der Regel Niemand eine Pfründe verlieren, weil Pfründen erst den ordinirten Priestern übertragen werden. Immerhin wird der Beschluss als ein Verbot für alle Geistlichen, direkt mit dem ausländischen oder ausserhalb Helvetiens wohnenden Diözesanbischof zu verkehren, aufzufassen sein. Es sollten sich keine Priesteramtskandidaten zum Empfang der Priesterweihe und keine auf bestimmte Pfründen ernannte Priester zur Einholung der kirchlichen Bestätigung, zur Ablegung des tridentinischen Glaubensbekenntnisses und zum Empfang der sog. aura animarum (Autorisation zur Ausübung der Seelsorge) zu einem Bischof ausserhalb der Grenzen Helvetiens begeben. Man liess sich bei diesem Beschlusse vermuthlich von politischen Gesichtspunkten leiten und hoffte wohl auch, damit die nationale Gesinnung des Klerus gegen fremde Einflüsse sicher zu stellen. Viel wurde aber nicht erreicht. Die von einem bischöflichen Kommissar vollzogene Institution war mit einer unmittelbar bischöflichen völlig gleichwerthig. Was aber die Ordinationen betrifft, so sagt darüber
Thaddäus Müller in dem wiederholt erwähnten Gutachten vom 3. Dezember 1799 (Nr. 1344); Der Bischof gibt die litterae dimissoriales (die Erlaubniss, dass ein Priesteramtskandidat von einem andern consekrirten Bischof ordiniert werden dürfe) gern. "Allein da wir nun keinen römischen Nuntius mehr in Luzern haben, und, will's Gott, einen solchen nicht so bald wieder werden aufnehmen müssen, so ist die Ertheilung von Entlassungsbriefen von keinem Vortheil." Früher pflegte nämlich der Nuntius die Priesteramtskandidaten der innern Schweiz zu ordinären; der "Vortheil", der nun nach Müller's Meinung den Kandidaten entgangen war, bestand einfach in der Ersparnis der Reisekosten. Das Dekret vom 5. März 1799 gehört sicher auch zu den Beschlüssen, von welchen der Vollziehungsausschuß in seinem Manifest vom 22. Januar 1800 erklärt, sie hätten die neue Regierung von der dringenden Nothwendigkeit überzeugt, "der vollziehenden Gewalt eine ganz verschiedene Richtung zu geben" und nur solche Neuerungen bestehen zu lassen, die durch ein förmliches Gesetz eingeführt worden seien.
Dem Gedanken, dass die katholische Kirche Helvetiens von ausländischen Kirchenfürsten unabhängig gemacht und in Uebereinstimmung mit der politischen Verfassung des Landes reorganisiert werden sollte, begegnen wir allerdings vor und nach dem Staatsstreich vom 7. Januar 1800.
Schon unterm 6. November 1798 übersandte der Pfarrer Häfliger im Namen der Bürger Pfarrer des Distrikts Hochdorf im Kanton Luzern dem Vollziehungsdirektorium einen Aufsatz über die bestehenden kirchlichen Missverhältnisse und die Mittel zur Besserung. Bezüglich der Kirchenregierung sagen die Verfasser: "Unser Bischof ist ausser unserm Vaterland, ein teutscher Reichsfürst, dem seine Regierungsgeschäfte die
beste Zeit rauben; seine Generalvikare und Officialen müssen bei der Ausdehnung seines Bisthums alles durch fremde Brillen sehen; seine Kommissarien geben sich mit Ehehändeln und Dispensationen ab; seine Dekane haben weder Ansehen noch Jurisdiktion; seine Sextarien haben nichts zu bedeuten und begnügen sich mit ihrem Rang und Titel" u. s. w. Um dieser unerquicklichen Anarchie zu begegnen, wird vorgeschlagen, aus der Geistlichkeit der Kantone Luzern, Waldstätten und Baden ein geistliches Direktorium (analog dem Vollziehungsdirektorium) zu errichten. Es sollte zu Luzern unter dem Vorsitze eines weltlichen Ministers seine Sitzungen halten, sich "vom Bischof anerkennen und bevollmächtigen lassen", über die Lehrart, die Sitten und die Pflichten der Geistlichkeit zu richten. In jedem Distrikt hätte dieses Direktorium einen geistlichen Statthalter. Stapfer antwortete in einem von Fischer entworfenen Schreiben u. A.: "Sie haben das wahre Prinzip aufgestellt, das bei der Verbesserung des katholischen Kultus sowohl als des protestantischen zu Grunde liegen soll. Die Kirche bedarf einer Organisation, bei der es ihr möglich wird, aus sich selbst und durch sich selbst an ihrer Verbesserung zu arbeiten. Ob einer oder mehrere Nationalbischöfe oder ein Kirchenrath, wie Sie ihn vorschlagen, die Leitung dieses wichtigen Geschäftes übernehmen soll, das wird dann erst ausgemacht werden können, wenn unsere äussern Verhältnisse mehr geordnet und unsere Gesetzgeber über jenen Grundsatz einig sein werden. Behalten Sie aber nichtsdestoweniger jene Frage im Auge; lassen Sie es sich nicht verdriessen, darüber nachzudenken und mir die Resultate Ihres Nachdenkens so oft als Sie wollen mitzutheilen. Immer wird es mir erwünscht sein, in Ihnen Repräsentanten des aufgeklärten Theils der katholischen Geistlichkeit zu hören" (Nr. 1315). .
Verwandt mit dem Vorschlag der Geistlichen des Distrikts Hochdorf ist der Gedanke, den Stapfer in einer Zuschrift (vom 18. Nov. 1799) an das Vollziehungsdirektorium ausspricht: In jedem Kanton sollte ein bischöflicher Vikar (analog dem Regierungsstatthalter), und in jedem Distrikt ein Unterkommissar (analog dem Unterstatthalter) ernannt werden. Er beantragte, den bischöflichen Kommissar Müller nach Konstanz zu senden, damit er persönlich mit dem Fürstbischof das Nöthige vereinbare (Nr. 563). Müller ging nicht nach Konstanz; er war aber mit Stapfer's Plan völlig einverstanden; er war, zumal wenn auf Heinrich Zschokke's Anregung (Brief vom 9. Nov. 1799 an das Vollziehungsdirektorium, Nr. 563) auch der Kanton Waldstätten seinem Kommissariat zugetheilt worden ist, wenigstens rechtlich das Haupt der katholischen Geistlichkeit der Centralschweiz. Um so peinlicher war es für ihn, wahrzunehmen, dass er doch thatsächlich nichts ausrichte und nichts zu bedeuten habe. Er klagt (Schreiben v. 3. Dez. 1799, Nr. 1344) bitter darüber, dass der bischöfliche Kommissar nicht einmal wisse, wie es in den einzelnen Gemeinden stehe, weil er keine Kommunikation mit denselben habe. Und doch sei ihm u. A. auch die Aufsicht über den Religionsunterricht übertragen. Er stehe nach bisheriger Einrichtung nur mit den Dekanen in Korrespondenz; diese aber seien ihm meistens sehr feindlich gesinnt. Einzelne hätten bisher sogar jeden Schritt vermieden, durch den sie ihn als Kommissar anerkannt haben würden. Die Dekanate sollten aufgehoben und dafür vorerst in jedem der 9 Distrikte des Kantons Luzern ein Unterkommissar eingesetzt werden. Sodann sollten nothwendig die Exemtionen der Klöster (die Privilegien der unmittelbaren Abhängigkeit von Rom) annulliert und die Ordensleute gerade so wie andere geistliche Personen dem Bischof und seinen Kommissarien
unterstellt werden. Es käme nämlich vor, dass gerade von den Klöstern aus das Volk beunruhigt, die Wirksamkeit braver Geistlichen geschädigt, ja sogar der der Predigt beiwohnende Ortspfarrer von der Kanzel herab geschmäht werde, ohne dass eine geistliche Behörde einschreiten dürfe. Zur Vornahme bischöflicher Funktionen sollte wenigstens ein Weihbischof eingesetzt werden.
Stapfer seinerseits kam immer wieder darauf zurück, dass die ausländischen Bischöfe durch inländische ersetzt werden sollten und hätte sogar die Ernennung eines helvetischen Erzbischofs begrüsst. Er meinte: "So lange sich die Kandidaten des geistlichen Standes von ausländischen Bischöfen examiniren und dirigiren lassen müssen, ist an Ruhe und Verbesserung des Klerus in Helvetien nicht zu denken" (Schreiben an den Vollziehungsausschuss vom 3. Juli 1800, Nr. 563).
Leider vermochte auch ein Wessenberg den Plan, die deutsche Schweiz von der Konstanzer Diözese loszulösen, nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Der Gedanke wurde unter fortwährender Anrufung patriotischer Gefühle bald nach dem Untergang der helvetischen Republik von einer Seite aufgegriffen, der es leichter war, ihn zu verwirklichen. Es galt, zunächst die schweizerischen Gebiete dem gefährlichen Einfluss Wessenbergs zu entziehen. Das ist leider gelungen, aber die freiheitliche Entwicklung der katholischen Kirche in der deutschen Schweiz dadurch nicht gefördert worden. Es wurde nur der Kern zerschlagen, um den sich cisalpinisches katholisches Kirchenwesen hätte kristallisieren und in reinen und schönen Formen immer weiter ausdehnen können. Die eifrigsten Förderer dieses Zerstörungswerkes waren Staatsmänner, die ganz andere Absichten als die römische Kurie verfolgten.
III. Stellung der Pfarrer in der helvetischen Republik.
Während wir bei den bisher berührten Punkten der Kirchenregierung der Natur der Sache nach nur von katholischen Theilen Helvetiens reden konnten, haben wir bei einer Besprechung der Fragen, die sich auf die Leitung der einzelnen Pfarreien beziehen, beide Konfessionen in gleicher Weise zu berücksichtigen.
Wäre Stapfer's Anschauung dass die Kirche eine private Gesellschaft sei, die sich unter der Aufsicht des Staates, wie jeder andere Verein, frei organisiren und ihre Zwecke verfolgen könne, die massgebende gewesen, so hätte die helvetische Regierung doch wenigstens die Wahl der Pfarrer — bezw. also die Wahl der Vereinspräsidenten — der ganzen Genossenschaft, oder wenn es dieser so beliebte, den einzelnen Sektionen oder Pfarreien überlassen müssen. Heute wenigstens würde man es als eine schwere Beeinträchtigung der Religionsfreiheit ansehen, wenn eine ausserhalb der Kirche stehende Behörde das Recht, die Pfarreien zu besetzen, in Anspruch nehmen und, selbstverständlich, dann auch nach ihren besondern pädagogischen Zwecken ausüben wollte. Zur Zeit der helvetischen Republik war's anders.
Laharpe hielt freilich auch bezüglich der Pfarrwahlen das Prinzip der Nichtintervention für das richtige und hätte gern jeder Gemeinde gestattet, zum Pfarrer zu wählen, wen sie nur wollte. In recht frappanter Weise zeigte sich dies in einem Fall, welchen der Berner Kirchenrath in seiner Klageschrift vom 14. Jan. 1800 auch zu den Erscheinungen rechnet, welche angeblich die Absicht verbiethen, das Christenthum in Helvetien zu zerstören. — Die Gemeinde Mönthal im Distrikt Brugg konnte in Folge Abschaffung des Zehntens
einen Pfarrer mehr bekommen. Da anerbot sich ein Bäckergeselle von Brugg, Namens Wetzel, der Gemeinde auch das geistliche Brod zu liefern und zu diesem Zwecke das Predigeramt zu übernehmen. Die Gemeinde war damit einverstanden und so begann Wetzel sofort alle Funktionen eines ordentlichen Pfarrers. Unterm 18. Sept. 1799 protestirte eine Versammlung reformirtes Pfarrer in Lenzburg energisch gegen diese Durchbrechung der kirchlichen Ordnung. Auch der Minister der Wissenschaften und Künste fordert den 23. Sept. 1799 in einer ausführlichen und heftigen Zuschrift an das Vollziehungsdirektorium, dass dem Bürger Wetzel die Ausübung des Pfarramtes untersagt werde; Schulmeisterdienste hingegen dürfe er verrichten; bis die Gemeinde Mönthal einen Pfarrer habe, soll der Klaßhelfer von Brugg daselbst Gottesdienst halten. Wetzel's Beispiel zeige, bemerkt Stapfer bei diesem Anlass, ce qui deviendra l'instruction du peuple si le choix de ses organes lui était abandonné. Il donnera de préférence et partout sa confiance aux fanatiques aux hommes ardents, aux charlatans ignorans et enthousiastes. Abgesehen aber vom Interesse der Volksbildung, wäre es eine schreiende Ungerechtigkeit gegen die ordentlich gebildeten und geprüften Geistlichen, wenn man jedem beliebigen Sektierer den Zugang zu den Pfarrpfründen öffnen wollte. Allein das Vollziehungsdirektorium beschloss den 24. Sept. 1799, in dieser Angelegenheit zur Tagesordnung überzugehen und gab dem Minister Stapfer den Bescheid, "es könne sich in diese Sache als eine gottesdienstliche Angelegenheit nicht einlassen" (Nr. 564). Stapfer erklärte aber in seiner Vertheidigung gegenüber dem Berner Kirchenrath (S. 43), er habe den Beschluss des Direktoriums so ausgelegt, dass daraus "kein öffentliches Aergerniss entstand und den Predigten des Bürgers Wetzel ein Ende gemacht wurde."
Unbegreiflich ist, wie in diesem speziellen Fall das Direktorium erklären konnte, "es könne sich in diese Sache als eine gottesdienstliche Angelegenheit nicht einlassen". Es handelte sich um die "Sache" einer Pfarrwahl, und die Besetzung der Pfarreien war eine Angelegenheit, mit der sich das Direktorium häufiger als mit irgend einer andern beschäftigte. Man muss geradezu den fabelhaften Fleiss bewundern, mit welchem die helvetische Regierung neben der sonstigen Arbeit, die ihr oblag, auf alle bei Pfarrbesetzungen in Betracht kommenden allgemeinen und speziellen Fragen einging.
Schon im Mai 1798 hatte die Kirchenkommission des Kantons Bern ein provisorisches Reglement über Vornahme der Pfarrwahlen entworfen. Darin waren u. A. folgende Bestimmungen enthalten: Geistliche des Kantons sind diejenigen, die auf der Akademie studirt und die Vollmacht zu Pfarrverrichtungen empfangen haben. — Wahlfähig auf Pfarreien werden Geistliche erst nach fünfjährigem Kirchendienst — es sei denn, dass der Mangel an Geistlichen auch die Verwendung jüngerer Männer nothwendig mache. — Der Konvent prüft die Wahlfähigkeit der Angemeldeten. —Die Verwaltungskammer übersendet die Kandidatenliste der vakanten Gemeinde, welche drei ihr genehme Persönlichkeiten vorschlägt. — Die Verwaltungskammer ernennt einen der drei Vorgeschlagenen. "Anhalten" und Probepredigten sind verboten. — Der Dekan Wyttenbach von Bern war. wie er den 10. Mai 1798 an das Vollziehungsdirektorium schreibt, nicht damit einverstanden, dass man den Gemeinden ein Vorschlagsrecht einräume; sie seien "nicht kompetierliche Richter, welcher Pfarrer der Gemeinde für ihr wesentliches Wohl der nützlichste seye; der äussere Schein, intrigues, fremder Einfluss würden meistens den Massstab dazugeben" (Nr. 566). Die Verwaltungskammer
acceptierte aber provisorisch das Pfrundreglement, was das Vollziehungsdirektorium den 2. Juni 1798 in Erwägung, dass in dieser Sache noch kein Gesetz erlassen sei, bestätigte (Nr. 1577).
Das Gesuch, ein solches Gesetz zu erlassen, bildet den Inhalt einer Botschaft, welche das Direktorium den 11. Juni 1798 an die gesetzgebenden Räthe richtete. Da aber das Gesetz nicht erschien, dekretierte das Direktorium den 28. Juni 1798. dass die Verwaltungkammern der Kantone in allen Dingen an die Stelle der Behörden zu treten hätten, welche nach der alten Ordnung der Dinge der Kirchenpolizei vorgesetzt waren. Die Wiederbesetzung der Pfarreien soll durchaus nach den Gesetzen oder alten Gebräuchen geschehen, welche bisher in den einzelnen Kantonen bestanden hätten (Nr. 566).
Den 5. Juli 1798 wurde diesem Dekret weiter beigefügt, es sei vonnöthen, dass die Verwaltungskammern bei der Aufsicht über den wissenschaftlichen und religiösen Unterricht von Kommissionen unterstützt würden, die aus Lehrern und Dienern der Religion zusammengesetzt seien. Desshalb hätten die Verwaltungskammern die akademischen und Kirchenräthe einzuladen, "vorläufig" ihre Funktionen fortzusetzen. Den Sitzungen dieser Räthe sollte aber mit Stimm- und Vetorecht ein Kommissär der betreffenden Verwaltungskammer beiwohnen. Damit hatten die kantonalen Kirchenräthe wieder eine — wenn auch nur provisorische und nur halbwegs klare — Anerkennung erlangt, was insbesondere für ordentliche Besetzung der Pfarreien von Bedeutung war. Die Installation der neugewählten Pfarrer war durch einen von der Verwaltungskammer zu bezeichnenden benachbarten Pfarrer im Beisein des Unterstatthalters des betreffenden Distrikts vorzunehmen.
Ein Dekret vom 17. Juli 1798 gestattete den Verwaltungskammern, bei der Besetzung geistlicher Stellen auch Kandidaten anderer Kantone zu berücksichtigen, verpflichtete aber bereits die jüngern Geistlichen, die später berücksichtigt werden wollten, "sich auf Einladung der Kirchenräthe die Bedienung von Vikariaten gefallen zu lassen." Die erstere Bestimmung wurde den 1. August 1798 in folgender genauerer Form zum Beschluss erhoben: "Alle reformirten Geistlichen, die in Helvetien zum Predigtamt sind geweiht worden, sollen für alle erledigten Pfarrstellen in allen Kantonen ohne Unterschied wahlfähig sein" (Nr. 566). Die Vorschrift, dass jüngere Geistliche Vikariate nicht ausschlagen dürften, wenn ihnen von den Kirchenräthen solche übertragen würden, scheint nicht immer befolgt worden zu sein. Sie wurde den 22. Oktober 1800 durch den Vollziehungsrath wiederholt und zwar unter der Androhung, dass ein Pfarramtskandidat, der ein ihm von der Behörde übertragenes Vikariat ausschlage, niemals Pfarrer werden könne und, falls er ein Beneficium oder Stipendium besitze, dieses sofort verliere. Die Verordnung bezüglich der Freizügigkeit der reformirten Geistlichen in ganz Helvetien wurde den 25. August 1798 durch folgendes Dekret wieder eingeschränkt: "Diejenigen Bürger, die aus anderen Kantonen als aus dem, in welchem sie eine erledigte Pfarrstelle zu erhalten wünschen, gebürtig sind, sollen nicht eher in Konkurrenz gesetzt werden, bis sie den zur Wahl oder Bestätigung des neuen Pfarrers beauftragten Autoritäten folgende Aktenstücke werden vorgewiesen haben:
a. dass sie auf einer protestantischen helvetischen Akademie ihre Studien verfolgt und beendet haben;
b. dass sie gehörig die Zulassung zu den Verrichtungen des Gottesdienstes erhalten haben;
c. Zeugnisse guter Sitten, welche von den Autoritäten der Orte gegeben sein müssen, wo sie seit ihrem Eintritt in den geistlichen Stand gewohnt oder Funktionen verrichtet haben". Gleichzeitig wurden zwar die alten Verordnungen, welche bei Pfarrwahlen einzelnen Geistlichen mit Rücksicht auf Anciennität und bisherige Thätigkeit besondere Vorrechte einräumten, abgeschafft, hingegen die wiederholte Erklärung gegeben, "dass die ehemaligen Statuten und Gebräuche, die bei der Epoche der Staatsveränderung in Kraft waren und der Konstitution, den Gesetzen und den Verordnungen des Direktoriums nicht zuwider seien, fortwährend Gültigkeit hätten" (Nr. 566).
Diese Erklärung hatte offenbar den Zweck, Befürchtungen zu beseitigen, die in katholischen Gegenden erwacht waren. So meldet unterm 22. August 1798 der Regierungsstatthalter des Kantons Säntis, dass unter der dortigen Geistlichkeit und dem unaufgeklärten Theil des Volkes wegen der Beschlüsse vom 28, Juni und 5. Juli 1798 grosse Aufregung herrsche. Man fürchte Eingriffe in die "kirchlichen Gebräuche und Religionsgrundsätze." Das Vollziehungsdirektorium beharrt aber durch einen motivierten Beschluss vom 27. August 1798 auf den bezüglichen Verordnungen. Es stützt sich dabei auf die Erwägung, "dass die Verwaltungskammern durch diese Beschlüsse in Religionssachen nicht mehr Gewalt als die vormaligen Regierungen der Schweiz erhalten haben, und dass dieselben die hierarchische Ordnung und die Organisation der geistlichen Disziplin des römischen Gottesdienstes so, wie sie waren, bestehen lassen,
dass der die Installierung der Priester betreffende Artikel nur die des reformirten Gottesdienstes betrifft,
dass den Verwaltungskammern das Collaturrecht mit nicht mehr Ausgedehntheit ist zugestanden worden, als die vormaligen: Autoritäten der Schweiz dasselbe besessen haben,
dass in den katholischen Kantonen der Einfluss der Verwaltungskammern und ihrer Kommissairs nicht weiteres als auf eine politische Aufsicht sich ausdehnen soll, wodurch man zu verhindern sucht, dass gegenrevolutionäre gesinnte und gefährliche Leute nicht (sic!) zu Stellen verwendet werden, durch die sie einen grossen Einfluss auf die Stimmung des Volkes gewinnen könnten" (Nr. 567).
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass sich das Direktorium bei seinen Verordnungen bezüglich der Besetzung der Pfarreien auch von den zulegt erwähnten politischen Rücksichten leiten liess. Allein ebenso gewiss ist, dass es in Folge dieser Rücksichten auch zu Massregeln griff, die sehr nützlich gewesen sein mögen, die sich aber mit den Vorschriften des katholischen Kirchenrechts gar nicht vereinigen liessen. So zog das Direktorium im Kanton Waldstätten das Kollaturrecht einfach an sich, weil es daselbst die Besetzung der Pfarreien durch helvetisch gesinnte Geistliche für unbedingt nothwendig hielt. Den 9. October 1798 dekretiere es: "Der Bürger Businger, der einstweilen als Pfarrer nach Stans geht, wird nebst der Oberaufsicht über die Unterrichts- und Erziehungsanstalten auch die Oberaufsicht über die gesammte Geistlichkeit in diesem Kanton halten, welche sich nach seinen Weisungen zu verhalten hat (Nr. 1343). Businger war von nun an Vertrauensmann der Regierung und machte derselben Vorschläge, wie die vakanten Stellen wieder besetzt werden könnten. Grosse Schwierigkeit bereitete namentlich die Besetzung von Beckenried, wo Pfarrer Käsli, "der geflüchtete Stifter unseres Unglücks" schreibt Businger, gewirkt hatte.
Die Kriegsereignisse des Jahres 1799 mochten andere Verordnungen veranlasst haben, die ebenfalls den katholischen Anschauungen nicht entsprachen: den 2. Februar 1799 wird dekretirt, dass die Bischöfe ohne Genehmigung der Verwaltungskammern in keinem Fall Beneficien verleihen können; den 26. Februar, dass alle Seelsorgerstellen durch die Verwaltungskammern besetzt werden sollen. "Die Geistlichen", wird beigefügt, "können, wenn sie wollen, vor der Einführung die Bestätigung seiten ihrer geistlichen Behörden einholen." Den 5. Wärs wird ihnen aber verboten, sich zu diesem Zweck ausser Land's zu begeben und sich an Jemanden anders zu wenden als an den bischöflichen Kommissar des betreffenden Kantons.
Indessen waren die gesetzgebenden Räthe bezüglich der Art, wie die geistlichen Führer des Volkes gewählt und in ihr Amt eingeführt werden sollten, immer noch rathlos geblieben. Dass sie aber doch auch an die schwierige Frage gedacht haben, beweist ein Beschluss vom 10. August 1798. Grosser Rath und Senat der einen und untheilbaren helvetischen Republik beschliessen an genanntem Tage, der Gemeinde Meggen im Kanton Luzern sei gestattet, einstweilen mit der Wiederbesetzung ihrer durch den Tod des Pfarrers erledigten Pfarrei zuzuwarten, "bis ein allgemeines Gesetz über die Art der Wiederbesetzung derselben wird gegeben sein." Inzwischen dürfe der Vikar die Obliegenheiten eines Pfarrers besorgen. Vier Tage später (den 14. August 1798) interpretierten die gesetzgebenden Räthe ein Dekret des Vollziehungsdirektoriums. Das Kloster Muri hatte den 23. Juli den Vikar Hunkeler zum Pfarrer von Sursee erwählt. Den 26. Juli übertrug aber das Vollziehungsdirektorium das Collaturrecht der Verwaltungskammer in Luzern und diese ernannte hierauf sofort
den Bürger Hübscher von Schongau, bisher Pfarrer in Muri, zum Pfarrer von Sursee. Die gesetzgebenden Räthe entschieden nun. das Dekret des Vollziehungsdirektoriums habe keine rückwirkende Kraft, Hunkeler sei Pfarrer von Sursee. Da die Verwaltungskammer gleichwohl an Pfarrer Hübscher festhielt, kamen die gesetzgebenden Räthe den 28. Oct. 1798 nochmals auf die Angelegenheit zurück und bestätigten den Bürger Hunkeler zum zweiten Mal als Pfarrer von Sursee.
Im Uebrigen griffen die gesetzgebenden Räthe nur indirekt durch Errichtung neuer Pfarreien in diese Dinge ein. So bewilligten sie den 15. Jan. 1799 der Gemeinde Vitznau, die den "beschwerlichen und oft mit Lebensgefahr verbundenen Weg nach Weggis" zurückzulegen hatte, um zur Kirche zu gehen, — in Erwägung, "dass es Pflicht der Gesetzgeber sei, dem Volk die Ausübung des öffentlichen Gottesdienstes auf alle mögliche Art zu erleichtern, es mit der Sittenlehre und mit der Tugend immer mehr bekannt zu machen und so der wahren Glückseligkeit immer näher zu bringen" , eine eigene Pfarrei zu bilden. Am 8. März schufen sie mit ähnlichem Dekret die Pfarrei Greppen, am 20. Mai die Pfarrei Hildisrieden, am 5. Febr. 1800 die Pfarrei Bauen, erweiterten den 29. März 1799 die Pfarrei Rothenburg u. s. w.
Wenn also einzelne Verordnungen des Vollziehungsdirektoriums in Sachen der Besetzung der Pfarreien Unzufriedenheit erregten, so hatten die gesetzgebenden Räthe die Unzufriedenheit nicht verschuldet. Unwillen erregten aber merkwürdiger Weise gerade in katholischen Gegenden die Dekrete, mit welchen das Direktorium dem Volke das uralte Recht, die Pfarrer zu wählen, genommen und entweder an sich gezogen oder den Verwaltungskammern der Kantone
übertragen hatte. Wohl in keiner Angelegenheit empfanden es die leitenden Staatsmänner. wie z. B. der Minister Stapfer, so bitter, dass es schwierig sei, in der einen und untheilbaren helvetischen Republik Verordnungen zu erlassen, die allen Theilen des Volkes gefielen, wie in der Sache der Pfarrwahlen. Noch am 14. Januar 1800 hatte der Berner Kirchenrath zu den Massregeln des acht Tage vorher beseitigten Direktoriums, aus denen man angeblich die "überdachtesten Zerstörungsentwürfe" wider die christliche Religion wahrnehmen konnte, auch die gerechnet, dass es, wie der Kirchenrath sich ausdrückt, "die Anstellung und Versorgung des Pfarrers von den Launen und Umtrieben listiger oder mächtiger Gemeindsgenossen abhängig machte, dadurch seine ganze Wirksamkeit lähmte und jeden Jüngling von Talent und Ehrgefühl von einem Berufe abschreckte, dem man sich beflissen hatte, den Stempel der Herabwürdigung aufzudrücken", d. h. dass das Direktorium eben doch da und dort den Gemeinden einigen Einfluss auf die Pfarrwahlen gestattete. Sechs Tage darauf aber findet es die neue Regierung für gut, zur Beruhigung des Volkes in einer feierlichen Proklamation u. A. zu erklären.
"An den Orten, wo die Gemeinden einigen Einfluss auf die Erwählung ihrer Pfarrer hatten, sollen sie denselben unter den nämlichen Bedingungen und unter Beobachtung der gleichen Formen beibehalten, an welche die andern Collatoren gebunden sind."
Diese Bedingungen bestanden aber einfach darin, dass die Collatoren den mit dem Collaturrecht verbundenen Verpflichtungen nachkommen und für die vollzogene Wahl die Bestätigung der kantonalen Verwaltungskammer einholten. Im Uebrigen wurde ausdrücklich erklärt, dass "die alte Kirchenzucht,
ihre Polizei, ihre Gebräuche, sowohl diejenigen, welche auf die Wiederbesetzung der Pfarreien Bezug hatten, als andere wieder hergestellt seien, sofern sie nicht durch ein ausdrückliches Gesetz abgeschafft worden oder mit den Grundsätzen der Konstitution im Widerspruch waren. "Damit war namentlich in den Waldstätten den Gemeinden das Recht, den Pfarrer zu wählen, zurück gegeben.
Nicht bloss der Berner Kirchenrath, sondern alle hervorragenden Männer der helvetischen Periode, deren Namen uns heute noch besonders sympathisch klingen, waren einstimmig darin, diese Einrichtung — nicht etwa für bedenklich zu halten oder zu missbilligen, nein — in der allerschärfsten und bittersten Weise zu verdammen.
Stapfer, der die Aeusserungen des Berner Kirchenrathes über die Wahl der Pfarrer durch die Gemeinden auf sich bezogen hatte, antwortete den Anklägern, er sei in der Sache nicht nur mit ihnen einverstanden, sondern er habe sich darüber viel kräftiger geäussert als sie: "Hier", fährt er fort, "ist der Anfang eines Aufsatzes, welchen ich über den Einfluss der Gemeinden bei der Wiederbesetzung ihrer Pfarreien in Nr. 34 des neuen helvetischen Tagblattes vom 10. August 1799 habe einrücken lassen: ""Ich klage zum Voraus vor meiner Nation alle diejenigen Mitglieder beider Räthe, welche mittelbar oder unmittelbar zu der Annahme und Einführung dieser unseligen Wahlmethode etwas beitragen werden, der Mitwirkung zu der Entwürdigung und Auflösung des geistlichen Standes, zu der Zerstörung alles vernünftigen Gottesdienstes, zu der Verunreinigung der Quelle aller Menschenbildung unter uns, und zu der Unheilbarmachung aller Mängel und Gebrechen unsers Volkscharakters an"" ("Einige Bemerkungen" e. S. 39 f.)
Der bischöfliche Kommissar Thaddäus Müller widmet in demselben Jahr 1799 der Frage "Soll man die Pfarrwahlen den Gemeinden überlassen?" eine 32 Seiten starke Broschüre (Nr. 566) und beantwortet die Frage "in Beziehung auf den katholischen Theil von Helvetien" mit einem ganz entschiedenen Nein. Die Gemeinden hätten keinen Begriff von dem, was ein Pfarrer sein und thun sollte; jeder "gelehrte Geistliche" sei dem Volke verdächtig; man sage, sie hätten gar keine Religion und hielten es mit den Franzosen; die aufgeklärtesten und besten Geistlichen würden bei der Pfarrwahl gegenüber unwissenden und übelberüchtigten Männern unterliegen, wenn diese nur gegen die Helvetik wühlten; die Republik würde ihre besten Freunde preisgeben und den Fortschritt der Volksbildung lähmen; es sei doch seltsam, wie man immer schreie wider "den Fanatismus und die Dummheit der katholischen Priester" und doch Alles thue, um das Reich der Dummheit und des Fanatismus möglichst zu befestigen.
Auch der Pfarrer Businger von Stans sieht (Schreiben an Minister Stapfer vom 2. März 1800, Nr. 1342) in dieser Wahlart eine Quelle "von frischer Unordnung und Unglück", "das Grab aller Volksaufklärung und Volksbelehrung". "Wird keine Einschrenkung in dem Stück getroffen, so werden wir immer schlechte Pfarrer haben, und stehen schlechte Religionslehrer an der Spitze der Volksleistung, so wird Waldstätten auf ein neues und gewiss für immer für wahre Sittlichkeit und Aufklärung verloren sein".
Diesen Citaten wollen wir nur noch die Aeusserung eines Mannes beifügen, der nicht im Verdacht steht, er habe nur pro domo geredet. Heinrich Zschokke, Regierungskommissär im Kanton Waldstätten, schreibt den 10. März 1800 von Schwyz aus an Stapfer (Nr. 1343):
"Bürger Minister,
Die Verordnungen des Vollziehungsdirektoriums in Rücksicht auf kirchliche Angelegenheiten waren freilich zuweilen sehr revolutionär und stifteten durch die Erbitterung der Gemüther einen unermesslichen Schaden; aber unter diesen Verordnungen war auch manche wahrhaft wohlthätige, wie z. B. die, welche dem unwissenden, leicht verführbaren Volke die Macht nahm, sich selbst nach Gutdünken Pfarrer zu wählen. — Ich erfahre, dass man gesonnen ist, dem Volke diese ihm, bei seiner gegenwärtigen Rohheit und Verstimmung äusserst gefährliche Macht zurück zu geben. Bürger Minister, es ist meine Pflicht, mich darüber bestimmt bei Ihnen zu erkundigen, ob dem so ist? — Sollte aber das Volk wirklich jene Freiheit ohne alle Einschränkung wieder erlangen: so sage ich Ihnen voraus, dass die Regierung dadurch die Rohheit und den unseeligsten Fanatismus von neuem bewaffnen, kirchliche Verfolgungen und Reaktionen unausweislich veranlassen und in vielen Gegenden es unmöglich machen wird, dass Licht und Humanität eindringen"....
Was Zschokke nur für eine Absicht der Regierung hielt, war bereits förmlicher, auch für die Waldstätte gültiger Beschluss. Indessen gelang es Männern, die seine Anschauung theilten, trotz dem Dekret des Vollziehungsausschusses, das die "alten Gebräuche bei der Wiederbesetzung der Pfarreien" neu aufrichtete, einen alten Gebrauch, der recht merkwürdig ist, abermals und nun für immer zu Falle zu bringen. Die alten demokratischen Kantone, die sich für die mit französischen Bajonnetten angebotene Freiheit nie recht erwärmen konnten, beanspruchten von Uralters her nicht bloss das Recht der Pfarrwahl, sondern sie hatten auch den "Gebrauch", den Pfarrer jedes Jahr der Wiederwahl zu unterwerfen.
Kaum wieder im Besitze ihres alten Rechts, liessen die Gemeinden ihre Pfarrer wissen, dass sie sich am wohlbekannten Tage nach alter Uebung vor der Gemeinde zu stellen hätten. Das war namentlich im Distrikt Sarnen der Fall. Die dortige Geistlichkeit sandte desshalb einen Abgeordneten an den bischöflichen Kommissar Thaddäus Müller mit dem Gesuch, dieser möchte doch bei der Regierung auf Unterdrückung der alten Uebung dringen. Müller that dies sofort (Schreiben an Stapfer vom 21. October 1800, Nr. 1407). Er sagt in seinem Briefe: "Ich darf Ihnen, Bürger Minister, nicht erst erklären, wie sehr es der Würde eines Volkslebens zuwider seye, und wie sehr es seine Freimüthigkeit in Bestrafung seiner Angehörigen durch seine Amtsreden hindere, wenn er alljährlich wieder vor seiner Gemeinde, gleichsam als seinen Richtern, erscheinen und sein Brod wieder von derselben erbetteln muss. Gewöhnlich erlaubte man sich bei solchen Anlässen auch gegen verdiente Pfarrer die grösste Unbescheidenheit und selbst Beschimpfungen, die sie in Gegenwart des ganzen Pfarrvolkes und selbst der Jugend sehr erniedrigen mussten. Der Parteigeist hatte da Freiheit, sich seinem Hass und seinen Vorurtheilen zu überlassen und unter dem Titel des Rechts und der erlaubten Ahndungspflicht auf die wüthendste Art einen Mann, der ihm im Wege stund, ohne dass sich dieser eine Rechtfertigung erlauben durfte, öffentlich zu beleidigen. Die ganze Gemeinde wartete auf den Ausdruck des Pfarrers, dass er wieder um die Pfarrei "anhalte", und wenn die Sache schon nur Formalität war, so musste doch dieser Ausdruck "anhalten" gebraucht werden; sonst wäre die Pfarrei als vakant erklärt worden." Müller theilte im Weitern dem Minister mit, dass im Distrikt Sarnen die "Ausstellung der Pfarrer", wie man es nannte,
am 3. November wieder vor sich gehen sollte und schlägt vor, rechtzeitig die nöthigen Gegenvorkehrungen zu treffen. Schliesslich bemerkt er noch, der Gebrauch sei im ganzen Kanton Waldstätten üblich gewesen und es wäre darum vielleicht rathsam, durch die Verwaltungskammer von Zug allen Geistlichen ansagen zu lassen, dass sie im Falle einer Vorforderung nicht verpflichtet seien, zu erscheinen.
Schon unterm 23. October erliess Stapfer eine bezügliche Weisung an die Verwaltungskammer des Kantons Waldstätten. Den Gemeinden wird darin förmlich untersagt, eine solche Wiederwahl des Pfarrers vorzunehmen. "Wenn aber", fügt er bei, "eine Gemeinde glaube, auf dieser Uebung beharren zu müssen, so möge sie ihre Gründe angeben." Es geschah nicht. Viele, die den bischöflichen Kommissar Thaddäus Müller in Luzern als ein Werkzeug der helvetischen Regierung zur Knechtung der katholischen Kirche betrachten, dürften doch wenigstens geneigt sein, ihm seine Mitwirkung zur Abschaffung der "Ausstellung" der Pfarrer und seine Bemühung zur Verhinderung der Wahl der Pfarrer durch die Gemeinden als zwei Verdienste um die Herstellung kirchlicher Religionsfreiheit anzurechnen. Es ist allerdings unleugbar, dass sich das Verhalten Müller's auch in diesen Dingen ja nicht etwa aus dem Bestreben erklärt, das katholische Volk in der Unmündigkeit zu erhalten, sondern aus der Absicht, es auch gegen dessen Willen zur Mündigkeit zu erziehen. Dürfen wir wohl hoffen, dass er heute unser Volk für reif genug halten würde, einen weisen und guten Gebrauch von Einrichtungen zu machen, die er vor 84 Jahren für sehr gefährlich und schädlich angesehen hat?
d. Kultusfreiheit.
I. Negative und positive bürgerliche Verordnungen bezüglich einzelner Kulthandlungen.
Um uns ein einigermassen vollständiges Bild von den Grenzen zu entwerfen, innerhalb deren die Behörden der helvetischen Republik den Kirchen freie Bewegung gestatteten, müssen wir schliesslich noch einen Blick auf die Seite des kirchlichen Lebens werfen, an die man zunächst denkt, wenn man allgemein von Kultusfreiheit spricht. Die freie Ausübung gottesdienstlichen Handlungen hatte schon die helvetische Konstitution mit den Worten gewährleistet: "Jede Art von Gottesdienst ist erlaubt, wenn er die öffentliche Ordnung nicht stört und nicht Herrschaft oder Vorzug verlangt." Darüber aber, ob und in wiefern eine gottesdienstliche Handlung die öffentliche Ordnung störe, entschied selbstverständlich einzig die bürgerliche Behörde. Diese konnte also doch in die Lage kommen, Verordnungen zu erlassen, die für ganze kirchliche Genossenschaften als Verhinderung gewisser gottesdienstlichen Handlungen erschienen. Nur davor durfte man sich sicher glauben, dass die Regierung etwa in positiver Weise gottesdienstliche Handlungen verlangen werde, welche der einen oder andern kirchlichen Gemeinschaft nicht zusagten.
Nun erliess aber die helvetische Regierung nach beiden Richtungen hin gewisse Verordnungen, die an und für sich recht unbedeutend waren, die aber doch einzelnen Volksschichten als Beweise dafür erscheinen konnten, dass die kirchliche Gemeinschaft, der sie angehören wollten, der Freiheit beraubt und damit auch die Religion gefährdet sei. Das gilt vom Verbot der Prozessionen und Wallfahrten, welches die Regierung unterm 4. April 1799 (Nr. 563) publizierte. Künftig sollte kein Bittgang über die Grenzen des Distrikts,
in welchem die betreffende Gemeinde lag, hinausgehen. Die Priester und Mönche, die die Prozession leiteten, wurden für jede Unordnung, die dabei vorkommen konnte, verantwortlich gemacht. Je drei Tage vor Veranstaltung des Bittgangs war dem Regierungsstatthalter oder Unterstatthalter von der Sache Kenntniss zu geben. — Damit waren die bisher vielfach üblichen gemeindeweisen Wallfahrten nach Einsiedeln und anderswohin unmöglich gemacht. Das Direktorium beabsichtigte, die Ansammlung grosser Volksschaaren an gewissen Centralpunkten zu verhindern und hatte hiezu seine guten Gründe. Der bischöfliche Kommissar Müller suchte durch Erlass eines Pastoralschreibens (vom 31. März 1799) die Verfügung der Regierung dem Volke annehmbar zu machen. Wallfahrten und Prozessionen nach entlegenen Ortschaften, sagte er, seien nicht bloss der Sittlichkeit sondern auch dem Feld- und Landbau nachtheilig, ein Anlass, "falsche, unpatriotische, ruhestörende Begriffe auszutauschen, boshafte Gerüchte schnell zu verbreiten und den Gemeingeist zu vergiften." Er gab desshalb den Geistlichen den Rath, die Prozessionen ganz aufzugeben und statt derselben in der Pfarrkirche einen Gottesdienst zu halten und in einer Predigt den Begriff des wahren Gebetes zu entwickeln.
Allein je leichter sich mit den Bittgängen andere als streng religiöse Dinge verbinden liessen, desto weniger waren Viele geneigt, diese Uebung fallen zu lassen. Müller schreibt unterm 23. Februar 1801 dem Minister der Wissenschaften, das Verbot des Direktoriums habe "grosse Sensation erregt und sei kaum irgendwo genau befolgt worden." Das Manifest des Vollziehungsausschusses vom 22. Januar 1800, das alle Gebräuche, die nicht durch ein förmliches Gesetz abgeschafft waren, wieder aufleben liess, galt als Erlaubniss, die Züge wieder
veranstalten zu dürfen. Umsonst regte der Kommissar Müller den Erlass einer definitiven gesetzlichen Verordnung über diese Dinge an. Er erhielt den 4. März 1801 die Antwort, eine derartige Massregel wäre in gegenwärtiger Zeitlage unklug, da das Volk zu sehr an diesen Gebräuchen hange (Nr. 1345). Dem Volk war damit förmlich bestätigt, dass das Direktorium, das die Prozessionen eingeschränkt, ein ungerechtes, religionsgefährliches Dekret erlassen hatte.
Nicht so rasch ging es mit der Wiederherstellung der Wallfahrten nach Einsiedeln. Diese konnten erst dann wieder aufblühen, wenn das Kloster wieder bevölkert war. Die Mönche hatten sich aber geweigert, den Burgerfeld zu leisten und lebten seither in der Verbannung. Den 18. August 1800 richteten der Pfarrer Ochsner und einige Bürger eine sehr lange Bittschrift an den Vollziehungsrath, des Inhalts, man möchte doch 6-8 Mönchen die Rückkehr gestatten, damit die Wallfahrten wieder in Gang kämen. Bis zur neuen Konstitution, welche die freie Ausübung der Religion zusicherte, habe der Bürger von Einsiedeln der Wallfahrt seine Nahrung verdankt. Die Wallfahrten seien aber immer ein Theil der katholischen Religion gewesen. Namentlich sei Einsiedeln seit Jahrhunderten ein von Pilgern häufig besuchter Ort, "wodurch der grössere Theil Helvetiens Nutzen gehabt." Ja, sagen sie, "Einsiedeln ist heute noch der anzügliche und geliebte Gegenstand des helvetischen Bürgers, in dem noch die starke Zuneigung seiner frommen Ahnen tief eingewurzelt liegt" (Nr. 564). — Man hätte wohl die Wallfahrt, nicht aber die Rückkehr der Mönche gestattet. Das Gesuch wurde den 3. Sept. 1800 nochmals abgewiesen. Erst als mit der zunehmenden Auflösung der helvetischen Republik auch der Bürgereid seine Bedeutung verlor, konnten die alten Verhältnisse wieder hergestellt werden.
Auffälliger als die Verordnungen über Prozessionen und Wallfahrten war die Forderung des Direktoriums, dass beim öffentlichen Gottesdienst für die Regierung gebetet werde. Selbst Laharpe, der sonst immer strenge daran festhielt, dass sich die Republik um gottesdienstliche Dinge nicht kümmern dürfe, wollte auf die kirchliche Fürbitte nicht Verzicht leisten. Unter seinem Präsidium nahm das Direktorium sogar eine Klage gegen die Pfarrer von Liestal und Reigoldswyl entgegen, weil diese sich erlaubten, eine andere Gebetsformel zu gebrauchen als die benachbarten Pfarrer und namentlich sich herausnahmen, die Ausdrücke "eine und untheilbare helvetische Republik" wegzulassen. Zu einer Bestrafung der Schuldigen kam es nun freilich nicht; denn bisher gab es gar keine obrigkeitliche Vorschrift, wie gebetet werden soll. Aber das Direktorium beschloss unterm 16. August 1799, die Lücke auszufüllen, und beauftragte den Minister Stapfer, ein Gebet für die Republik zu entwerfen. Es wurde insbesondere verlangt, dass die Gebetsformel geeignet sein müsse à rappeler les principes républicains qui fondent le régime politique actuel (Nr. 564).
Das Manuskript einer solchen Formel liegt bei den Akten und beginnt mit den Worten: "Wir danken dir, o Herr, dass du unter uns den Vollgenuss der unschätzbaren, durch deine Religion selbst verkündigten Menschenrechte hergestellt hast. Gestatte nicht, dass sie uns wieder geraubt oder geschmälert werden. Beschütze unsere auf die so heiligen Rechte gegründete Staatsverfassung und vereitle die Angriffe ihrer innern und äussern Feinde (Nr. 563). Vermuthlich hat man gefunden, dass ein solches Gebet nicht auf allen Lippen ein aufrichtiges wäre. Im gedruckten Gebetsformular fehlt dieser erste Passus und es enthält dasselbe nur eine ganz unvergängliche Fürbitte für Behörden und Volk. Den 22. Aug. 1799 wurde dieses helvetische Gebet
vom Direktorium bestätigt, im Oktober durch die Regierungsstatthalter sämmtlichen Pfarrern mitgetheilt. Die Regierungsstatthalter hatten die Weisung bekommen, es "ohne Aufschub" überall einzuführen und unter keinem Vorwand die Weglassung zuzugeben (Nr. 1345).
Dem Regierungsstatthalter des Kantons Bern, Bürger Planta, wurde hinterbracht, dass die gesammte kantonale Geistlichkeit es unterlasse, für die helvetische Republik zu beten. Statt sich ordentlich nach dem Thatbestand zu erkundigen, reichte er dem Direktorium sofort eine Klage gegen die ganze bernische Geistlichkeit ein. Diese wies mit Entrüstung die völlig unbegründete Anschuldigung zurück, und der Regierungsstatthalter Planta erhielt den 15. Januar 1800 von der neuen Regierung, dem Vollziehungsausschuss, eine so scharfe Rüge, dass er sich veranlasst sah, seine Entlassung zu nehmen (Nr. 564). Den 18. Januar aber wurde auch das vom Direktorium seit einigen Wochen eingeführte Gebet wieder für fakultativ erklärt und an den meisten Orten fallen gelassen (Nr. 1345).
Ein noch unglücklicheres positiver Versuch in Sachen des Kultus fällt auf Rechnung der gesetzgebenden Räthe. Es ist gelegentlich schon bemerkt worden, wie sich das Direktorium gegen die seit alter Zeit übliche Feier des eidgenössischen Bettags, die schon damals im September abgehalten wurde, vornehm ablehnend verhielt, weil es nicht seine Sache sei, sich in gottesdienstliche Dinge zu mischen. Die gesetzgebenden Räthe aber kamen auf den Gedanken, den 12. April, den Tag, an welchem die helvetische Republik proklamirt wurde, zu einem halb religiösen, halb politischen Festtag zu erheben. Sie erliessen den 7. März 1799 über diesen Gegenstand ein verhältnissmässig sehr langes Gesetz. Darnach sollte der Tag überall, "wo sich Artilleriestücke befanden", mit Freudenschüssen
und mit Glockengeläute begrüsst werden. "An allen schicklichen Orten" sollten die Nationalfarben wehen. Die Glaubensgenossen der verschiedenen Religionen werden eingeladen, eine Stunde nach Sonnenaufgang einen passenden Gottesdienst zu halten. Auf dem Hauptplatz jeder Gemeinde wird der Altar des Vaterlandes aufgerichtet; davor erscheinen die Greise, die über 60 Jahre alt sind und legen die Waffen nieder. Die waffenfähige Jugend hingegen nimmt die Rüstung entgegen. "Schöne gesittete Mädchen in reinlichem, einfachen Anzug" bieten alsdann den "künftigen Siegern" Sträusse und Kränze an. Nach Möglichkeit soll die Feier mit Musik und Gesang belebt und mit fröhlichen Tänzen beschlossen werden. Am Schlusse heisst es: "Männer ohne Bürgersinn, Weiber ohne Sittsamkeit, feige Jünglinge und ungerathene Kinder dürfen zu Hause bleiben." Am 14. März erliess das Direktorium über die projektirte Feier noch genauere Verordnungen, nahm diese aber schon den 21. März wieder gänzlich zurück, und den 5. April verschoben auch die gesetzgebenden Räthe das Fest "auf einen ruhigeren Zeitpunkt." Die Feier hat niemals stattgefunden.
Il. Oekonomische Lage der Kultusdiener.
Das waren recht unkluge und unnütze Belästigungen des kirchlich gesinnten Volkes, obwohl die erwähnten Verordnungen sicher ganz gut gemeint waren. Weit empfindlicher aber wurden die Kultusdiener durch eine Massregel berührt, die auch gut gemeint und in ihren Folgen sogar höchst segensreich war, die aber leicht als ein Mittel, die Ausübung des Gottesdienstes allmälig unmöglich zu machen, erscheinen konnte und sehr häufig auch in diesem Sinne gedeutet wurde. So bezeichnet selbst der Berner Kirchenrath in seiner Klageschritt
vom 14. Jan. 1800 die Aufhebung der Zehnten — diese Massregel meinen wir — als eine "Verschenkung, mit der man alle Hülfsquellen zur Besoldung der Lehrer in Kirche und Schule" abgegraben habe. Er thut dies im Zusammenhang mit der Anschuldigung, das Direktorium habe talentvolle Jünglinge vom geistlichen Berufe abgeschreckt. Wohl suchte der gesetzgebende Körper die Geistlichkeit durch die feierliche Erklärung zu beruhigen, es sei Pflicht "der Stellvertreter eines gerechten Volkes, dieser ehrwürdigen Klasse von Staatsbürgern, die ihrer Einkünfte beraubt, doch nicht aufgehört habe, mit gleichem Eifer ihrem Amte vorzustehen, nach Kräften zu Hülfe zu kommen" (Gesetz vom 22. August 1798). Solche, oft wiederholten, Versprechungen klangen wie Hohn, da die Staatskasse, die in Folge der gesetzlichen Erlasse über Zehnten und Bodenzinse für die Besoldung des Klerus verantwortlich geworden war, eben thatsächlich doch die Geistlichen fast ohne alle Besoldung liess. Der Kirchenrath des Kantons Bern rechnet dem Vollziehungsausschuss am Anfang des Jahres 1800 aus, dass allein die bernische Geistlichkeit für das Jahr 1799 noch 220,000 Fr. zu fordern habe. Viele Pfarrersfamilien kämpften mit der bittersten Noth. Gleiche Klagen richtet im Dezember 1799 der bischöfliche Kommissar Müller an die gesetzgebenden Räthe und an das Direktorium. Am Martinstag 1799 habe bereits das dritte Jahr begonnen, seitdem die Einkünfte der Geistlichen zu fliessen aufgehört hätten. Dabei würden gerade die Geistlichen am Meisten mit Einquartierungen belastet und bei der entsetzlichen Noth, die in einzelnen Theilen des ausgesogenen Landes herrschte, zuerst von den Armen in Anspruch genommen. Allein die Regierung konnte beim besten Willen nichts mehr thun: Die Franzosen hatten die Staatskassen geplündert; die Zehnten waren voreilig
aufgehoben; die fremden Heere verzehrten den geringen Ertrag der Felder; alle Hülfsquellen waren erschöpft. Die Freunde der neuen Ordnung theilten mit den Gegnern derselben das gleiche Loos. So setzt der Minister des öffentlichen Unterrichts den 12. August 1801 den Vollziehungsrath in Kenntniss, dass der bischöfliche Kommissar Müller seit drei Jahren kein Einkommen erhalten habe, und dass sich in Folge dessen seine Finanzen in einem "höchst zerrütteten Zustand" befänden. Auch P. Girard, der katholische Geistliche der helvetischen Behörden und zugleich erster katholischer Pfarrer zu Bern, beklagt sich in einem Brief vom 7. Juni 1801 darüber, dass er von dem ihm zugesagten Einkommen noch gar nichts erhalten habe. Erst mit dem Jahr 1802 besserten sich die Verhältnisse. Durch Dekret vom 28. Dez. 1801 wurde der Bezug der Zehnten und Bodenzinse wiederum den Kantonen überwiesen und diesen zugleich die Pflicht auferlegt, die Pfarrer und Schullehrer zu besolden. Das Dekret bemerkt aber ausdrücklich, dass die Geistlichen für die vier verflossenen Jahre nicht volle Entschädigung erwarten dürften; hingegen sollte ihnen von 1802 an wieder die ordentliche Besoldung ausgerichtet werden (Nr. 1339).
Wenn die helvetische Regierung ausser Stand war, die grossen Sorgen der Kultusdiener zu heben, so zeigte sie sich um so bereitwilliger, der Bitte um Hülfe bei kleineren Anliegen ein freundliches Ohr zu leihen. Sogar das Direktorium bekundete diesem eine Güte, die an das alte väterliche, aristokratische Regiment erinnern konnte. Nur waren es allerdings in der Regel fremde Mittel, mit denen die Regierung Freigebigkeit übte. So wenden sich die Buochser am Vierwaldstättersee, deren Dorf sammt Pfarrkirche beim Ueberfall der Franzosen niedergebrannt worden war, und die jetzt ihren
Gottesdienst in einer ärmlichen Kapelle hielten, mit der Bitte an's Direktorium, ihnen von den vielen überflüssigen Orgeln, welche die Luzerner besässen, eine übergeben zu lassen. Stapfer befürwortet dieses Gesuch den 4. Dezember 1798 (Nr. 564) und so bekamen die Buochser die Orgel der sog. marianischen Kongregation zu Luzern. — Die Gemeinde Eggenwyl im Distrikt Bremgarten schreibt dem Direktorium, sie hätte seit dem Jahre 1159 dem Kloster Muri den Zehnten entrichtet; dieses sei reich geworden, die Gemeinde aber so arm geblieben, dass sie zwar in ihrer Pfarrkirche drei Altäre, aber nur zwei Messkelche besitze und daher auch an hohen Festtagen gleichzeitig nur je zwei Messen lesen lassen könne oder dann aus der Nachbarschaft einen dritten Messkelch entlehnen müsse. Anspielend auf den Kirchenschatz im Kloster Muri, bittet die Gemeinde um einen dritten Messkelch. Das Direktorium gibt (Dezember 1798 Nr. 564) der kantonalen Verwaltungskammer die Weisung, der Gemeinde Eggenwyl "in Anbetracht ihrer guten politischen Haltung" zu willfahren. — Den 18. Januar 1799 wird die Verwaltungskammer des Kantons Waldstätten angewiesen, dem Pfarrer Businger in Stans den Mess- und Kommunionwein zu bezahlen. Dem Pfarrer Häfliger in Hochdorf wird den. 19. Dezember 1799 das gleiche Gesuch auf Kosten des Stifts Münster bewilligt (Nr. 564).
III. Befreiung der Geistlichen vom Militärdienst.
Die helvetische Republik bekundete indessen doch auch durch Gesetze und Dekrete von sehr grosser Tragweite, dass ihr ernstlich daran gelegen war, den durch die Verfassung ausgesprochenen Grundsatz der Kultusfreiheit in gerechter und billiger Weise zu verwirklichen. Dahin können wir schon das Gesetz
vom 14. Februar 1799 über die Befreiung der Geistlichen vom Militärdienst rechnen. Wer irgendwie mit der neuen Ordnung der Dinge unzufrieden war, sah in Artikel 26 der Verfassung, der die Religionsdiener von den Staatsämtern ausschloss und des Stimmrechts beraubte, eine Ungerechtfertigkeit, die in schreiendem Widerspruch stehe mit dem so laut proklamierten Grundsatz der Gleichheit aller Bürger. Allein, streng genommen, widersprach demselben auch das Privilegium, das man den "eingeweihten Religionsdienern sowohl wie den jungen Leuten, die sich (als Studenten der Theologie) dem geistlichen Stande gewidmet hatten", durch die Enthebung vom Militärdienst gewährte. Darin sah aber natürlich Niemand eine feindselige Zurückdrängung des Klerus. In kirchenfeindlichen Absicht war das Gesetz auch thatsächlich nicht erlassen, sondern, wie sich die gesetzgebenden Räthe ausdrücken, "in Erwägung dass auch bei einem Volk, dessen kriegerische Anlagen zur Erhaltung seiner Freiheit sorgfältig unterhalten und befördert werden müssen, die Regierung nicht unterlassen darf, durch wohlausgebildete Lehrer für die Moralität künftiger Generationen zu sorgen, sowie auch für die Aufnahme derjenigen Wissenschaften, welche der Menschheit am unentbehrlichsten sind." Zu den letzteren rechnete man hauptsächlich die Medizin; wie die Studenten der Theologie, so waren auch die der Medizin und Chirurgie vom Militärdienst befreit.
IV. Gesetz gegen Störung gottesdienstlichen Handlungen.
Aus dem Unglücksjahr 1799, in dem unser Vaterland von drei zahlreichen fremden Armeen zertreten wurde, stammt auch das Gesetz (vom 4. Mai 1799), das alle diejenigen, "welche durch öffentliche Unruhe religiöse Versammlungen und Ceremonien unterbrechen, Gegenstände des Gottesdienstes thätlich
beschimpfen, den Religionsdiener in seinen Verrichtungen öffentlich kränken oder ihn darin stören würden", mit einer Geldbusse von 32-100 Fr. oder mit Gefängniss bis zu drei Monaten belegen, wobei jedoch die Strafbestimmungen des Kriminalgesetzbuches ausdrücklich vorbehalten waren. Die Erwägungen, mit denen dieses Gesetz von den Räthen motivirt wurde, sind für den Geist der neuen Zeit recht charakteristisch. Das Gesetz wurde nämlich erlassen in der Erwägung, "dass die Konstitution jedem Bürger die freie Ausübung seiner Religion zusichert, — dass diejenigen, welche dem Gottesdienst gewidmete Gegenstände beschimpfen, die Rechte ihrer Mitbürger verletzen und die Gesellschaft beunruhigen, — dass es endlich Pflicht der Gesetzgeber ist, durch ein ausdrückliches Gesetz die Ausschweifungen zu verhindern, deren sich Leute schuldig machen, welche nicht von der Verpflichtung einer gegenseitigen Religionsduldung durchdrungen sind, die doch im Wesentlichsten der republikanischen Grundsätze liegt." Dieses Gesetz war in ganz Helvetien an den gewöhnlichen Orten anzuschlagen und namentlich bei den Armeen bekannt zu machen.
V. Duldung der Sekten.
Der durch Laharpe vertretenen Richtung im Direktorium ist es zu verdanken, dass nicht bloss die beiden grossen Kirchen Helvetiens zur ungestörten Ausübung ihres Kultus den nöthigen Schutz fanden, sondern dass das Recht freier Religionsübung auch kleineren, für sich bestehenden Genossenschaften nicht vorenthalten wurde. Der Minister der Künste und Wissenschaften war allerdings nicht abgeneigt, die Kultusfreiheit auf die Kreise der beiden bisher staatlich anerkannten Kirchen zu beschränken. Die Berechtigung hiezu schien ihm in der Verfassungsbestimmung zu liegen, nach welcher die Polizei den
Gottesdienst zu beaufsichtigen hatte, die Lehren und Pflichten, die gepredigt wurden, prüfen durfte und verpflichtet war, nicht bloss für Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung, sondern auch für den "Wohlstand und die Aufklärung des Volkes" zu sorgen. Das sei nicht möglich, wenn man die Kultusfreiheit auch den Sekten einräume. In dem Gutachten (vom 23. September 1799, Nr. 564), in welchem er Massregeln gegen den Prediger Wetzel in Mönthal fordert, redet er auch von den neu auftauchenden separatistischen Genossenschaften. Fast erloschen, sagt Stapfer, lebten sie in verschiedenen Kantonen wieder auf und hielten geheime Versammlungen. Während die ordentlichen Gemeinden ihre öffentlichen Gottesdienste hätten, welche die Polizei leicht überwachen könnte, sei das mit den sektiererischen Zusammenkünften nicht der Fall. Es seien " congrégations clandestines; présidées par des fanatiques et souvent influencées par des fourbes, des malveillans et des jongleurs politiques... il est connu que souvent les plus grandes infamies ont été pratiqués dans ces rassemblemens religieux clandestins". Stapfer vermochte aber Laharpe nicht von der Nothwendigkeit zu überzeugen, Massregeln gegen diese Sekten zu ergreifen. Ein Jahr später, den 16. August 1800, brachte der stellvertretende Minister der Künste und Wissenschaften, von May, die Angelegenheit abermals zur Sprache und legte dem Vollziehungsrath den Antrag vor, die separatistischen Versammlungen während der Stunden des öffentlichen Gottesdienstes und zur Nachtzeit zu verbieten, die Stundenhalter zu nöthigen, jede Versammlung vorher der Polizei anzuzeigen und obrigkeitlichen Personen allzeit den Zutritt zu gestatten. Allein auch der Vollziehungsrath stellte sich auf den Standpunkt unbeschränkter Kultusfreiheit und ging nicht auf die Sache ein. Indessen gab er doch
dem Justizminister Auftrag, auf die separatistischen Zusammenkünfte ein wachsames Auge zu richten (Nr. 564).
Vi. Ausdehnung der konfessionellen Parität auf alle Theile Helvetiens.
Man darf es wohl als ein Glück bezeichnen, dass es auch gegenüber den sektiererischen Genossenschaften zu keiner Einschränkung der Kultusfreiheit gekommen ist. Die betreffenden Massregeln hätten zu Konsequenzen führen können, welche auch deren Urhebern sehr unwillkommen gewesen wären. Namentlich wäre wohl zu befürchten gewesen, dass die neuen Ketzergesetze an katholischen Orten auch einfach auf reformirte, an reformirten auf katholische Genossenschaften Anwendung gefunden hätten. Damit wäre aber eine der werthvollsten Errungenschaften der helvetischen Periode wieder vereitelt worden: Die Ausdehnung der konfessionellen Parität auf alle Theile Helvetiens.
Nachdem der Grundsatz der Konstitution anerkannt war, dass jede Art von Gottesdienst erlaubt sei, "wenn dieser nicht Herrschaft oder Vorzug" verlange, waren in der helvetischen Republik konfessionelle Scheidungen zwischen einzelnen Kantonen oder Ortschaften gesetzlich unmöglich geworden. Im Gesetze von 13. Februar 1799, das jedem helvetischen Staatsbürger das Recht einräumt, sich in der Republik an jedem Ort ungehindert, ohne Einzugsgeld, niederzulassen, sein Gewerbe zu treiben, Grundbesitz zu erwerben, — ist konsequenter Weise von der Konfession des Staatsbürgers und der betreffenden Ortschaften gar keine Rede mehr. Dagegen hatten die gesetzgebenden Räthe am Tage vorher (12. Febr. 1799) erklärt, dass die Konstitution allen Religionen Duldung zusicherte und deren Bekenner zu gegenseitiger Verträglichkeit und Bruderliebe verpflichte; dass die die Rechte der Menschheit verletzenden Gesetze der alten
Regierungen abgeschafft seien und die um der Religion willen Verbannten ungehindert in die Heimath zurückkehren dürften. Fortan sollten die bürgerlichen Rechte aus keinen kirchlichen Rücksichten beschränkt werden dürfen, dagegen Jedermann befugt sein, da, wo er sich aufhielt, seine Religion auszuüben. Nur eine spezielle Anwendung dieser Grundsätze war es gewesen, wenn die gesetzgebenden Räthe schon den 2. Aug. 1798 alle Gesetze der früheren Regierungen, welche die Eingehung gemischter Ehen verhinderten oder erschwerten, als aufgehoben erklärten, und wenn sie den 29. Aug. 1798 Alle, welche wegen Eingehung einer solchen Ehe das Bürgerrecht verloren hatten, wieder in dasselbe einsetzten. Ganz Helvetien war in Folge dieser gesetzlichen Bestimmungen paritätisch geworden.
Praktisch kam dies zunächst am Regierungssitz zur Geltung. So lange Aarau Sitz der helvetischen Behörden war (vom 12. April bis 4. Oktober 1798), wurde in der dortigen Pfarrkirche für die katholischen Mitglieder der Räthe und der Exekutivbehörden auch katholischer Gottesdienst gehalten. Mit Bezug hierauf wurde den 15. Sept. 1798 folgendes Gesetz erlassen: "In Erwägung, dass die Verschiedenheit der Religion unter den Gliedern der obersten Gewalten Geistliche von beiden Religionen am Ort ihrer Sitzungen erfordert; in Erwägung, dass, wenn der Staat die Geistlichen der einen Religion für die Regierung bezahlt, er billigerweise auch die andern bezahlen solle, beschliessen die gg. RR., dass die für die obersten Gewalten nöthigen Diener der Religion durch den Staat bezahlt werden sollen." Demgemäss wurde nachträglich den 22. Dezember 1798 dem Probst Glutz von Schönenwerd, der den Gottesdienst in Aarau besorgt hatte, durch die gesetzgebenden Räthe für jede Messe eine Gratifikation von einem Louisd'or zuerkannt.
Im Oktober 1798 wurde Luzern Sitz der Centralbehörden. Sofort begannen die Verhandlungen, um daselbst reformirten Gottesdienst einzuführen. Ein Gesetz vom 10. Jan. 1799 bevollmächtigte das Direktorium, einen protestantischen Pfarrer zu wählen, der in deutscher und französischer Sprache Gottesdienst halten, der reformirten Jugend Religionsunterricht ertheilen und alle übrigen Pflichten eines Seelsorgers verrichten und dafür einen jährlichen Gehalt von 175 Louisd'or beziehen sollte. Auf Stapfer's Vorschlag wurde Pfarrer Herren von Murten in Aubonne gewählt und demselben zur Abhaltung des Gottesdienstes die Jesuitenkirche angewiesen. Die katholischen Luzerner scheinen nicht allgemein mit dieser Massregel zufrieden gewesen zu sein. Wenigstens klagt Fisch, Buchhalter des Finanzministeriums, unterm 14. März 1799 in einer Zuschrift an Minister Stapfer (Nr. 1342), dass der Gottesdienst durch "das Herein- und Hinauslaufen ungezogener Menschen und das Gewühl der Hunde" regelmässig gestört werde und die Reformirten meist "mehr geärgert als erbaut" die Kirche verliessen. Er bittet den Minister, doch dafür zu sorgen, dass wenigstens an den Kommuniontagen zu Ostern die Kirche nach Beginn des Gottesdienstes geschlossen werden dürfe. Allein Stapfer erwiderte, man könne den Katholiken nicht verbieten, in ihrer Kirche ein- und auszugehen; er ermahnte seine Glaubensgenossen zur Geduld, und versprach, dahin wirken zu wollen, dass ihnen eine Kirche zu ausschliesslicher Benutzung übergeben werden könne.
Nach der Uebersiedelung der helvetischen Behörden nach Bern (Ende Mai 1799) wurde durch ein Gesetz vom 19. Juni 1799 das Direktorium beauftragt, "so schleunig wie möglich" für Bern einen katholischen Geistlichen zu ernennen. Auf Stapfer's Vorschlag wurde den 25. Juni 1799 P. Girard
gewählt. Der Minister gibt ihm das Zeugniss eines ecclésiastique éclairé, moral, également versé dans les deux langues et à coup sûr agréable aux membres catholiques des deux conseils. Die Verwaltungskammer von Solothurn schickte (Begleitschreiben vom 23. Juli 1799) die nöthigen Kirchenparamente und Utensilien (Nr. 1342). Der katholische Gottesdienst wurde im Münster zu Bern gefeiert. Da nach dem Einzug der Franzosen die französische Kirche in ein Heumagazin verwandelt und der französische Gottesdienst ebenfalls nach dem Münster verlegt worden war, so gerieth man bezüglich der Zeit des Gottesdienstes in einige Verlegenheit. Stapfer berichtet dem Vollziehungsdirektorium unter'm 10. Dez. 1799, die katholische Gemeinde wünsche. den Gottesdienst zu einer früheren Stunde halten zu können, und die Municipalität der Stadt Bern wolle desswegen den Gottesdienst der französischen reformirten Gemeinde "an's Ende der Stadt" verlegen, was dieser Gemeinde sehr nachtheilig wäre. Er schlug desshalb vor, die französische Kirche ihrer alten Bestimmung zurückzugeben, was auch beschlossen wurde. Dahin folgten der französischen Gemeinde bald auch die Katholiken; der ungestörten Ausübung ihres Gottesdienstes wurde niemals ein Hinderniss in den Weg gelegt. Die reformirte Gemeinde zu Luzern wurde bald wieder unterdrückt und konnte erst im Jahre 1826 mit der Abhaltung eines öffentlichen Gottesdienstes neu beginnen und zwar nicht ohne dem heftigsten Widerspruch zu begegnen; die katholische Gemeinde zu Bern aber setzte auch nach der Auflösung der helvetischen Republik ihr Dasein ungestört fort.
Man wusste recht wohl, dass die Verwirklichung des Prinzips der konfessionellen Parität am Sitz der Centralregierung eine mehr als lokale Bedeutung habe und sich nicht bloss desswegen empfehle, weil es billig sei, den religiösen Gefühlen und
Gewohnheiten der verschiedenen Mitglieder der helvetischen Behörde Rechnung zu tragen. Der edle Sohn des Pfarrers von Höchstetten, Johann Rudolf Fischer, den Abt in seiner trefflichen Monographie Stapfer's "rechte Hand" nennt und der persönlich als ehemaliger reformirtes Geistlicher, bis zur Ankunft des erwählten Pfarrers, in Luzern den reformirten Gottesdienst besorgt hatte, entwarf als Sekretär des Ministers der Künste und Wissenschaften für den Inhaber des neu kreirten Postens eines evangelischen Geistlichen zu Luzern eine sehr ausführliche Instruktion. Artikel 3 derselben lautet: "Er (der reformirte Geistliche zu Luzern) ist Religionslehrer an einem paritätischen Ort. Hieraus fliesst die Pflicht der Toleranz — oder vielmehr die Pflicht, durch Wort und That die möglichste Annäherung und Freundschaft unter verschiedenen Glaubensgenossen herbeizuführen" (Nr. 1342).
Das gute Beispiel war nicht ohne gute Wirkung, wenn letztere auch nur langsam und nicht überall, wo man es erwarten durfte, zu Tage trat. Schon am Anfang des Jahres 1799 wandten sich die Reformirten verschiedener Gemeinden des Kantons Thurgau mit dem Gesuch an das Vollziehungsdirektorium, ihnen das Recht der Mitbenutzung der katholischen Kirchen der betreffenden Ortschaften einzuräumen. Die Petenten wurden durch Dekret vom 12. Febr. 1799 abgewiesen. Jedoch ladet das Direktorium im zweiten Alinea seines Beschlusses die reformirten Gesuchsteller ein, "sich mit den katholischen Einwohnern gütlich zu vergleichen, um durch freiwillige Uebereinkunft die gänzliche Gleichheit der Rechte in Bezug auf den Gebrauch dieser Kirchen zu erhalten, so wie es der Geist der Duldung, der Eintracht und des Patriotismus verlangt" (Nr. 564). Das war sehr schön gesagt; damit aber ein
Vergleich möglich sei, müssen eben beide Parteien Hand bieten. Auch hiefür sei ein Beispiel citirt. Unter'm 19. Jan. 1801 gelangen die Katholiken von St. Barthelémy im Kanton Leman unter begeisterter Anerkennung der neuen Regierungsform mit dem Gesuch an den Vollziehungsrath, ihnen die Ausübung ihres Kultus in der reformirten Kirche zu St. Barthelémy zu gestatten. Dies Mal hatte die Executivbehörde nicht nöthig, den Petenten zu empfehlen, sich mit den Bekennern der andern Konfession zu vergleichen; die Reformirten waren den katholischen Gesuchstellern zuvorgekommen. Der Regierungsstatthalter des Kantons Leman konnte auf demselben Blatt der Diese Worte wiederholte auch der katholische Pfarrer Jacottet von Assens, der bisher die Pastoration der Katholiken zu St. Barthelémy wahrgenommen. Am Schlusse desselben merkwürdigen Dokumentes ergreift gar der Bischof von Lausanne das Wort und urkundet propria manu: Je vois avec la plus grande satisfaction la condescendence de citoyens reformés et leur conserve une recognoissance éternelle Nr. 564). Es ist ganz selbstverständlich, dass der Vollziehungsrath ein derartiges Gesuch nicht abweisen konnte.
VII. Anerkennung der Kultusfreiheit Seitens kirchlicher Behörden.
Bedeutsamer noch als diese konkreten Anzeichen einer neuen Zeit ist ein Manifest, das in den ersten Tagen dieses Jahrhunderts entstand, eine unter dem Titel "Ueber die Rechte der Kirche und derselben freye Ausübung in unserm Staate" erschienene Denkschrift (gedruckt zu Bern bei J. A. Ochs, Petition beifügen: Leurs frères de la Communion protholiques et les protestants.
Buchhändler. 1800. 38 S.*). Da sämmtliche evangelischen Kirchenräthe der helvetischen Republik das hochinteressante Aktenstück unterzeichnet haben, müssen wir dasselbe als eine offizielle Kundgebung der gesammten protestantischen Kirche unseres Vaterlandes betrachten. Die Unterzeichner reden am Schlusse ihrer Erörterungen vom "Verhältniss der helvetisch-protestantischen Kirche zur katholischen und beider zu kleinern Religionsgenossenschaften". Es sei zu wünschen, sagen sie, dass die Freiheit, sich zu dieser oder jener Religionspartei zu halten, in ihrer jetzigen Ausdehnung fortdaure. Der Staat könne nicht mehr gestatten, dass der Uebergang von der einen Kirche zur andern die bürgerlichen Rechte schmälere. Es sei darum zu erwarten, dass solche Uebertritte künftig häufiger sein werden. Um zu verhindern, dass dies zu Feindseligkeiten Anlass gebe, sollte man ohne lange dogmatische Diskussionen die allgemeinen Glaubens- und Sittenlehren, die von beiden Kirchen angenommen seien, feststellen. Und mit Rücksicht auf diese gemeinchristliche Basis sollte man sich gegenseitig geloben, einander wegen der "übrigen Dissensus" nicht anzufeinden und Proselytenmacherei zu vermeiden. Von Seite der Reformirten würde versprochen,
den Katholiken an Orten, wo der Protestantismus die Religion des Volkes sei, die freie Ausübung des Gottesdienstes gerne zu gestatten. Gleiches würde von den Katholischen erwartet. Man würde sich auch gegenseitig versprechen, einander nicht zu zürnen, wenn Einer oder Mehrere zu der andern Kirche übergehen wollten. Kleinern Religionsparteien bleibe die Freiheit ihrer Uebung zugesichert.
Es gab auch unter dem katholischen Klerus Viele, die, wie ein P. Girard von Freiburg, ein Thaddäus Müller von Luzern, solchen Grundsätzen und Tendenzen von ganzem Herzen zustimmten; allein sie konnten ihre Gedanken nicht öffentlich aussprechen, ohne in den Augen ihrer kirchlichen Oberbehörden und der grossen Masse ihrer Amtsbrüder als Ungläubige und Abtrünnige zu erscheinen. Der Verfasser der "altkatholischen Antwort auf die neukatholische Frage" (einer Broschüre, die ohne Angabe des Druckortes ebenfalls i. J. 1800 erschienen ist) sucht dem Pfarrer Hübscher in Muri u. A. auch klar zu machen, "dass die in wesentlichen Stücken sich widersprechenden Lehrgebäude (der katholischen und protestantischen Kirche) unmöglich einen und eben denselben göttlichen Heiland zum Stifter haben könnten." Da nun die katholische Kirche die Lehre Jesu und der Apostel "rein aufweisen" könne, was auch ein Protestant nicht in Abrede stellen dürfe, so bleibe den Reformirten eben nichts anderes übrig, als entweder katholisch zu werden oder dann die "Himmelspforte allen Religionen zu eröffnen." Solches lasse sich an einem Protestanten begreifen. "Dass aber — so wird nun der katholische Pfarrer Hübscher apostrophiert — ein katholischer Priester, der seine heilige Religion als die alleinseligmachende erkennt; der alles daran sehen sollte, dieselbe auszubreiten, die Irrenden zu belehren und in den wahren Schafstall Jesu
Christi hineinzuführen, — dass ein katholischer Priester den Irrthum neben der Wahrheit auf den Altar sehen will; dass ein katholischer Priester Sätze behauptet, die der Glaubens-Sittenlehre unserer heiligen Kirche offenbar zuwider sind, — das ist beweinenswürdig" (S. 63).
Die Hand, welche die evangelische Kirche an der Schwelle unseres Jahrhunderts den Katholiken dargelegte, wurde von Niemanden erfasst. Gleichwohl bleibt das Manifest der evangelischen Kirchenrathe ein schönes Denkmal des versöhnlichen Geistes, der sich unter der Herrschaft der helvetischen Verfassung und Gesetzgebung in unsern vaterländischen Kirchen zu regen begann.
VIII. Theologische Schulen beider Konfessionen aus der Nationaluniversität
Als Pflanzstätte dieses versöhnlichen Geistes dachten sich die erleuchtetsten Männer der helvetischen Republik ein "Nationalinstitut" oder eine "Nationaluniversität." Kaum war die helvetische Republik in's Dasein getreten, so erhielt der mit dem Unterrichtswesen betraute Minister Stapfer von verschiedenen Seiten Zuschriften, in denen seine Aufmerksamkeit auf die Errichtung einer centralen Hochschule hingelenkt wurde. Bei den Akten liegt ein Gutachten, das vom 15. Mai 1798 datirt ist und vermuthlich den Professor Schulthess in Zürich zum Verfasser hat (Nr. 1422. Wie schon Balthasar, Bodmer und Jselin, die Stifter der helvetischen Gesellschaft, so wünscht auch der betreffende Zürcher eine National-Akademie, auf der die höhern Wissenschaften aller Art gelehrt würden. Auch P. Girard war anfänglich mit diesem Gedanken einverstanden, kam aber nachher auf die unpraktische Idee, in jeder Kantonshauptstadt eine Universität zu errichten (Gutachten aus
dem Anfang des Jahres 1799, Nr. 1422). Auch P. Girard verlangt, wie der Verfasser des Zürcher Gutachtens, dass auf der Hochschule katholische und protestantische Theologie gelehrt werde. Dabei bemerkt der edle Freiburger: Je dois ajouter ici que si par l'enseignement du chistianisme, le gouvernement ne doit blesser aucun des cultes chrétiens qui partagent l'Helvétie, il ne devra pas moins favoriser le rapprochement de tous les esprits et de toutes les opinions, en rapprochant tous les coeurs autant qu'il dépendra de lui. — Ebenso setzt der Berner Johann Rudolf Fischer in einem von ihm verfassten, von Minister Stapfer unterzeichneten Schreiben (vom 8. Dez. 1798, Nr. 1345) an die katholische Geistlichkeit des Distrikts Hochdorf im Kanton Luzern als selbstverständlich voraus, dass auf der zu errichtenden Nationaluniversität auch für bessere Ausbildung des katholischen Klerus gesorgt werde. Er schreibt: "Wenn die Gesetzgeber die Errichtung eines Nationalinstitutes verordnen, so wird für die Bildung künftiger Religionslehrer dadurch am Besten gesorgt sein. — Nur eine solche Anstalt kann ihnen Vielseitigkeit, wahre, gründliche und umfassende Gelehrsamkeit, Duldung, Geschmack verschaffen, und der nachherige Aufenthalt bei ältern Brüdern auf dem Land (als Vikare) wird alsdann das Werk vollenden."
Schluss.
Damit schliessen wie unsere Betrachtungen. — Das Urtheil über die kirchenpolitischen Gesetze und Massregeln der helvetischen Republik wird, wie das ja in solchen Dingen immer der Fall ist, ein sehr verschiedenes sein je nach dem Gesichtspunkt, von dem die Beurtheilung ausgeht. Wer die Helvetik vom Boden einer in sich abgeschlossenen, unantastbaren kirchlichen
Lehre und Gesetzgebung aus beurtheilt, muss sie wohl als den Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte verwünschen; denn es kann nicht geleugnet werden, dass die helvetische Republik einerseits Alles gethan oder doch wenigstens zu thun versucht hat, was geeignet war, den Einzelnen jede Loslösung von kirchlichem Verbande zu erleichtern, anderseits aber ohne Rücksicht auf Kirchenlehre und Kirchenrecht eine Reihe von Verordnungen erliess und eine Menge von Massregeln ergriff, welche als ebenso viele Störungen einer selbstständigen, den Ueberlieferungen gemässen Kirchenverwaltung bezeichnet werden müssen.
Nicht viel günstiger wird der urtheilen, der, was kirchliche Dinge angeht, vom Staate nur Eines verlangt, Indifferentismus, Vermeidung jeder fördernden oder wehrenden Einwirkung, die nicht nothwendig zur Handhabung der öffentlichen Polizei gehört. Wer darin das Heil sieht, wird zwar in der helvetischen Republik sehr achtungswerthe Gesinnungsgenossen finden, aber zugeben müssen, dass die helvetischen Behörden den Heilsweg thatsächlich nicht betreten oder doch an jedem Tag ihrer kurzen Regierung immer wieder verlassen haben. Auch wenn sie den ernstlichen Willen gehabt hätten, das Beispiel französischer Staatsmänner zu befolgen und gleichgültig an allen kirchlichen Dingen vorüber zu gehen, so wären sie durch die Verhältnisse gezwungen worden, sich mit denselben zu beschäftigen. Wer die helvetische Kirche nicht hatte, der hatte das Volk nicht. Die evangelischen Kirchenräthe Helvetiens durften am Anfang unseres Jahrhunderts mit Recht in dem oben erwähnten offiziellen Aktenstück folgende Definition formularen: "Die helvetische Kirche überhaupt im weitesten Sinne des Wortes ist die helvetische Nation selbst, in wiefern sie sich zur christlichen Religion bekennt." Da Letzteres fast ohne Ausnahme der Fall war, hatte die Einschränkung im Grunde keine Bedeutung.
Thatsächlich standen die leitenden Staatsmänner der helvetischen Periode weder auf dem Standpunkt eines besondern Kirchenthums, noch auf dem des kirchlichen Indifferentismus. Sie betrachteten sich als Repräsentanten des Volkes, das nicht aus zwei von einander trennbaren Theilen, einem bürgerlich gesinnten und einem kirchlich gesinnten, zusammengesetzt war, sondern. wie in der Seele jedes einzelnen Bürgers, so in seiner nationalen Seele religiöse und patriotische Gesinnung mit einander vereinigte. Darum haben die helvetischen Behörden das Volk, das sie repräsentierten, regiert, so gut sie es verstanden, in allen Dingen, die ihnen für das öffentliche Leben von Bedeutung schienen. Beurtheilt man ihre Leistung von diesem Standpunkte aus, so wird man sagen müssen, es seien manche verfehlte Versuche gemacht, manche unglückliche Massregeln ergriffen worden, aber es befinde sich auch heute in unserer ganzen Vorrathskammer kirchenpolitischer Gedanken nicht mancher, den die grossen Männer der helvetischen Periode in den zwei Jahren ihrer aufbauenden Thätigkeit vom 12. April 1798 bis zum 8. Januar 1800 nicht gedacht, nicht ausgesprochen und zu verwirklichen gesucht hätten.
Unsagbares Unglück mannigfacher Art ist in jenen Tagen über unser Vaterland gekommen; der Boden unserer alten Heimath wurde tief und schmerzlich durchfurcht; aber es wurde auch gesät und die Saat ging trotz allen Stürmen der damaligen und der nachfolgenden Zeit kräftig auf und wir dürfen uns heute mancher edlen Frucht freuen, die inzwischen heran gereift ist. Eine der werthvollsten ist die der nicht bloss gesetzlich geordneten, sondern in das Geistesleben unseres Volkes übergegangenen Glaubens- und Gewissens- und Kultusfreiheit.
Die alte Eidgenossenschaft kannte, abgesehen etwa von einzelnen paritätischen Städten und Gegenden, nur die Freiheit
der Kirchen, denen sie die Individuen auslieferte. Die Helvetik betonte oft zu einseitig die Freiheit der Individuen und verletzte die Gemüther durch Störung der kirchlichen Freiheit. Die neue Eidgenossenschaft wird die Freiheit der Individuen nicht einschränken, aber auch den Kirchen und kirchlichen Genossenschaften freie Bewegung gönnen, soweit dies nur mit der öffentlichen Ordnung verträglich ist, und nicht aufhören, ihnen ihren Antheil an der Arbeit zur Wohlfahrt unseres Volkes zu lassen und sie hierin thunlichst zu unterstützen; denn heute noch soll's gelten, was die evangelischen Kirchenräthe am Vorabend unseres Jahrhunderts ausgesprochen: "Die helvetische Kirche ist die helvetische Nation"; die Eine und untheilbare schweizerische Republik besteht nicht aus zwei von einander gesonderten Theilen, sondern aus dem, zwar verschiedene Sprachen redenden, in verschiedener Weise Gott dienenden und oft auch auf verschiedenen Wegen die bürgerliche Wohlfahrt suchenden, aber seinem Gott und seiner Heimath mit gleicher aufrichtiger Liebe und Hingebung zugethanen Einen Schweizervolk.
Anhang.
A. Wortlaut einiger wichtigerem Gesetze und Aktenstücke.
I. Bestimmungen der helvetischen Konstitution.
Art. 6.
Die Gewissensfreiheit ist uneingeschränkt, jedoch muss die öffentliche Aeusserung von Religionsmeinungen die Eintracht und Ruhe nicht stören. Jede Art von Gottesdienst ist erlaubt, wenn er die öffentliche Ordnung nicht stört und nicht Herrschaft oder Vorzug verlangt. Jeder Gottesdienst steht unter der Aufsicht der Polizei, welche das Recht hat, sich die Lehren und Pflichten, die gepredigt werden, vorlegen zu lassen. Das Verhältniss, in welchem irgend eine Sekte gegen eine fremde Gewalt stehen mag, darf weder auf Staatssachen, noch auf den Wohlstand und die Aufklärung des Volkes Einfluss haben.
Art. 24.
Ein jeder Bürger, wenn er zwanzig Jahre alt ist, muss sich in das Bürgerregisters seines Kantons einschreiben lassen und den Eid ablegen: "seinem Vaterlande zu dienen und der Sache der Freiheit und Gleichheit als ein guter und getreuer Bürger mit aller Pünktlichkeit und allem Eifer, so er vermag, und mit einem gerechten Hass gegen die Anarchie oder Ausgelassenheit anzuhangen." Dieser Eid wird von allen
jungen Bürgern, die das genannte Alter erreicht haben, in der schönen Jahreszeit an demselben Tage in Gegenwart der Eltern und Obrigkeiten abgelegt, und endiget sich mit einem bürgerlichen Fest. Der Regierungsstatthalter nimmt den Eid ab, und hält eine dem Gegenstand des Festes angemessene Rede.
Art. 26.
Die Diener irgend einer Religion können keine Staatsämter bekleiden, noch den Primarversammlungen beiwohnen.
Il. Aufhebung der Ketzergesetze.
Freiheit. Gleichheit. Im Namen der einen und untheilbaren helvetischen Republik. Gesetz.Nach angehörtem Bericht seiner Commission über die Nachwerbung (sur la demande) des Balthasar Schmidlins, gebürtig von Russwyl im Kanton Luzern, um Wiedereinsetzung in das helvetische Bürgerrecht und Aufhebung der über ihn als einjähriges Kind wegen den religiösen Meinungen seines zum Tode verurtheilten Vaters ausgesprochenen Verbannungsurtheils:
In Erwägung, dass es nur der Gottheit allein zukommt, über die Gedanken und Meinungen der Menschen zu richten;
In Erwägung, dass die Konstitution in Bezug auf diesen Grundsatz allen Religionen Duldung zusichert und ihre Bekenner zu gegenseitiger Verträglichkeit und Bruderliebe verpflichtet;
In Erwägung, dass die gegen viele helvetische Bürger von den ehemaligen Regierungen verhängten religiösen Verfolgungen die Rechte der Menschheit verletzt haben;
In Erwägung, dass die Verbannung des Balth. Schmidlins und seiner Familie nicht das einzige Unrecht dieser Art ist, welches Gerechtigkeit und Pflicht der Gesetzgebung Helvetiens gut zu machen gebieten, sondern dass noch eine Menge andrer wegen religiösen Meinungen ehemals verfolgter Bürger ein gleiches Recht auf ihre Vorsorge haben;
In Erwägung endlich, dass von dem Boden der Freiheit alle zurück gebliebenen Spuren der ehemaligen Verfolgungssucht vertilgt werden sollen.
hat der Grosse Rath, nachdem er die Urgenz erklärt, beschlossen:
1. Alle in Helvetien noch vorhandenen Strafgesetze der ehemaligen Regierungen gegen religiöse Meinungen und Sekten sind aufgehoben.
2. Alle nicht wegen irgend eines Verbrechens sondern bloss wegen religiösen Meinungen gegen helvetische Bürger von den ehemaligen Regierungen ausgesprochenen Strafurtheile sollen mit allen ihren Folgen vernichtet sein.
3. Alle bloss wegen religiösen Meinungen und wegen keinem Verbrechen verbannte helvetische Bürger und ihre Nachkommen werden für helvetische Bürger erklärt.
4. Diejenigen helvetischen Bürger, welche entweder selbst oder deren Eltern oder Voreltern wegen religiösen Meinungen bekannt (Druckfehler für: verbannt) worden sind und wieder in den Schooss ihres nun freigewordenen Vaterlandes zurück zu kehren wünschen, sollen dem Vollziehungs-Direktorium die Beweise vorlegen, dass sie entweder selbst wegen religiösen Meinungen verfolgt wurden oder Nachkommen solcher Verfolgten seien.
5. Sobald sie diese Beweise aufgelegt haben, so sollen sie in alle Befugnisse des helvetischen Bürgerrechts und in den Genuss der Gemeindsrechte ihres Ortes ohne weiteres eintreten können.
6. Alle unter dem Namen der Schandsäulen oder sonst auf irgend eine Weise errichtete und in Helvetien noch vorhandene Denkmäler religiöser Verfolgungen sollen sogleich abgeschafft werden.
7. Dieses Gesetz soll gedruckt, in ganz Helvetien kund gemacht, und allenthalben, wo es erforderlich ist, angeschlagen werden.
Der Präsident des Grossen Raths: Carmintran. Egg von Ryken, Sekretär. Maulaz, Sekretär.
Der Senat an das Vollziehungsdirektorium.
Der Senat der einen und untheilbaren Republik Helvetiens hat den hievor enthaltenen Beschluss des Grossen Raths in Erwägung gezogen und genehmigt.
Luzern, den 12. Hornung 1799. Der Präsident des Senates: Meyer von Arbon. Mittelholzer, Sekretär. Badoux, Sekretär. Publicirt den 13. Hornung 1799.
II. Freie Niederlassung.
Gesetz vom 13. Februar 1799.
...J. E. , dass die Bürgerrechte eine der wichtigsten dieser (alten) fehlerhaften Grundlagen waren, welche sich jedem Begriffe der Einheit entgegensetzten und den hohen Drang zum allgemeinen Wohl unterdrückten, indem sie den Helvetier nur an ein kleines Lokale fesselten, seine Anhänglichkeit an das Vaterland beschränkten, sein Interesse vereinzelten, seinen Wirkungskreis verengten, und oft sogar seinem Erwerbsfleiss die grössten Schwierigkeiten in den Weg legten; in E. ferner, dass die Grundsätze der Konstitution, der Freiheit und Gleichheit durchaus eine bessere Ordnung über diesen Gegenstand gebieten,
haben die gg. RR. beschlossen.....
5. Jeder, welcher nach dem 19. und 20. Art. der Konstitution ein helvet. Staatsbürger ist, kann in der ganzen helvet. Republik ungehindert an jedem Ort ohne sog. Einzugs- oder Eintrittsgeld seinen Erwerb suchen und treiben, sich niederlassen und ankaufen. Er geniesst als Einwohner durchaus die nämlichen Rechte, wie die Antheilhaber des Gemeinde- und Armenguts, diejenigen ausgenommen, welche diesen letztern in den 3 ersten §§ ausschliesslich vorbehalten sind (Nutzniessung der Gemeinde- und Armengüter. Doch waren die Gemeinden verpflichtet, jeden helvet. Staatsbürger auch als Antheilhaber an den Gemeindegütern anzuerkennen, wenn dieser die Einkaufssumme bezahlte).
IV. Gesetz gegen Störung gottesdienstlicher Handlungen.
Freiheit. Gleichheit. Im Namen der helv. einen und untheilbaren Republik. Gesetz. Luzern den 3. May 1799.
In Erw., dass die Constitution jedem Bürger die freye Ausübung seiner Religion zusichert.
In Erw., dass diejenigen, welche dem Gottesdienst gewiedmete Gegenstände beschimpfen, die Rechte ihrer Mitbürger verletzen und die Gesellschaft beunruhigen.
In Erw., dass es die Pflicht der Gesetzgeber ist, durch ein ausdrückliches Gesetz die Ausschweifungen zu verhindern, deren sich Leute schuldig machen, welche nicht von der Verpflichtung einer gegenseitigen Religionsduldung durchdrungen sind, die in dem Wesentlichsten der republikanischen Grundsätze liegt,
Hat der Grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit beschlossen:
1. Diejenigen, welche durch öffentliche Unruhe religiöse Versammlungen und Ceremonien unterbrechen würden, diejenigen, welche Gegenstände des Gottesdienstes thätlich beschimpfen, und diejenigen, welche den Religionsdiener in seinen Verrichtungen öffentlich kränken oder ihn darinn stören würden, verfallen in eine Geldbusse, welche für jeden Einzelnen die Summe von Einhunder(t) Franken nicht übersteigen, und nicht weniger als zwei und dreissig Franken betragen darf, oder in eine Gefängnissstrafe, welche die Dauer von drey Monaten nicht übersteigen kann, mit Vorbehalt der im peinlichen Gesetzbuch festgesetzten Straffen, wenn das Vergehen von solcher Art ist, dass diese letztern statt haben.
2. Die Vollziehung dieses gegenwärtigen Gesetzes ist provisorisch den Distriktsgerichten übertragen.
3. Dieses gegenwärtige Gesetz soll gedruckt, angeschlagen, und in ganz Helvetien besonders bei den Armeen bekannt gemacht werden.
Der Präsident des Grossen Raths: Zimmermann. Blattmann, Sekret. Grivel, Sekret.
Der Senat an das Vollz.-Direktorium.
Der Senat der einen und untheilbaren helvetischen Republik hat den hievor enthaltenen Beschluss des Grossen Raths in Erwägung gezogen und genehmigst.
Luzern den 4. Mast 1799. Der Präsident des Senats Mittelholzer. Bertholet, Sekret. Ziegler, Sekret. Publicirt den 6. Mai 1799. Präsident des Vollz.-Direktoriums. P. Ochs.
V. Stapfer an die Geistlichen Helvetiens.
Gedrucktes Circular, versandt den 15. Oct. 1708.
"An die Religionslehrer Helvetiens über ihre Pflichten und Bestimmung."
Nach kantischen Grundsätzen wird zunächst das Dasein Gottes, der die Tugend belohnen wird, gelehrt. Der Glaube an Gott sei die Voraussezung, dass wir dem Gewissen folgen. "Ohne von dem Dasein eines moralischen Reichs, dem jeder Mensch, sowie die ganze Natur untergeordnet ist, innig überzeugt zu sein, ist es unmöglich, der sittlichen Natur im Menschen die Uebermacht über die sinnliche zu verschaffen." Diese Ueberzeugung zu begründen und damit das moralische Gefühl zu beleben, sei die Anstalt nothwendig, die man Kirche nennt. . "Wären keine Versammlungen, welche ein sichtbares Bild des unsichtbaren Reiches der Sitten darstellten, würden keine symbolischen Handlungen öffentlich vorgenommen, welche diese Idee der Einbildungskraft vorhielten, würde die Gottheit nie öffentlich angeredet, so würde der Vernunftbegriff einer sittlichen Welt nie den Grad der Deutlichkeit und Lebhaftigkeit erreichen, auf dem er allein dauernde Wirkungen im menschlichen Gemüthe hervorbringen kann. Die Kirche ist also nichts als ein Versinnlichungs- und Belebungsmittel der Idee von einem Reiche Gottes, in der Absicht veranstaltet, um das moralische Gefühl gegen die Reizungen der Sinne zu waffnen." Darnach ergibt sich die Aufgabe der Religionsdiener.
Besonders eine repräsentative Demokratie könne ohne Moralität der Bürger nicht existiren. Diener des Staates seien die Religionsdiener, wenn sie bei allen ihren Amtsverrichtungen die Pflege des moralischen Gefühls im Auge haben. "Dass die Lehrer der Religion nur zu diesem Werke berufen sind, und dass alle unfruchtbaren Lehrmeinungen und leeren Gebräuche. die nicht zu seiner Ausführung beitragen, ein unwürdiges und unsittliches Spiel sind, lässt sich aus den angedeuteten Grundsätzen leicht begreifen.... Der innere Zwang (des Gewissens) wird allen äussern der öffentlichen Gewalt unnütz und den Staat selbst entbehrlich machen, so wie bei vollkommen entwickeltem sittlichen Gefühl die Kirche nicht mehr nöthig sein würde. Dies ist das Reich Gottes auf Erden. Um es zu gründen, ist der Stifter des Christenthums erschienen. Um es zu verbreiten und herrschend zu machen, dazu sind die Geistlichen da."..... "Die helvetische Regierung wird die Religionslehrer der verschiedenen Partheyen in dem Grade höher schätzen und für nützlicher halten, in dem sie ihre Amtsverrichtungen, ihre gottesdienstlichen Bücher, Handlungen, Gebräuche und religiöse Vorstellungen zur unmittelbaren Förderung der Moralität und zur Schärfung des Gewissens benützen und immer nur als Mittel und Werkzeuge, nie als Zweck betrachten werden. — Das Vollz.-Direkt. erwartet von den Geistlichen aller Religionspartheien, dass sie durch ihren Unterricht und besonders durch ihre Vorträge an religiösen Festtagen die hier in Erinnerung gebrachten Grundsätze zu verbreiten und zur Veredlung ihrer Mitbürger anzuwenden bemüht sein werden. Der Religionslehrer wird, in diesem Lichte angesehen, sich selbst weit ehrwürdiger erscheinen, als wenn er bloss als Organ der Gewalt und der Volkstäuschung behandelt und begünstigt würde."
Brudergruss und Achtung. Der Minister der Wissenschaften Stapfer.
VI. Circular an alle Klöster
(entworfen von Bronner, erlassen den 20. Mai 1799 von Stapfer).
Luzern den 20. May 1799.
Bürger und Bürgerinnen!
Die Ihr noch Kraft und Muth in Euch fühlt, Euern Mitmenschen nützlich zu seyn, empfanget das Gesetz, welches Alle in den Stand setzet, mit einer Aussteuer in die bürgerliche Gesellschaft zurück zu kehren und Euch durch Fleiss und Thätigkeit ein unabhängiges Leben zu bereiten. Die Klostergesellschaften haben sich selbst überlebt, ihre Aussichten sind verrückt; selbst die Eifrigsten fühlen kein Interesse mehr, in der Vervollkommnung ihrer Institute vorwärts zu schreiten. Die Aufopferungen, die man von Euch verlangt, sind jetzt ohne Zweck; nur Geduld, unnütze Lasten zu tragen, ermüdend ohne Werth; und Eure Lebensart beschwerlich ohne Erfolg. Ihr habt Gelübde abgelegt, aber nur in der Voraussetzung, der Zustand des Klosters, in das Ihr tratet, könne nicht anders als fortbestehen und Euer Beruf werde Euch stets eine ehrenhafte Versorgung gewähren. Aber Ihr seht, dass sich dieser Zustand geändert und diese Versorgung auf einen nur eben hinreichenden Unterhalt reducirt hat, dessen Ihr Euch doch erst durch Uebernahme der vorigen Beschwerden theilhaftig machen sollt. Ihr fühlet also wohl, dass die Bedingungen, unter denen Ihr Euch entsprosset, ein klösterliches Leben zu führen, nicht mehr die alten und Eure Gelübde bei ganz veränderter Lage aus ganz natürlichen Gründen auch nicht mehr verbindend sind. Diese Ueberzeugung kann freilich Niemanden aufgedrungen werden: aber Ihr, die Ihr sie habt, entschliesset Euch, wieder Theil an der Welt zu nehmen. Wendet die Kraft der Selbstverleugnung und die aufhaltende Geduld, welche Ihr im klösterlichen Leben erworben oder geübt habet, zur Erfüllung fruchtbareren und wohlthätigerer Pflichten im gesellschaftlichen Umgang an. Meldet euch unmittelbar beim Vollziehungs-Direktorium oder bei mir und lasst uns wegen der Aussteuer überein kommen, die nun jeder: Person, welche aus dem Kloster tritt, ein für alle mal gegeben werden darf. Bedenket, dass Ihr von mir beträchtliche Summen in die
Hand bekommt und dann durch Thätigkeit und Gewerbfliess Euer Glück selbst zu gründen vermögt. Ueberleget es wohl und folgt Euerm Herzen. Republikanischen Gruss!
Der Minister d. K. u. W.
VII. Stapfer an den päpstlichen Nuntius.
Luzern, den 16. Horn. 1799.
"Hochwürdigster Herr!
Die helvet. Reg. kann es nicht zugeben, dass in Helvetien irgend eine kirchliche Autorität auf einem Mann ruhe, welcher ihr Zutrauen verloren hat; und in diesem Fall befindet sich Ihr bisheriger Kommissar Krauer in Luzern. Ich habe daher vom helv. Vollz.-Dir. den Auftrag erhalten, Ihnen dieses Missverhältniss vorzustellen und Sie einzuladen, dass Sie durch eine zweckmässigere Wahl Ihres Delegirten die Interessen des Staates mit dem Ihrer Kirche besser vereinigen möchten. Nach der Entlassung des Kommissars Krauer kann nicht leicht ein anderer zu seinem Nachfolger ernannt werden, als derjenige, welchen schon das bischöfliche Zutrauen zu einem Vorsteher der hiesigen katholischen Kirche berufen hat. Es ist der Bürger Müller, Stadtpfarrer in Luzern. Diesem einsichtsvollen und rechtschaffenen Manne hat die helvet. Regierung durch mich die gehörigen Vollmachten ertheilt, um mit dem Fürstbischof von Konstanz alles zu verabreden, was das Zusammenwirken der bürgerlichen u. der geistlichen Behörden befördern kann. Wenn er zu gleichem Zweck auch zu Ihnen reisen wird, so bringt er die nämliche Vollmacht mit und Sie werden wohl dieselbe in keiner anderweitigen Formalität bewährt zu sehen verlangen, indem meine gegenwärtige Zuschrift Sie davon hinlänglich wird überzeugen können.
Da so viele dringende Zeitbedürfnisse Massregeln zur Beruhigung des Volkes erheischen, so werden Sie die Religion, Ihre geistliche Würde und die wahren Vortheile der Kirche am besten ehren und berathen, wenn Sie von Ihrem Ansehen einen solchen Gebrauch machen, dass zwischen allen Behörden Zutrauen und Eintracht befestigt werde.
Gruss und Hochachtung. Der Minister der Wissenschaften. Stapfer.
VIII. Thadd. Müller an den Minister der Wissenschaften und Künste
Luzern, den 13. April 1800.
Br. Minister!
Ich berichte Sie, dass der päpstliche Nuntius wirklich den Bürger Steinach, einen hiesigen Stiftskaplan, der durch einen Expressen, den er an den Nuntius geschickt, und durch Empfehlung der Kurie zu Konstanz und vorzüglich durch seine bekannten Grundsätze die Sache so schnell entschieden, zu seinem Commissar ernannt hat. Die Wahl hätte in mancher Rücksicht nach meinem Urtheil auf keinen schädlicheren Mann fallen können. Er ist das Centrum der Obscurantenparthey, frech und übermüthig. Neben ihm kann und will ich nicht arbeiten, sondern eher meine Stelle als bischöflicher Commissar renuntieren. Denn durch diesen Mann ist sowohl mein Wirkungskreis eingeschränkt als der Fortgang aller meiner Unternehmungen gehindert. Jedem Guten, das ich thun könnte, wird er durch Ausübung seiner, wer weiss? wie unbestimmten, aller bischöflichen Authorität trotzenden Vollmachten entgegenarbeiten. Ich halte es auch unter meiner Würde. von diesem Grossinquisitor abhängig zu sein und als Commissarius mit Suppliken an ihn zu gelangen. Die ganze besserdenkende Geistlichkeit, deren Geisel er ehemals als Secretär der bischöflichen Commentarien gewesen ist, würde mich verachten, wenn ich mit diesem Manne mich in Verbindung einlassen könnte. Glauben Sie meinen Worten nicht und wollen Sie diesen Curialisten besser kennen, so fragen Sie in Bern die B. B. Senator Pfyffer, Justizminister Meyer u. a. m. Schon gestern hat er mir eine Demüthigung angethan, da ich ihm nur den Wunsch, den die Regierung gehabt habe, äusserte, beyde Commissariate zu vereinigen. Nach langen Revolutionsunannehmlichkeiten will ich itzt nicht auf's neue der Sclave eines Popen seyn. So spricht aus mir der Sinn für Freyheit und Wahrheit. ,
Zugleich lege ich hier die officielle Nachricht des Sextars im District Sarnen bey über den Vorfall zu Giswyl. Ich hoffe, die Regierung werde hier ihre Stärke zeigen. Wenigstens hielt ich's für meine Pflicht, über ein Factum nicht zu schweigen, das der Anlass neuer Unruhen der unglücklichen Gegenden des Kantons Waldstätten seyn kann. Schon weiss der Pfarrer zu Lungern, ebenfalls
von der Verwaltungskammer erwählt. da durch die That seines Nachbars zu Giswyl die Aufmerksamkeit des Volkes auf ihn gerichtet ist und selbst Geistliche ihn Intrusum nennen. nicht, was er thun soll Sie sehen auch aus diesem Fall, wie nothwendig Einheit der Gesinnungen der geistlichen Behörden wäre, und dass ich nichts mit Kraft vornehmen kann, wenn der Pöbel vom Klerus bei einem Pöbelcommissar in allen Anordnungen Unterstützung findet.
Gruss und Hochachtung Thadd. Müller, bischöfl. Commissarius.
N. S. Möge nur von dieser Sache nichts mehr in die öffentlichen Blätter gesetzt werden, da das zu frühzeitige Einrücken der neulichen Nachricht ein ziemlicher Triumph für meine Gegner ist.
IX. Schreiben des päpstlichen Commissars Steinach an den Vollz.-.Ausschuss vom 17. Mai 1800.
Bürger President und Räthe, des Hohen Vollziehungs-Rath!
Mit ehrerbietigster Ergebenheit nemme Ich die Freyheit, die mihr von Unserem Hochwürdigsten H. Bischof unter dem 3. April und die von S. Excellenz H. Nuntio unter dem 8. April dieses jahrs zu geschickten Gewalts Briefe in Geistlichen sachen zu dispensiren Hochdero Gnädigsten Einsicht und Genehmigung zu übersenden. Dass diese einsendung so lange nicht erfolget bitte demüthigest mihr zu verzeihen mit theuerster Versicherung, das diese auss unerfahrenheit und furcht geschehen, denn Ich Kunnte mich nicht erinnern das mein Vorfahrer Carl Grauer seeligsten gedächtniss solche dem dortmahl hiesigen Directorio vorgewiesen habe, und weil Ich nur in diesem Nothfall ein substituierter Commissarius bin, so befürchtete Ich, mann dürfte mihr solchen Schritt für eine frechheit oder stolz ausdeuten, obwohl Ich schon vor etwas zeit von diesen beyden auss zutraulichen Vorsorg Copien an Bürger Vollziehungs Rath Dürler abgegeben, welche auch von B. Vollz.-Rath Frisching seyend ersehen worden.
Sobald Ich aber von Hohen Gonneren unter dem 15. Mey bin einberichtiget worden, das mann dieses von der Hohen Regierung erwarte, so verweilte Ich nicht angeschlossene Instrumente außfertigen zu lassen. Die Originalia habe zwar bey Handen, bin aber ganz Bereithwillig auch diese zu übergeben, welches mir aber in so weit beschwerlich fallen dürfte, weil bei ereignende Fall solche vorzuzeigen nothwendig haben dürfte, damit aber diese fidimirten Copien unbezweifelt anerkannt werden möchten, habe ich selbe der allhiesigen Verwaltungskammer zur Einsicht vorgelegt und die Copien mit Hochderselben Beyschrift und Insigill corroboriren lassen.
Ich bitte inständigst mihr meinen aufschub zu verzeihen, angeschlossene Documenta zu genehmigen, und mihr Hochdero nöthigen schuz und Protection zu erweisen. Solte noch etwas Ermangeln, so ersuche Hochselbe mich unerfahrnen zu leithen, ich werde Alles thun, was in meinen Kräften ist und stehts beweisen, das Ich in vollkommenster Ehrfurchtsvoller Hochachtung und Ergebenheit seye
Bürger President, und Vollziehungs-Räth unterthänigst: Verpflicht-Ergebenster diener paul Steinach Notarius, Kaplan und Commissarius apostolicus Luzern den 17. May 1800.
X. Der Kirchenrath des Kantons Bern an den Vollziehungs-Ausschuss.
Schreiben vom 14. Januar 1800,
unterzeichnet von J. Jth, Decanus, Präsident, und J. L. Stephani, Aktuarius des Kirchenraths.
"Es sind Thatsachen, die zu notorisch sind, als dass sie einiger Belege bedürfen, dass das in unserer helvetischen Constitution sehr zweideutig bestimmte Verhältniss des Staates gegen die Kirche auf diese letztere, weniger durch die Schuld des Volkes, das diese Constitution annahm, als durch die Maximen ihrer Verfasser und derer, die sie handhabten, von einem äusserst verderblichen Einfluss gewesen ist.
Wenn wir in dem dieses Verhältniss bestimmenden Artikel schon eine laut vor der Welt ausgesprochene Gleichgültigkeit gegen die die Menschheit nach ihren wahren Grundsätzen versittlichende und veredelnde christliche Religion zu entdecken glaubten, so konnten wir in der Art und Weise, wie die Diener dieser Religion in der Constitution selbst und seither unter dem Schutze der Befugniss, die sie der Böswilligkeit ertheilte, von den Machthabern derselben behandelt worden sind, den bittersten Hass gegen sie und die überdachtesten Zerstörungsentwürfe wahrnehmen.
Es war an dem Dasein eines solchen zerstörenden Plans um so weniger zu zweifeln, da seit dem Augenblicke, da er einer nicht argwöhnischen Vermuthung dargestellt wurde, alle zur Ausführung desselben dienenden Mittel mit einer systematischen Ueberlegtheit gebraucht worden sind.
Schon in der Constitution wurde über die Diener der Religion durch die Beraubung ihres Aktivbürgerrechts, durch ihre Gleichstellung mit den Vergeltstageten und mit den Verbrechern der Stab gebrochen. Schon dadurch wurde von Weitem her Fürsorge gethan, dass es künftig der Religion an talentvollen und eifrigen Lehrern und der Kirche an würdigen Vorstehern gebrechen sollte. So hatten in diesem Punkt die Verfasser derselben einen Schritt gewagt, den die ersten Urheber der fränkischen Revolution gegen Religion und Kirche nicht hatten wagen dürfen, und sie haben damit ihre Meister übertroffen.
Wir müssen, BB. Vollz.-Räthe, den bisherigen Machthabern die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, dass sie diese ihnen gebrochene Zerstörungsbahn seither mit festen und sichern Schritten verfolgt haben.
Dass die helvetische Geistlichkeit der Vormundschaft eines Ministers unterworfen wurde, dessen einseitiges Verhältniss stets im Dunkeln schwebte, und dem alle die Qualifikationen mangelten, die ihn zu ihrem Stellvertreter und Wortführer bei dem Staate hätten machen können;
dass man die vorigen kirchlichen Behörden nicht anerkannte und es bloss stillschweigend duldete, dass sie die Besorgung der religiösen Angelegenheiten ohne einige Leitung und Handbietung fortsetzten;
dass man durch die Aufhebung der Sittengerichte das Ansehen der Geistlichen zerstörte, ihren Einfluss auf die Volkstugend geflissentlich abgrub, und der wildesten Ausgelassenheit alle Dämme aus dem Wege räumte;
dass man die Geistlichen, diese Vorsteher der Kirchgemeinden, den bürgerlichen Behörden dieser Gemeinden unterwarf und sie gleichwohl für jedes bürgerliche Vergehen derselben, welches zu hindern ihnen alle Mittel entzogen waren, verantwortlich machte;
dass man auf blosse ununtersuchte Anzeigen hin, Geistliche wie überwiesene Verbrecher gefangen nahm, sie unter dem Schall der Trommel durch die Strassen schleppte, sie vor revolutionäre Kriegsgerichte zog und ihnen dann nach der unwidersprechlichen Erweisung ihrer Unschuld jede Genugthuung versagte;
dass man dem Pfarrer die Aufsicht über die Schulen in seinem Kirchensprengel entzog, fremde Aufseher an seine Stelle setzte und ihn auch dieses Einflusses auf die Volksbildung beraubte;
dass man seine Anstellung und Versorgung von den Launen und den Umtrieben listiger oder mächtiger Gemeindsgenossen abhängig machte, — dadurch seine ganze Wirksamkeit lähmte und jeden Jüngling von Talent und Ehrgefühl von einem Beruf abschreckte, dem man sich beflissen hatte, den Stempel der Herabwürdigung aufzudrücken;
dass man durch die Verschenkung der Kirchengüter, die in Zehnden und Grundzinsen bestanden, alle Hülfsquellen zur Besoldung der Lehrer in Kirche und Schule abgrund und sie statt der verheissenen Entschädigung darben liess; dass die Vollziehung das auf diese Entschädigung sich beziehende Gesetz der gesetzgebenden Behörden eigenmächtig beschränkte; — dass die dürftigen Vorschüsse in den verschiedenen Kantonen ungleich ausgetheilt wurden; — dass die Geistlichen des einzigen Kantons Bern für das Jahr 1798 noch L. 30.000 und für das Jahr 1799 noch wenigstens L. 220,000 zu fordern haben; dass Viele aus ihnen mit ihren Familien bei kostbaren Einquartierungen und anderen Lasten mit dem bittersten Mangel kämpfen; dass der gute Wille der Verw.-.Kammern mit einem ministeriellen Veto gelähmt wurde, und dass die Schulen, die Akademien und alle Unterstützungsanstalten zu Grunde gingen;
dass endlich die Vollziehung über die Anzeige ohne gesetzlichen Beruf und ohne bildende Vorbereitung sich in die Kirche eindrängender Lehrer, als über eine Sache, die den Staat nichts angehe, zur Tagesordnung schritt, und sich nicht fürchtete, dem Staat gefährliche Fanatiker ihren Unfug treiben zu lassen, wofern nur das Lehramt dadurch herabgewürdigt würde.
Das alles, BB. Vollziehungs-Räthe, sind Thatsachen, die als aneinander gerettete Mittel zu einem Zweck erscheinen, die Zerstörung des Christenthums in Helvetien, der die Organisirung der Unsittlichkeit und des Verbrechens und die Erschaffung eines Vorwandes war, das absichtlich zur Verwilderung gebrachte Volk mit einem eisernen Scepter beherrschen zu können.
Ihnen ist der Ruhm und das erhabene Verdienst um das Vaterland aufbehalten, diesen schon weit genug gediehenen Zerstörungsplan zu zernichten, der Religion und dem Gottesdienst ihre Würde wieder zu geben, — dem Volk die Leitung und die Tröstungen dieser Religion und dem Staate mit ihr die Stützen seiner Sicherheit und Wohlfahrt zu erhalten. Dadurch, dass Sie, BB. Vollziehungsräthe, dieses zu einer Ihrer ersten Massregeln machen, werden Sie der Regierung das Zutrauen des Volkes sichern und sich die Achtung des aufgeklärten Theils von Europa erwerben."
XI. Antwort des Vollziehungs-Ausschusses an den Kirchenrath von Bern vom 21. Januar 1800.
Der Vollziehungs-Ausschuss hat mit besonderem Vergnügen die Versicherungen von Zutrauen und Ergebenheit gelesen, die Ihre Zuschrift vom 14. Januar auf eine unzweideutige Weise aufstellt. Er hält sich durch dieselbe aufgefordert, Ihnen feierlichst zu erklären, dass er unter seinen Verpflichtungen keine höhere kennt, als die Religion, die mächtigste Stütze des Staates und die reichste Quelle der Volkswohlfahrt zu ehren, ihre Diener und Beförderer nach Kräften zu unterstützen, und die öffentliche Erziehung für Religion und Sittlichkeit so sehr als möglich zu begünstigen. Um dieses desto leichter und gewisser thun zu können, glaubt er mit allem
Recht erwarten zu dürfen, dass ihn Männer von Sachkenntniss und Vaterlandsliebe mit Bemerkungen und Vorschlägen unterstützen werden, die so, wie jene Ihrer Zuschrift, Religion und Sittlichkeit zum Grund und Zwecke haben. Die Regierung wird von denselben den Gebrauch zu machen wissen, der den Wünschen ächtpatriotischer Männer, denen Staatsversittlichung am Herzen liegt, entsprechen wird.
Auf die Stelle Ihrer Zuschrift, die gegen den Minister der Wissenschaften gerichtet und ihn zu beschuldigen scheint, als habe er an verschiedenen gehässigen Massregeln des gewesenen Directoriums einen zu wesentlichen Antheil gehabt, glaubt der Vollziehungs-Ausschuss Ihnen bemerken zu müssen, dass dieser Minister stets mit Eifer und standhaftem Nachdrucke gestrebet, das Interesse der Kirchen und ihrer Diener zu vertheidigen, und auch dann in Erfüllung dieser seiner Pflichten nicht ermüdet worden, wenn sich ihr von allen Seiten Schwierigkeiten entgegen gesetzt, die nur seine ausdauernde Geduld erheischten, um nicht muthlos zu werden. Der Vollziehungs-Ausschuss wünscht, dass der Minister in dieser Hinsicht nicht verkannt werde. Uebrigens ist der Vollziehungs-Ausschuss immer bereit. alle Klagen, so vor ihn gebracht werden, zu prüfen und nöthigenfalls die erforderlichen Abänderungen und Verfügungen zu treffen.
XII. Dekret des Vollziehungs-Auschusses vom 22. Januar 1800.
Kaum in Mehrheit vereinigt, ist derselbe die verschiedenen Zweige der Staatsverwaltung mit Aufmerksamkeit durchgegangen, um sich ihres gegenwärtigen Zustandes zu versichern. Die Gleichförmigkeit der Grundsätze, welche seine Glieder beseelen, lenkte seine ersten Blicke auf die Religion in der Person ihrer Diener und er nahm einen beschleunigten Gang gegen eine gänzliche Muthlosigkeit und Verwirrung in einem Fache, welches die erste Quelle aller Volksveredlung und alles Volksglückes ist, mit Schmerzen wahr.
Die verschiedenen Beschlüsse der Regierung, die darauf Bezug haben, wurden ihm vorgelegt, und die lebhafte Ueberzeugung von der dringenden Nothwendigkeit, den verschiedenen Aeusserungen der vollziehenden Gewalt eine ganz verschiedene Richtung zu geben, war die Folge dieser Prüfung.
Indem er sich von dem Resultat dieser Untersuchung Rechenschaft geben liess und dasselbe bestimmte, glaubte er sich's zur Regel machen zu müssen, von allen Neuerungen, die er vorfand. nur diejenigen in Kraft zu behalten, welche aus der neuen Ordnung der Dinge fliessen, mit Ausschluss derjenigen, welche der Uebertreibung ihrer Grundsätze und ihrem Missbrauche zuzuschreiben sind.
Infolge dieser Betrachtungen und in Erwartung der Gesetze, welche die Weisheit der gesetzgebenden Räthe Helvetiens verspricht, beschliesst er provisorisch, auf den Bericht seines Ministers des öffentlichen Unterrichts, was folget:
1. Die alte Kirchenzucht, ihre Polizei, ihre Gebräuche, sowohl diejenigen, welche auf die Wiederbesetzung der Pfarreien und Beneficien Bezug haben, als andere, sind in Betreff alles dessen, was nicht durch ein ausdrückliches Gesetz abgeschafft ist, oder den Grundsätzen der Constitution widerstreitet, in Kraft erhalten.
2. Die Verwaltungs-Kammern treten an die Stelle der Behörden der alten Ordnung der Dinge, um alle diejenigen Rechte auszuüben, die jenen Behörden in kirchlichen Angelegenheiten sowohl über Personen als Sachen zukamen.
3. Wenn sich ein Zweifel über die Frage erhöbe, ob dieser oder jener Gebrauch, diese oder jene kirchliche Ordnung mit der Verfassung übereinstimmt, oder ihre Grundsätze verletzt, so können die Verwaltungs-Kammern über diese Zweifel nicht absprechen, sondern sie werden die Sache der vollziehenden Gewalt zur Entscheidung vorlegen.
4. Die Verwaltungs-Kammern werden in verwickelten, einer Erörterung bedürftigen Fällen das Gutachten der Klassen, Synoden, Kollegien und Kirchenrathe einholen. Sie werden diese insonderheit in Betreff der Wiederbesetzung von Pfarreien oder ledigen Beneficien zu Rathe ziehen, und wenn sie nicht glaubten, ihren motivierten Empfehlungen beistimmen zu können, so werden sie die Sache der vollziehenden Gewalt vorlegen, welche nach Prüfung der Motive und auf angehörten Bericht ihres Ministers des öffentlichen Unterrichts entscheiden wird.
5. Das Collatur-Recht ist beibehalten, insofern es nicht Feudal-Ursprungs ist und die Collatoren die daran geknüpften Bedingungen erfüllt haben werden.
Jedoch sollen sowohl diese Arten von Ernennungen als auch die Wahlen der Bischöfe, Kapitel und anderer kirchlichen Behörden durch die Verwaltungs-Kammern bestätigt und ihre Wirkung auf gültige Bewegungsgründe hin einstweilen gehemmt werden. Diese Bewegungsgründe sollen durch den Canal des Ministers des öffentlichen Unterrichts der vollziehenden Gewalt vorgelegt und auf desselben Bericht hin gewürdigt werden.
6. Im Falle der Erledigung einer kirchlichen Stelle, deren Besetzungsart durch keinen alten Gebrauch benimmt ist, werden die öffentlichen Blätter sowohl die Erledigung, als den Tag der Wiederbesetzung anzeigen, damit die helvetischen Geistlichen der Kirchenpartei, welcher die Stelle gehört, sich schriftlich sowohl beim Collator als den Verwaltungs-Kammern melden können.
7. Auf erfolgte Erledigung eines einfachen Beneficiums werden die Verwaltungs-Kammern nach angehörtem Gutachten der Geistlichen des Hauptortes die Entscheidung der Regierung verlangen, um zu erfahren, ob das Beneficium wiederbesetzt oder die Verschenkung einstweilen aufgeschoben werden solle.
8. An den Orten, wo die Gemeinden einigen Einfluss auf die Erwählung ihrer Pfarrer hatten, sollen sie denselben unter den nämlichen Bedingungen und unter Beobachtung der gleichen Formen beibehalten, an welche die andern Collatoren gebunden sind.
9. Den Verwaltungs-Kammern und allen Collatoren ist auf das nachdrücklichste empfohlen, bei ihren Wahlen auf geleistete Dienste, Amtsdauer, Alter, ausgestandene lange Beschwerden, auf beschwerlichen und schwierigen Posten Rücksicht zu nehmen.
10. Alle bis auf diesen Tag in Kraft gebliebenen Beschlüsse des Vollziehungs-Directoriums sind in Betreff alles dessen, was sie den in dem Gegenwärtigen getroffenen Anordnungen Widersprechendes enthalten können, zurück genommen.
11. Die Vollziehung dieses Beschlusses ist dem Minister der öffentlichen Angelegenheiten übertragen.
B. Politische Verhältnisse zur Zeit der helvetischen Republik.
Die Einrichtungen der helvetischen Republik sind unserer Generation so fremd geworden, dass einige bezügliche Notizen hier am Platze sein dürften.
Am Anfang des Jahres 1798 erhob sich in verschiedenen Theilen der alten Eidgenossenschaft in Folge französischen Einflusses das Volk gegen die bisherigen Regierungen. In Basel, Luzern, Solothurn trat die aristokratische Regierung freiwillig zurück. Das Waadtland, bisher bernisches Unterthanenland, proklamirte den 24. Januar 1798 die Lemanische Republik, und eine unter General Menard eingedrungene französische Armee verdrängte die bernischen Truppen. General Brune, Menard's Nachfolger, besetzte den 2. März die Stadt Freiburg und rückte alsdann gegen Bern vor, wurde aber den 4. und 5. März durch den heldenmüthigen Widerstand der Berner bei Neueneck aufgehalten. Allein gleichzeitig war General Schauenburg mit einer Armee von 16,000 Mann vom Rhein her vorgedrungen und hatte den 2. März Solothurn besetzt; er schlug die Berner im Grauholz und hielt den 5. März seinen Einzug in Bern. Damit hatte die alte Eidgenossenschaft aufgehört zu existiren.
"Vom 5. März bis zum 12. April 1798 war die Schweiz ein erobertes Land." Die Eroberer waren eine Zeit lang unschlüssig, welche politische Gestaltung sie demselben geben wollten. Schliesslich adoptirten sie die inzwischen von dem Basler Peter Ochs in Paris entworfene Verfassung. Artikel 1 derselben lautete:
"Die helvetische Republik macht Einen unzertheilbaren Staat aus. Es gibt keine Grenzen mehr zwischen den Kantonen und den unterworfenen Landen, noch zwischen einem Kanton und dem andern. Die Einheit des Vaterlandes und das allgemeine Interesse vertritt
künftig das schwache Band, welches fremdartige, ungleiche, in keinem Verhältnisse stehende, kleinliche Lokalitäten und einheimischen Vorurtheilen unterworfene Theile zusammenhielt und auf's Gerathewohl leitete. So lange alle einzelnen Theile schwach waren, musste auch das Ganze schwach sein. Die vereinigte Stärke Aller wird künftig eine allgemeine Stärke bewirken." Nach Art. 4 bilden "Sicherheit und Aufklärung die Grundlagen des öffentlichen Wohles" und nach Art. 5 ist in der "Einen und untheilbaren helvetischen Republik" die Freiheit des Menschen unveräusserlich und nur beschränkt durch die Freiheit jedes andern und "die Verfügungen, welche das allgemeine Wohl unumgänglich erheischt."
Die in Artikel 18 der Verfassung vorgesehene Gebietseintheilung wurde theils durch die Proklamation des Generals Lecarlier vom 28. März 1798 theils durch spätere Beschlüsse der helvetischen Räthe mehrfach modificirt. Darnach zerfiel die helvetische Republik in 19 Kantone, deren Grenzen von denjenigen der früheren eidgenössischen Stände sehr verschieden waren. So gab es jetzt einen Kanton Baden, zu dem die Freien Aemter gehörten, einen Kanton Waldstätten, der Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug umfasste und zuerst Schwyz und nachher Zug zum Hauptorte hatte, einen Kanton Oberland mit dem Hauptort Thun, einen Kanton Aargau, Linth, Säntis, Lugano, Bellinzona, Leman, Rhätien e.
Die gesetzgebende Gewalt wurde durch zwei Kammern, den Senat und den Grossen Rath ausgeübt; in den Senat hatte jeder Kanton vier, in den Grossen Rath acht Mitglieder zu entsenden. Ein von beiden Räthen angenommenes Gesetz war rechtsgültig.
Oberste Verwaltungsbehörde war das Vollziehungsdirektorium, das aus fünf Mitgliedern bestand, sich aber zur Vorberathung und Vollziehung seiner Beschlüsse besonderer Minister bediente (Inneres, Justiz und Polizei, Künste und Wissenschaften, Krieg, Finanzen, Auswärtiges).
Die Kantonalsouveränetät war völlig aufgehoben und die kantonale Verwaltung einem Regierungsstatthalter übertragen, dem als vorberathende und vollziehende Behörde eine Verwaltungskammer zur Seite stand. Jeder Kanton war in besondere
Distrikte eingetheilt und in jedem derselben ein Unterstatthalter eingesetzt.
Den 12. April 1798 konnten in Aarau die Senatoren und Grossrathsmitglieder der Kantone Aargau, Bern, Basel, Freiburg, Leman, Luzern, Oberland, Schaffhausen, Solothurn und Zürich zusammentreten. Die Verfassung wurde vorgelesen und ohne jede Diskussion angenommen. Peter Ochs, der Verfasser der Konstitution und Präsident der konstituierenden Versammlung, verkündete alsdann vom Fenster aus der versammelten Volksmenge die Gründung der Einen und untheilbaren helvetischen Republik.
Hauptart der Republik war bis Ende September 1798 die Stadt Aarau. Hierauf siedelten die helvetischen Behörden nach Luzern und im Mai 1799 nach Bern über.
Im Schoosse der gesetzgebenden Räthe sowohl wie des Direktoriums standen sich immer schroffer zwei Parteien gegenüber, die "patriotische" und "republikanische". Erstere, unter Laharpe's Leitung stehend, drang im Vertrauen auf die Hülfe Frankreichs und zum Zwecke energischerer Durchführung gewisser Massregeln (Klösteraufhebung, Kriegsgesetze) auf eine "Purifizirung" der helvetischen Behörden. Ein "Staatsstreich", Auflösung der gesetzgebenden Räthe durch französische Intervention, sollte zum Ziele führen. Allein der Plan wurde bekannt und nun durch die gesetzgebenden Räthe den 7. Januar 1800 das Vollziehungsdirektorium aufgelöst. Statt neue Direktoren zu wählen, wie die Konstitution vorschrieb, ernannte der gesetzgebende Körper den 8. Januar 1800 einen "Vollziehungsausschuss" und stellte den Erlass einer neuen Konstitution in Aussicht. In Folge eines neuen Staatsstreiches trat den 9. August 1800 an die Stelle des Vollziehungsausschusses der "Vollziehungsrath". Von da an lösen Behörden und Verfassungsentwürfe in rascher Folge einander ab. Festere Zustände traten erst wieder ein, als Napoleon der nach Paris berufenen "helvetischen Consulta" eine neue Verfassung, die "Vermittlungsakte", übergab und den Freiburger Ludwig von Affry als ersten Landammann der Schweiz bezeichnete (29. Febr. 1803).
Inhalts-Verzeichniss. Seite Allgemeine Ideen und konstitutionelle Bestimmungen über Religionsfreiheit in der helvetischen Republik. . . . . . . . . 3 Spezielle Verordnungen und Massregeln der helvetischen Behörden zur Verwirklichung der verfassungsmässigen Religionsfreiheit 13 I. Individuelle Religionsfreiheit . . . . . . . . . . 13 a. Civilstands-Verordnungen . . . . . . . . . . 13 b. Religionsunterricht in der Schule; Schulgesetz . . . 15 c. Die Sittengerichte . . . . . . . . . . . . 24 d. Befreiung der Ordensleute vom klösterlichen Verband . 29 II. Kirchliche Religionsfreiheit . . . . . . . . . . 35 a. Gefährdung des dogmatischen und kirchenrechtlichen Lehrgebäudes; Bürgergeld . . . . . . . . . . . 35 b. Handhabung der Kirchendisziplin durch die bürgerlichen Behörden . . . . . . . . . . . . . . . 43 c. Beschränkung der Kirchenregierung . . . . . . . 53 I. Stellung der helvetischen Republik zur päpstlichen Autorität . . . . . . . . . . . . . . 53 ll. Stellung der helvetischen Republik zur bischöflichen Autorität . . . . . . . . . . . . . . 61 III. Stellung der Pfarrer in der helvetischen Republik 69 d. Kultusfreiheit . . . . . . . . . . . . . 84 l. Negative und positive bürgerliche Verordnungen bezüglich einzelner Kulthandlungen . . . . . . 84 ll. Oekonomische Lage der Kultusdiener . . . . . 89 III. Befreiung der Geistlichen vom Militärdienst . . 92 IV. Gesetz gegen Störung gottesdienstlichen Handlungen . 98 V. Duldung der Sekten . . . . . . . . . . 94 VI. Ausdehnung der konfessionellen Parität aus alle Theile Helvetiens . . . . . . . . . . . 96VII. Anerkennung der Kultusfreiheit Seitens kirchlicher Behörden . . . . . . . . . . . 101 VIII. Theologische Schulen beider Konfessionen aus der Nationaluniversität . . . . . . . . 104 Schluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 A. Wortlaut einiger wuchtigerer Gesetze und Aktenstücke . . 109 I. Bestimmungen der helvetischen Konstitution . . . . 109 II. Aushebung der Ketzergesetze . . . . . . . . . 110 lil. Freie Niederlassung . . . . . . . . . . . . 112 IV. Gesetz gegen Störung gottesdienstlichen Handlungen . 113 V Stapfer an die Geistlichen Helvetiens . . . . . . 114 Vl. Circular an alle Klöster . . . . . . . . . . 116 VIl. Stapfer an den päpstlichen Nuntius . . . . . 117 Vlll. Thaddäus Müller an den Minister der Wissenschaften und Künste . . . . . . . . . . . 118 IX. Schreiben des päpstlichen Commentars Steinach an den Vollziehungs-Ausschuss vom 17. Mai 1800 . . 119 X. Der Kirchenrath des Kantons Bern an den Vollziehungs-Ausschuss . . . . . . . . . . . . 120 XI. Antwort des Vollziehungs-Ausschusses an den Kirchenrath von Bern oom 21. Januar 1800 . . . . . 123 XII. Dekret des Vollziehungs-Ausschusses vom 22. Januar 1800 . . . . . . . . . . . . . . . 124 B. Politische Verhältnisse zur Zeit der helvetischen Republik 127






