Das Studium des klassischen Altertums in der Schweiz.
Rektoratsrede
gehalten zu Basel am 13. November 1890 von
Basel. DRUCK UND VERLAG VON ADOLF GEERING. 1891.
Der akademische Lehrer, sonst nur gewohnt zu seinen eigentlichen Schülern oder aber zu frei zusammengeströmter Versammlung zu sprechen, hat zweimal Gelegenheit vor die Behörden und vor seine Kollegen zu treten: zuerst beim Antritt des Amts, wo es gilt von der frisch begonnenen Lehrtätigkeit eine Probe zu liefern und dem neuen Kreis, in den man getreten ist, zu zeigen, was man etwa leisten kann, und dann ein zweites Mal, wenn einer durch das Vertrauen seiner Kollegen zum Rektorate berufen, an der Jahresfeier der Universität als deren offizieller Sprecher aufzutreten hat.
Für den Sprecher einer Antrittsrede liegt es nahe, im vollsten Sinne sein Fach zu vertreten, sich mit seinen Hörern darüber zu verständigen, was dessen Eigenart ist; was für eine Entwicklung die betreffende Disciplin gehabt hat; welche Aufgaben ihr in der Gegenwart und der Zukunft gestellt sind. Denn gerne wird sich der neue Ankömmling darüber ausweisen, wie er sich zu seinem Lehraufträge stellt. Aber auch eine Festrede, wie die heutige wo es allerdings die gesamte Hochschule zu vertreten gilt, wird einen derartigen Gegenstand nicht ausschliessen. Ist doch die Feier dazu da, dass sich die Universität rückblickend und vorausblickend auf sich selbst besinne und zugleich jedes ihrer Glieder sich sein Verhältniss zum grossen Ganzen der Universität und das seiner Disziplin zum Ganzen der Wissenschaft ins Bewusstsein rufe, sich auch ins Bewusstsein rufe, was diese seine Disziplin für jenes andere Ganze, das
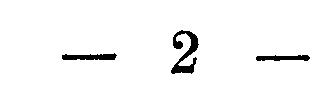 des Volkes, geleistet und zu leisten habe, was sie von ihm
empfangen habe und. noch empfangen könne.
des Volkes, geleistet und zu leisten habe, was sie von ihm
empfangen habe und. noch empfangen könne.
Wir sind gewohnt von nationaler Kunst, von nationaler Litteratur zu reden, weil es zu Tage liegt, dass der schaffende Künstler seine persönliche Eigenart und damit diejenige wie seiner Zeit so auch seines Volkes den von ihm geschaffenen Werken aufprägt. Kann man aber auch von nationaler Wissenschaft reden, da doch, wo und von wem immer wissenschaftlich gearbeitet wird, das Resultat immer dasselbe sein soll, es nicht mehrerlei Art wissenschaftlicher Wahrheit giebt? Aber abgesehen davon, dass dieses Ideal völliger Objektivität eben nur ein Idealist, so ist es schon für sich eine anziehende Aufgabe zu fragen, wie sich die Völker in wissenschaftlicher Anlage überhaupt unterscheiden, wie auch in deren verschiedenen Entwicklungsstufen im Zusammenhang mit sonstigen Veränderungen des Volkslebens sich diese Anlagen mehr oder weniger geltend machen. Man braucht bloss an den Gegensatz zwischen Griechen und Römern und bei den Griechen wiederum an den Gegensatz zwischen dem alexandrinischen und dem perikleischen Zeitalter zu denken.
Weiterhin liegt es zu Tage, dass bestimmte Wissenszweige von einzelnen Völkern mit Vorliebe vor andern gepflegt werden. Ja, dass manchmal kleinere Volksteile, einzelne Städte in auffallendster Weise eine lange Reihe von Koryphäen einer und derselben Wissenschaft aufweisen. Unsere Stadt mit ihren Bernoullis und den sich ihnen zugesellenden Mathematikern ist hiefür jedenfalls eines der ausgezeichnetsten Beispiele. Man hat etwa diesen eigentümlichen Vorzug, dessen sich Basel einst erfreute, aus der kommerziellen Beanlagung und Betriebsamkeit unserer Bürgerschaft und dem zugehörigen Rechentalent zu erklären gesucht. Der Wissenschaft dienstbar gemacht, habe sich dieses in mathematische Fähigkeit umgesetzt. Wie es sich immer mit dieser Erklärung verhalte, so wird die Aufspürung solcher innern Zusammenhänge immer etwas für uns Fesselndes sein. Es lassen sich ja mancherlei Einwirkungen, äussere und innere, thatsächlich nachweisen. Wir finden es
 natürlich, dass die grössten Leistungen auf dem Gebiet der
Nationalökonomik von England ausgegangen sind. Es wundert
uns nicht, dass die historischen Studien mehr gedeihen in
Deutschland oder in Frankreich, als in Amerika, mehr in
Ländern mit tausendjährigen Überlieferungen als in einem
Lande, dessen ganze Kultur in eminentem Masse durch seine
Überlieferungslosigkeit bedingt ist; dass sie mehr gedeihen
beim Occidentalen mit seiner Lebensenergie, seiner Wertschätzung
des Individuellen, seinem Sinn fürs Politische, als
beim alter Inder, dessen Auge, wofern es sich nicht an sinnlicher
Lust sättigen mochte, nur aufs Brahma gerichtet war,
und für den das reale politische Leben im Dasein eines schätzesammelnden
Despoten aufgieng. So ist es ferner nicht zufällig,
dass die Schweiz, das Land der Berge, eine Führerstellung in
der geologischen Wissenschaft einnimmt, und dass, wie schon
Cicero 1) bemerkt hat, es Bewohner einer weiten Ebene waren,
welche die Astronomie schufen. Natürlich dass auch innerhalb
der einzelnen Disziplinen das eine Gebiet bei jenen, das andre
bei diesen bevorzugt wird, dass auch in der Methode wissenschaftlicher
Forschung nationale Verschiedenheiten hervortreten.
natürlich, dass die grössten Leistungen auf dem Gebiet der
Nationalökonomik von England ausgegangen sind. Es wundert
uns nicht, dass die historischen Studien mehr gedeihen in
Deutschland oder in Frankreich, als in Amerika, mehr in
Ländern mit tausendjährigen Überlieferungen als in einem
Lande, dessen ganze Kultur in eminentem Masse durch seine
Überlieferungslosigkeit bedingt ist; dass sie mehr gedeihen
beim Occidentalen mit seiner Lebensenergie, seiner Wertschätzung
des Individuellen, seinem Sinn fürs Politische, als
beim alter Inder, dessen Auge, wofern es sich nicht an sinnlicher
Lust sättigen mochte, nur aufs Brahma gerichtet war,
und für den das reale politische Leben im Dasein eines schätzesammelnden
Despoten aufgieng. So ist es ferner nicht zufällig,
dass die Schweiz, das Land der Berge, eine Führerstellung in
der geologischen Wissenschaft einnimmt, und dass, wie schon
Cicero 1) bemerkt hat, es Bewohner einer weiten Ebene waren,
welche die Astronomie schufen. Natürlich dass auch innerhalb
der einzelnen Disziplinen das eine Gebiet bei jenen, das andre
bei diesen bevorzugt wird, dass auch in der Methode wissenschaftlicher
Forschung nationale Verschiedenheiten hervortreten.
Das bisher Bemerkte gilt auch für diejenige Wissenschaft, die ich an der hiesigen Universität zu vertreten die Ehre habe, für die klassische Philologie. Obgleich ihr Objekt, äusserlich betrachtet, ausserhalb der modernen Welt liegt, richtiger gesagt, alle Glieder der modernen Welt gleich nah angeht, ist doch der Anteil der modernen Völker an ihr ein ausserordentlich verschiedener und namentlich ein ausserordentlich wechselnder gewesen. Die Geschichte der Philologie hat zuerst von einem Prinzipat der Italiener, dann von einem solchen der Franzosen, dann von einem solchen der Engländer und der Holländer zu reden. Und in unserm Jahrhundert, wenigstens in dessen erster Hälfte, haben die deutschen Philologen in einem Masse die Führerschaft besessen, dass neben ihren Leistungen diejenigen der Gelehrten andrer Nationen einfach nicht in Betracht kommen. Und nationale Eigenart tritt hier sowol
 in der Auswahl des Arbeitsstoffes als in der Methode zu Tage.
Am deutlichsten bei den niederländischen Philologen ihre
Vorliebe für die Lateiner, dann ferner ihr Sammelfleiss und
ihre aufs Ausebnen und Ausgleichen gerichtete Textkritik
stehn mit der gesamten sonstigen Art ihres Volkes in engstem
Zusammenhang. 2)
in der Auswahl des Arbeitsstoffes als in der Methode zu Tage.
Am deutlichsten bei den niederländischen Philologen ihre
Vorliebe für die Lateiner, dann ferner ihr Sammelfleiss und
ihre aufs Ausebnen und Ausgleichen gerichtete Textkritik
stehn mit der gesamten sonstigen Art ihres Volkes in engstem
Zusammenhang. 2)
Wird eine Geschichte der klassischen Philologie in der Schweiz ähnliche bestimmte Resultate liefern können? Hier steigt freilich gleich das Bedenken auf, das sich allen Untersuchungen entgegenstellt, die sich mit der Schweiz in Rücksicht auf andere Dinge als ihr politisches Dasein befassen. Nationale Einheit in strengem Sinne kommt ihr ja nicht zu. Und der Gegensatz des Deutschschweizers zum Reichsdeutschen ist, so lebhaft er sonst seit dem Ende des XV. Jahrhunderts empfunden wurde, im geistigen Leben wol erst im XVIII. zum Bewusstsein gekommen, daraus aber dann gerade die lebendigste Teilnahm an deutscher Geistesarbeit und gerade erst der rechte Zusammenhang mit dem deutschen Geistesleben erwachsen. Immerhin, wenn man es hat wagen können, eine Geschichte der schweizerischen Kunst, eine Geschichte der deutschen Litteratur der Schweiz abzufassen, ja eine solche der französischen Litteratur der Schweiz mehrfach an die Hand genommen worden ist, und wenn diesen Wagnissen der Erfolg nicht gefehlt hat, weil eben auf dem Gebiet der Kunst und der Litteratur sich ein eigentümlicher schweizerischer Typus herausgestellt hat, so darf wol auch der Versuch gemacht werden, sich die Entwicklung der schweizerischen Wissenschaft oder einer schweizerischen Wissenschaft rückwärts blickend zurecht zu legen. Wir dürfen hoffen, hier Einflüssen der geographischen oder der ethnologischen und sprachlichen oder der religiösen oder, und insbesondre der politischen Eigenheiten unseres Landes zu begegnen, und auch an den Männern der Wissenschaft und ihren Arbeiten gemeinsam schweizerische, sie von den auswärtigen Fachgenossen trennende Eigentümlichkeiten zu entdecken. Übrigens werden wir uns fast gänzlich auf die deutsche Schweiz beschränken müssen.
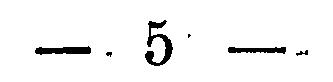
Philologie in unserm Sinn, Studium des Altertums um seiner selbst willen, Aufwerfung und Lösung daran sich knüpfender wissenschaftlicher Probleme, hat es in der Schweiz wie überall erst seit der Periode des Humanismus, erst seit dem Ausgange des XV. Jahrhunderts gegeben. 3) Aber immerhin dürfen wir auch hier nicht ganz der Stätten vergessen, an welchen in mittelalterlicher Zeit wenigstens Stücke der antiken Tradition weiter überliefert würden. Vor allem verdient das Kloster St. Gallen, dessen die Geschichte der deutschen Litteratur dankbar gedenkt, auch in der Geschichte unserer Wissenschaft eine ehrende Erwähnung. 4) An dem so bemerkenswerten Aufschwung der klassischen Studien seit Karl dem Grossen hat, wie das benachbarte Reichenau, so auch St. Gallen wacker Anteil genommen und mitgearbeitet und wenigstens bis in das XI. Jahrhundert hinein in unserm Lande die Leuchte der Wissenschaft hochgehalten. 5)
Allein schon als Bewahrern guter Handschriften antiker Texte müssen wir den St. Gallern dankbar sein. Anfangs arm an Büchern, hat das Kloster seit dem unter Ludwig dem Frommen amtierenden Abt Gozbert eine stattliche Sammlung besessen, die grossen Rufes genoss, sodass selbst an königliche Personen und hohe Geistliche Frankreichs und Italiens Bücher ausgeliehen werden mussten. Sammeleifrige und freigebige Mönche, sowie weltliche Gönner, unter denen Herzogin Hadwig als Schenkerin eines zierlichen Horaz zu nennen ist, sorgten für Vermehrung des Schatzes. In dem kunstvollen Klosterbau des IX. Jahrhunderts war für diese Zwecke ein besonderes Gebäude vorgesehen, mit einem obern Saal für Aufbewahrung, und einem untern, dem sogenannten Scriptorium, für Neuanfertigung von Handschriften. Obwol in der Bibliothek natürlich die kirchlichen Texte stark überwogen, so können wir doch, teils aus ausdrücklichen Mitteilungen über die Bibliothek des IX., X. und XI. Jahrhunderts, teils aus Berichten über spätere Beraubungen, auf eine stattliche Reihe klassischer
I.
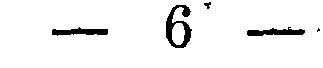 Schriftwerke, Dichter und Prosaisten, schliessen. Freilich
darf uns das nicht verleiten, uns die lebendige Kenntnis
der alten Sprachen und der alten Litteratur gar zu umfassend
vorzustellen. Insbesondere sind die etwa vorhandenen griechischen
Autoren gewiss fast gar nicht gelesen worden. 6) Bis zu
den Zeiten Ottos II. stand es ja mit dem griechischen Studium
in Deutschland überhaupt kümmerlich. 7) Und St. Gallen zeichnete
sich hierin vor andern Klöstern nicht aus, trotz der "Ellenici
fratres", deren einmal in einem Briefe gedacht wird. Man
lernte im Kloster wohl das griechische Alphabet schreiben,
wandte es auch etwa zur Aufzeichnung kurzer liturgischer
Stücke an. An Grösseres wagten sich die wenigsten. Und als
es dem gelehrtesten St. Galler des IX. Jahrhunderts, Notker
dem Stammler, gelungen war die Abschrift eines grössern
griechischen Textes zu Stande zu bringen, verdross das, wie
uns Ekkehard erzählt, den tückischen Sindolf so sehr, dass
er das Buch zerschnitt und zerriss. 8) Wirkliches Verständnis
des griechisch Geschriebnen war eine seltne Ausnahme. Gerade
der oben erwähnte Notker musste sich Origenes Commentar
zum Hohenlied von einem andern ins Latein übersetzen
lassen. Und im X. Jahrhundert musste man sich Kenntnis des
Griechischen auf dem Hohentwil holen, bei der angeblich von
byzantinischen Eunuchen geschulten Herzogin Hadwig. 9)
Schriftwerke, Dichter und Prosaisten, schliessen. Freilich
darf uns das nicht verleiten, uns die lebendige Kenntnis
der alten Sprachen und der alten Litteratur gar zu umfassend
vorzustellen. Insbesondere sind die etwa vorhandenen griechischen
Autoren gewiss fast gar nicht gelesen worden. 6) Bis zu
den Zeiten Ottos II. stand es ja mit dem griechischen Studium
in Deutschland überhaupt kümmerlich. 7) Und St. Gallen zeichnete
sich hierin vor andern Klöstern nicht aus, trotz der "Ellenici
fratres", deren einmal in einem Briefe gedacht wird. Man
lernte im Kloster wohl das griechische Alphabet schreiben,
wandte es auch etwa zur Aufzeichnung kurzer liturgischer
Stücke an. An Grösseres wagten sich die wenigsten. Und als
es dem gelehrtesten St. Galler des IX. Jahrhunderts, Notker
dem Stammler, gelungen war die Abschrift eines grössern
griechischen Textes zu Stande zu bringen, verdross das, wie
uns Ekkehard erzählt, den tückischen Sindolf so sehr, dass
er das Buch zerschnitt und zerriss. 8) Wirkliches Verständnis
des griechisch Geschriebnen war eine seltne Ausnahme. Gerade
der oben erwähnte Notker musste sich Origenes Commentar
zum Hohenlied von einem andern ins Latein übersetzen
lassen. Und im X. Jahrhundert musste man sich Kenntnis des
Griechischen auf dem Hohentwil holen, bei der angeblich von
byzantinischen Eunuchen geschulten Herzogin Hadwig. 9)
Auch manche lateinische Texte haben sich gewiss in der Bücherei eines ungestörten Schlummers erfreut, weil sich ja, wofür wir sehr dankbar sein müssen, 10) die Klöster des Mittelalters beim Sammeln und Abschreiben von Büchern nicht ausschliesslich von praktisch-pädagogischen Rücksichten leiten liessen. Immerhin hat die besonders im IX. Jahrhundert und um die Wende des ersten Jahrtausends blühende Klosterschule, die mit ihrer äussern Abteilung auch der klosterfremden Jugend zu Gute kam und ihren Einfluss weithin geltend machte, doch etwelches Studium der römischen Autoren gepflegt. Ausser den Grammatikern Donatus und Diomedes, die neben mittelalterlichen Compendien für den Unterricht in Grammatik und. Metrik dienten, wurde sicher Virgil, die Rhetorik an Herennius,
 Quintilian tractiert, auch in Dialektik und Astronomie
antike Texte benutzt, grösste Vorliebe freilich den Autoren
des ausgehenden Altertums, dem christlichen Dichter Prudentius,
dem Philosophen Boethius und besonders dem Encyclopädisten
Martianus Capella entgegengebracht. Für das hohe
Ansehen, das letzterer in St. Gallen genoss, ist es bezeichnend,
dass in das von Herzogin Hadwig dem Ekkehard geschenkte
Chorhemd eine Darstellung der durch Martianus
geschilderten Hochzeit des Merkur mit der Philologie eingestickt
war. Einzelne giengen in ihrer Privatlektüre natürlich
über die Schulautoren hinaus: der jüngere Notker z. B. entlieh
sich vom Bischof von Sitten unter anderm Ciceros Philippicae
und beschränkte sich, wie wir sehen werden, auch in seinen
Übersetzungen nicht auf jene Schulschriftsteller.
Quintilian tractiert, auch in Dialektik und Astronomie
antike Texte benutzt, grösste Vorliebe freilich den Autoren
des ausgehenden Altertums, dem christlichen Dichter Prudentius,
dem Philosophen Boethius und besonders dem Encyclopädisten
Martianus Capella entgegengebracht. Für das hohe
Ansehen, das letzterer in St. Gallen genoss, ist es bezeichnend,
dass in das von Herzogin Hadwig dem Ekkehard geschenkte
Chorhemd eine Darstellung der durch Martianus
geschilderten Hochzeit des Merkur mit der Philologie eingestickt
war. Einzelne giengen in ihrer Privatlektüre natürlich
über die Schulautoren hinaus: der jüngere Notker z. B. entlieh
sich vom Bischof von Sitten unter anderm Ciceros Philippicae
und beschränkte sich, wie wir sehen werden, auch in seinen
Übersetzungen nicht auf jene Schulschriftsteller.
In eigener Handhabung des Latein war man zeitenweis in St. Gallen recht weit. 11) Wol ist die Sprache der dort entstandnen Prosaschriften wie der lateinischen Gedichte von Klassizität weit entfernt und voll von Germanismen. Aber manchen merkt man es doch, oft zum Nachteil, an, wie stark deren Verfasser unter dem Einfluss ihrer klassischen Lektüre stehen. 12) Auch im mündlichen Gebrauch des Lateins herrschte zeitenweis grosse Strenge. Ekkehard II. zwang alle Schüler es zu sprechen und hielt scharf auf correcte Beobachtung der Regeln. Als zur Zeit seines Schulregiments der gelehrte, in der römischen Litteratur vorzüglich belesene Italiener Gunzo ermüdet nach St. Gallen gekommen sich im Gespräch einen Akkusativ statt eines Ablativs entschlüpfen liess, musste er sich dafür scharfen Spott gefallen lassen, worüber er sich hernach in einem Brief an die Reichenauer Mönche bitter beklagte. 13)
Hand in Hand mit dem Schulunterricht gieng nun auch ein Stück wissenschaftlicher Beschäftigung mit der lateinischen Litteratur: Übersetzungen und Kommentare. 14) Zwar die ältesten Versuche, wie das deutsche Credo und das deutsche Paternoster aus dem Ende des VIII. und die Übersetzung der Benediktinerregel aus dem Anfang des IX. Jahrhunderts, zeigen noch erstaunliche Irrtümer: Pontio im Namen des Pilatus ist für
 potentia genommen und anguis mit unguis, amentia mit amantia
verwechselt. Um so anerkennenswerter sind die zwei Jahrhundert
jüngern Arbeiten des bedeutendsten St. Galler Übersetzers,
Notker Labeo. "Aus Liebe zu den Schülern", "um ihnen
den Zugang zu lateinischen Texten zu erleichtern" unternahm
er, wie er sich ausdrückt, rem paene inusitatam, die Übersetzung
solcher Texte in das lebendige Deutsch seiner Zeit.
Welchen Wert der Geschichtschreiber der deutschen Sprache
und derjenige der deutschen Litteratur dieser Thätigkeit Notkers
beilegen muss, ist bekannt. Für uns hier bemerkenswert
ist erstens die Richtigkeit der Übersetzungen, die Sicherheit des
Verständnisses, die daraus hervorleuchtet, und zweitens der
Litteraturkreis, den sie beschlagen. Es ist zu bedauern, dass
gerade die zwei eigentümlichsten Wagnisse, die Hirtengedichte
Virgils und das Mädchen von Andros des Terenz, nicht an uns
gelangt sind: letzteres wäre als eine Art Gegenstück zu den
sechs dem Terenz nachgedichteten lateinischen Komödien der
Hrotsuit von Interesse.
potentia genommen und anguis mit unguis, amentia mit amantia
verwechselt. Um so anerkennenswerter sind die zwei Jahrhundert
jüngern Arbeiten des bedeutendsten St. Galler Übersetzers,
Notker Labeo. "Aus Liebe zu den Schülern", "um ihnen
den Zugang zu lateinischen Texten zu erleichtern" unternahm
er, wie er sich ausdrückt, rem paene inusitatam, die Übersetzung
solcher Texte in das lebendige Deutsch seiner Zeit.
Welchen Wert der Geschichtschreiber der deutschen Sprache
und derjenige der deutschen Litteratur dieser Thätigkeit Notkers
beilegen muss, ist bekannt. Für uns hier bemerkenswert
ist erstens die Richtigkeit der Übersetzungen, die Sicherheit des
Verständnisses, die daraus hervorleuchtet, und zweitens der
Litteraturkreis, den sie beschlagen. Es ist zu bedauern, dass
gerade die zwei eigentümlichsten Wagnisse, die Hirtengedichte
Virgils und das Mädchen von Andros des Terenz, nicht an uns
gelangt sind: letzteres wäre als eine Art Gegenstück zu den
sechs dem Terenz nachgedichteten lateinischen Komödien der
Hrotsuit von Interesse.
Durch diese Notker'schen Übersetzungen nimmt St. Gallen im deutschen Mittelalter eine ganz hervorragende Stellung ein. Zwar auch anderwärts sind lateinische Texte ins Deutsche übertragen worden. Und zumal der unbekannte fränkische Übersetzer des Isidor und der zugehörigen Texte hat dieser Aufgabe zwei Jahrhunderte vor Notker, zu einer Zeit wo man, wie wir eben sahen, zu St. Gallen noch tief in der Barbarei steckte, mit einer Lateinkenntnis und einem Sprachsinn obgelegen, 15) dass man ihn Notker zum mindesten gleichstellen darf. Aber dieser Franke hat sich, wie alle andern, auf geistliche Texte beschränkt. Und aus den auf Notker folgenden Jahrhunderten sind nur wenige und nur ziemlich dürftige Versuche zu deutschen Übersetzungen aus klassischen Autoren zu verzeichnen.
Notker hat sich aber nicht aufs blosse Übersetzen beschränkt, sondern in einer für uns auffälligen Weise den einzelnen zuerst lateinisch und dann in deutscher Übersetzung gegebenen Sätzen einen Kommentar beigegeben, der von grosser
 Sachkenntnis auf allen Gebieten und von achtungswerter Belesenheit
zeugt.
Sachkenntnis auf allen Gebieten und von achtungswerter Belesenheit
zeugt.
Notker bezeichnet wie den Höhe-, so den Endpunkt von St. Gallens gelehrtem Treiben. In den Wirren des XI. Jahrhunderts beginnt das Kloster zu sinken. Am Ende des XIII. ist es so weit gekommen, dass der Abt und eine ganze Anzahl von Mönchen sich des Schreibens unkundig bekennen müssen. Die Schätze der Bibliothek liess man gänzlich verkümmern. Mit dem Ruhm klösterlicher Wissenschaft war es damals fast überall in Deutschland zu Ende..
Mit St. Gallen verlassen wir zugleich die mittelalterliche Zeit. Was in andern Klöstern unseres Landes, was in Domschulen und Stadtschulen etwa für Latein geleistet wurde, liegt fast alles zu weit ab von dem, was wir wissenschaftliche Arbeit nennen, als dass wir uns hier eingehend damit beschäftigen könnten. Den im , XIII. Jahrhundert an der Münsterschule zu Zürich tätigen Konrad von Mure, der durch sein grammatisch-encyklopädisches Handbuch Novus Graecismus und andre lateinische Gedichte für sein Andenken gesorgt hat, genügt es mit einem Wort erwähnt zu haben. Es ist jetzt Zeit, dass wir uns zum fünfzehnten Jahrhundert, zum neuerstehenden Humanismus hinwenden.
II.
Es versteht sich für jeden Kenner jener Zeit von selbst, dass unsere geschichtliche Betrachtung nun für länger wird in Basel verweilen müssen. 16) Schon das grosse Konzil hatte in Johannes de Ragusio einen emsigen Hüter griechischer Texte, in Eneo Silvio Piccolomini einen begeisterten Vertreter humanistischer Bildung in unsere Mauern geführt. Freilich werden die von jenem dem Predigerkloster hinterlassenen griechischen Handschriften kaum Leser gefunden haben, wie denn auch Eneo Silvio damals nicht dazu gelangt ist, bei uns Jünger zu werben. Und noch weniger hat der Sizilianer Johannes Aurispa, der seinen Besuch beim Konzil zur Aufspürung antiker Handschriften
 in der Rheinlandschaft benützte, positive Spuren seines
Aufenthaltes hinterlassen.
in der Rheinlandschaft benützte, positive Spuren seines
Aufenthaltes hinterlassen.
Bald aber kam die Universität, zunächst freilich als eine noch ganz von mittelalterlichem Geiste erfüllte Anstalt. Wie alle andern deutschen Universitäten 17) wehrte sich auch die unsrige hartnäckig gegen das Neue, das sich von Italien her ankündigte. Wenn 18) noch 1492 die Artistenfakultät in ihre Statuten die Bestimmung setzte: nullus in disputatione bursali lectiones poeticas sumat, ut eo minus scolares ab actibus necessarioribus distrabantur; und wenn 1495 dieselbe Fakultät beschloss, dass die disputationes und contiones sich auf logica und grammatica beziehen sollten "juxta statuta" und nicht auf poesis, so waren diese Massregeln gegen den Humanismus gerichtet. Als Pflege der poesis hatte sich ja das Studium der Alten eingeführt und Leute wie Aeneas Silvius sich in ihren Schriften mit Vorliebe poetae genannt.
Aber schon mehrere Jahre vor jenen die poesis scharf abwehrenden Beschlüssen war der oder jener orator und poeta nicht bloss immatrikuliert, sondern auch als Lehrer zugelassen worden, 19) darunter der talentvolle Peter Luder, der zuerst 1456 in Heidelberg, nachher in Erfurt und dann in Leipzig als Apostel des Humanismus aufgetreten war. 20) Er machte sich anheischig das Küchenlatein auszurotten, die Studierenden in Horaz und Ovid, Seneca und Valerius Maximus einzuführen. Aber vermöge seiner Frechheit und seiner dissoluten Sitten machte er sich überall, wohin er nur kam, nach kurzer Zeit unmöglich. In Basel erhielt er 1464 Besoldung. Wie in Heidelberg und anderswo die Fürsten sich der humanistischen Lehrer gegen die akademischen Machthaber annahmen, so hier in gewissem Grade der Rath. Freilich litt es Luder, wie es scheint, auch in Basel nicht lange. Von 1474 an finden wir sodann für poesis einen eigenen Lehrstuhl eingerichtet. 21) Sebastian Brant war einer von dessen Inhabern. 22) Er fand mit seiner die beiden letzten Jahrzehnte des XV. Jahrhunderts füllenden hiesigen Lehrthätigkeit grossen Beifall bei den Studierenden.
Das Jahr 1474 macht noch in einer zweiten Beziehung in
 der Geschichte von Basels Philologie Epoche. In diesem Jahr
kam Johann Reuchlin nach Basel. Er traf hier Andronikos
Kontoblakas, einen Flüchtling aus Ostrom, der, ohne eine
öffentliche Lehrstelle einzunehmen, griechischen Sprachunterricht
erteilte. Reuchlin, der sich schon in Paris notdürftige
Kenntnisse in diesem Fach erworben hatte, wurde sein dankbarer
Schüler. 23) Durch ihn geniesst Basel den Ruhm, dass in
seinen Mauern zum ersten Mal wieder seit der Zeit der Ottonen
ein Deutscher auf deutschem Boden griechisch lernte. Denn
die wenigen Deutschen der vorausgehenden vier Jahrhunderte,
welche Griechisch konnten, wie Wilhelm von Moerbeka und
Johannes Wessel, hatten sich diese Kenntnis im Ausland holen
müssen.
der Geschichte von Basels Philologie Epoche. In diesem Jahr
kam Johann Reuchlin nach Basel. Er traf hier Andronikos
Kontoblakas, einen Flüchtling aus Ostrom, der, ohne eine
öffentliche Lehrstelle einzunehmen, griechischen Sprachunterricht
erteilte. Reuchlin, der sich schon in Paris notdürftige
Kenntnisse in diesem Fach erworben hatte, wurde sein dankbarer
Schüler. 23) Durch ihn geniesst Basel den Ruhm, dass in
seinen Mauern zum ersten Mal wieder seit der Zeit der Ottonen
ein Deutscher auf deutschem Boden griechisch lernte. Denn
die wenigen Deutschen der vorausgehenden vier Jahrhunderte,
welche Griechisch konnten, wie Wilhelm von Moerbeka und
Johannes Wessel, hatten sich diese Kenntnis im Ausland holen
müssen.
Der junge Reuchlin war bei seinem damaligen Aufenthalt in Basel auch schon als philologischer Schriftsteller tätig. Im Auftrag der Druckerherren Amerbach publizierte er den Vocabularius breviloquus, ein Werk, das es binnen dreissig Jahren auf ebenso viel Auflagen brachte. Wol fusste Reuchlin in diesem Werk auf den Lexica des Mittelalters, aber die zahlreichen Belege aus den lateinischen Dichtern und die bessere Latinität zeigen den werdenden Humanisten.
Mit dem XVI. Jahrhundert hielt der Humanismus voll und ganz seinen Einzug in Basel. Als akademischer Vertreter desselben ist neben Wyttenbach, dem Lehrer Zwinglis und Leo Juds, vor allem der begabte Heinrich Loriti aus Mollis, besser bekannt unter dem Namen Glareanus, zu erwähnen, der im Jahr 1514 im vollen Stolz eines von Kaiser Max gekrönten poeta laureatus hier erschien. 24) Er kam von Köln, von dort durch den Schimpf weggetrieben, den man dem von ihm hoch verehrten Reuchlin angethan. In Basel schloss er sich mit geradezu schwärmerischer Verehrung an Erasmus an, nach dessen Umgang er sich längst gesehnt hatte und der ihn seinerseits als den princeps der schweizerischen Humanisten begrüsste. Später wollte freilich dem feinen Rotterdamer die stürmische Heftigkeit und der derbe Witz des Schweizers nicht immer behagen, so anhänglich ihm der letztere bis an sein Lebensende
 blieb. Als Magister angenommen, sammelte Glarean Studierende
in einer Bursa und las mit ihnen Livius, Seneca und
Gellius. Aber mit den leitenden Personen der Hochschule stand
er auf schlechtem Fusse; er glaubte sich von ihnen nicht genügend
anerkannt und liess sie auch gehörig seinen Unwillen
fühlen, kam sogar einmal, weil ihm in der Aula kein eigener
Platz angewiesen worden, hoch zu Ross in dieselbe geritten,
damit er doch sitzen könne. So war es ihm lieb, zuerst nach
Pavia, dann nach Paris ziehen zu können. Aber 1522 kam er
doch wieder zurück und wurde 1524 als vollgültiges Glied in
die Artistenfakultät aufgenommen. Die Reformation machte
dann seiner hiesigen Wirksamkeit ein Ende.
blieb. Als Magister angenommen, sammelte Glarean Studierende
in einer Bursa und las mit ihnen Livius, Seneca und
Gellius. Aber mit den leitenden Personen der Hochschule stand
er auf schlechtem Fusse; er glaubte sich von ihnen nicht genügend
anerkannt und liess sie auch gehörig seinen Unwillen
fühlen, kam sogar einmal, weil ihm in der Aula kein eigener
Platz angewiesen worden, hoch zu Ross in dieselbe geritten,
damit er doch sitzen könne. So war es ihm lieb, zuerst nach
Pavia, dann nach Paris ziehen zu können. Aber 1522 kam er
doch wieder zurück und wurde 1524 als vollgültiges Glied in
die Artistenfakultät aufgenommen. Die Reformation machte
dann seiner hiesigen Wirksamkeit ein Ende.
Aber inzwischen war —und dadurch wird ja erst Glareans hiesiger Aufenthalt recht verständlich — ganz unabhängig von der Universität das humanistische Studium in unsern Mauern zu gewaltiger Bedeutung gelangt. Die Namen Herwagen, Froben, Cratander auf der einen, Erasmus, Beatus Rhenanus, Gelenius, Amerbach auf der andern Seite sagen jedem Basler und sagen jedem Kenner der Geschichte der Wissenschaften genug, als dass ich nötig hätte Ihnen eine ausführliche Schilderung des damaligen bewegten Treibens vorzutragen.
In gewisser Beziehung muss man sich hüten die Bedeutung des baslerischen Humanismus zu überschätzen. Man merkt es ihm an, dass die Buchdruckerpressen ihm recht eigentlich zum Dasein verholfen hatten. Wir wollen es uns offen gestehen, dass die grossartigsten unter den deutschen Humanistengestalten nicht dem Basler Kreis angehören. Keiner der Unsrigen reicht an die kraftvolle Würde eines Wilibald Pirckheimer heran. Überhaupt tritt die Bedeutung des Humanismus als einer neuen Welt- und Lebensanschauung verhältnismässig zurück, nicht zwar im Haupt des ganzen Kreises Erasmus, der indess ja nur mit grosser Einschränkung der Unsrige heissen darf, aber bei der Mehrzahl seiner Mitarbeiter.
Um so Bedeutenderes hat Basel für die rein gelehrten Zwecke des Humanismus geleistet. Beinahe darf es als die Geburtsstätte
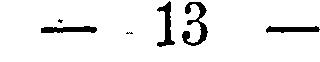 der klassischen Philologie Deutschlands bezeichnet
werden. Was bis um die Mitte des XVI. Jahrhunderts im übrigen
Deutschland für streng-wissenschaftliche Erforschung des
Altertums geleistet wurde, kommt neben den baslerischen Arbeiten
nicht in Betracht. Es bestehen diese zum grössten Teil
in Editionen der Klassiker. Nicht nur wurden die vielen schon
aus den italienischen Ausgaben bekannten antiken Texte nun
dem studierenden Publikum viel zugänglicher gemacht: eine
Menge ganz neuer Stücke gieng aus den Basler Pressen hervor.
Neben mehreren fachwissenschaftlichen Werken der spätern
griechischen und lateinischen Litteratur, die von Erasmus,
Grynäus, Gelenius, Justus Vultejus u. aa. ans Licht gezogen
wurden, ist vor allem die 1531 publizierte editio princeps der
sämtlichen bis auf unsre Zeit erhaltenen Bücher des Livius zu
nennen, in welcher Grynäus zuerst die von ihm entdeckte erste
Hälfte der fünften Dekade mitgeteilt hat, die durch die Berichterstattung
über den Krieg der Römer mit Perseus so wertvoll
ist. Dazu kommen der 1515 von Beatus Rhenanus in Murbach
entdeckte, 1520 in Basel herausgegebene Historiker Velleius
Paterculus, und der 1544 durch Arlenius unter Mithilfe
von Gelenius veröffentlichte Josephus, dessen Werke man bisher
sämtlich erst in lateinischem Gewande gekannt hatte. Für
andere Autoren wurden wertvolle alte Textquellen neu zugezogen,
zum Teil solche, die seitdem wieder verloren gegangen
sind, wodurch die betreffenden Basler Ausgaben in die Rangstellung
von Handschriften hinaufrücken. So hat Beatus Rhenanus,
der sich überhaupt durch sein Verständnis für Überlieferung
auszeichnet, für Livius den verschollenen Spirensis,
Gelenius für Ammian eine verschollene Hersfelder Handschrift
verwertet. Für Ciceros Briefe an Atticus ist die Cratandrea
eine Textquelle von bleibender Bedeutung.
der klassischen Philologie Deutschlands bezeichnet
werden. Was bis um die Mitte des XVI. Jahrhunderts im übrigen
Deutschland für streng-wissenschaftliche Erforschung des
Altertums geleistet wurde, kommt neben den baslerischen Arbeiten
nicht in Betracht. Es bestehen diese zum grössten Teil
in Editionen der Klassiker. Nicht nur wurden die vielen schon
aus den italienischen Ausgaben bekannten antiken Texte nun
dem studierenden Publikum viel zugänglicher gemacht: eine
Menge ganz neuer Stücke gieng aus den Basler Pressen hervor.
Neben mehreren fachwissenschaftlichen Werken der spätern
griechischen und lateinischen Litteratur, die von Erasmus,
Grynäus, Gelenius, Justus Vultejus u. aa. ans Licht gezogen
wurden, ist vor allem die 1531 publizierte editio princeps der
sämtlichen bis auf unsre Zeit erhaltenen Bücher des Livius zu
nennen, in welcher Grynäus zuerst die von ihm entdeckte erste
Hälfte der fünften Dekade mitgeteilt hat, die durch die Berichterstattung
über den Krieg der Römer mit Perseus so wertvoll
ist. Dazu kommen der 1515 von Beatus Rhenanus in Murbach
entdeckte, 1520 in Basel herausgegebene Historiker Velleius
Paterculus, und der 1544 durch Arlenius unter Mithilfe
von Gelenius veröffentlichte Josephus, dessen Werke man bisher
sämtlich erst in lateinischem Gewande gekannt hatte. Für
andere Autoren wurden wertvolle alte Textquellen neu zugezogen,
zum Teil solche, die seitdem wieder verloren gegangen
sind, wodurch die betreffenden Basler Ausgaben in die Rangstellung
von Handschriften hinaufrücken. So hat Beatus Rhenanus,
der sich überhaupt durch sein Verständnis für Überlieferung
auszeichnet, für Livius den verschollenen Spirensis,
Gelenius für Ammian eine verschollene Hersfelder Handschrift
verwertet. Für Ciceros Briefe an Atticus ist die Cratandrea
eine Textquelle von bleibender Bedeutung.
Die Handschriften, aus denen so die Basler Philologen neue Texte oder bessere Texte gewannen, hatten sie mit der den Gelehrten jener Zeit eignen Spürkraft meist im Elsass oder in der Pfalz aufgestöbert. Aber mehr noch als hiefür verdienen sie für die Art und Weise Lob, in der sie zugleich die Überlieferung
 beurteilt und verbessert haben. Voran steht billig
Erasmus' kühnes Wagnis: die. Ausgabe des Neuen Testaments.
Aber auch alle anderen bisher genannten haben in Reinigung
der Texte ein gewaltiges Stück Arbeit vollbracht, eine
bleibende Dankesschuld den Nachgebornen auferlegt. Grosse
Leistungen höherer Kritik darf man von ihnen kaum erwarten:
doch war es z.. B. Erasmus' Basler Ausgabe des Hieronymus,
die zuerst eine Scheidung der echten und unechten Schriften
brachte.
beurteilt und verbessert haben. Voran steht billig
Erasmus' kühnes Wagnis: die. Ausgabe des Neuen Testaments.
Aber auch alle anderen bisher genannten haben in Reinigung
der Texte ein gewaltiges Stück Arbeit vollbracht, eine
bleibende Dankesschuld den Nachgebornen auferlegt. Grosse
Leistungen höherer Kritik darf man von ihnen kaum erwarten:
doch war es z.. B. Erasmus' Basler Ausgabe des Hieronymus,
die zuerst eine Scheidung der echten und unechten Schriften
brachte.
Für andere stand das sachliche Verständnis der alten Autoren im Vordergrund. So zumal für denjenigen in diesem Kreis, der uns hier als geborner Schweizer am nächsten angeht, für den schon früher in seiner akademischen Wirksamkeit erwähnten tüchtigen Glarean. Zeugnis dafür, vor allem seine Arbeiten zu Livius, an denen alle spätem Erklärer des grossen Geschichtschreibers gezehrt haben. Mit emsigem Fleiss hat er dessen Geschichtsüberlieferung chronologisch zu ordnen unternommen und hat dabei unbeschadet mancher Übereilungen vielfach so richtiges Urteil bewährt, dass ihn der grosse Niebuhr als einen der wenigen freigebornen Geister bezeichnet, welche in Rücksicht, auf römische Geschichte über das tote Wiederholen der Überlieferung hinauskamen. 25) Auch sonst hat Glarean sowol in commentierten Ausgaben als in systematischen Werken sein besonderes Interesse und Verständnis für Örtlichkeiten und Zustände des Altertums kund gethan.
Ich muss es mir versagen die Berichterstattung über diese schaffensfreudige Zeit weiter auszudehnen. Ihre Höhe fällt in das halbe Menschenalter bis zum endgültigen Sieg der Reformation: da blühte ein wundersames geistvoller Männer. 1527 verliess uns Rhenanus nach sechzehnjährigem Aufenthalt, 1529 mit Glarean und für ihn massgebend Erasmus. Mochte damit das humanistische Leben selbst ärmer werden, den Basler Pressen merkt man nichts an. Im Gegenteil nimmt ihre philologische Production eher noch zu. Auch die Weggegangnen fuhren fort sich ihrer zu bedienen. Und auch andre schickten ihre Arbeiten von auswärts zum Druck nach
 Basel, darunter Joachim Camerarius und Hieronymus Wolff,
beides, besonders der erstere, Philologen von hervorragender
Bedeutung; sie thaten dies, obwol sie Basel höchstens als
Gäste kennen gelernt und jener Leipzig, dieser Augsburg zum
schliesslichen und bleibenden Wohnsitz hatte, Noch 1589 erschien
hier bei uns des Würtembergers Frischlin Ausgabe des
Callimachus, und 1590 des in Heidelberg lehrenden Franzosen
Gothofredus grosse Ausgabe des Seneca. Ausserdem ist der
treffliche Gelenius aus Prag, der 1524 nach Basel gekommen
war, bis zu seinem 1554 erfolgten Tode unserer Stadt und der
Froben'schen Druckerei, der er als Corrector diente, treu geblieben.
Basel, darunter Joachim Camerarius und Hieronymus Wolff,
beides, besonders der erstere, Philologen von hervorragender
Bedeutung; sie thaten dies, obwol sie Basel höchstens als
Gäste kennen gelernt und jener Leipzig, dieser Augsburg zum
schliesslichen und bleibenden Wohnsitz hatte, Noch 1589 erschien
hier bei uns des Würtembergers Frischlin Ausgabe des
Callimachus, und 1590 des in Heidelberg lehrenden Franzosen
Gothofredus grosse Ausgabe des Seneca. Ausserdem ist der
treffliche Gelenius aus Prag, der 1524 nach Basel gekommen
war, bis zu seinem 1554 erfolgten Tode unserer Stadt und der
Froben'schen Druckerei, der er als Corrector diente, treu geblieben.
III.
Bevor wir die weiteren Geschicke der Buchphilologie und des philologischen Unterrichts einer Besprechung unterziehen, müssen wir noch einer besondern Richtung humanistischen Studiums in der Schweiz gedenken: der Beschäftigung mit den baulichen, bildlichen und schriftlichen Resten römischer Zeit.
Der Humanismus hatte von Anfang an seine Augen auch nach dieser Seite offen. Petrarca erzählt uns, wie er oft oben auf den Gewölben der diocletianischen. Thermen, den Blick auf die Trümmer rings um ihn gerichtet; sich in Gesprächen über Roms alte Zeit ergangen habe. 26) Cola Rienzi, der Tribun, that noch mehr. 27) Er verfasste eine "Beschreibung der Stadt Rom und ihrer Herrlichkeiten" und teilte darin eine Reihe von Inschriften mit, wie es scheint ohne Vorbild und Anregung; er wurde so der Begründer der modernen Epigraphik. Im XV. Jahrhundert haben dann Denkmäler und Inschriften dem Poggio und vielen, die ihm folgten, Anstoss zu immer emsigerem Forschen, zu gross angelegten Werken gegeben.
Die deutschen Humanisten folgten dem Beispiel der Italiener. In der eigenen Heimat Spuren von Roms Herrlichkeit nachgehen zu dürfen, war ihnen köstlicher Genuss. Wilibald Pirckheimer wurde durch einen Aufenthalt in Trier, allerdings
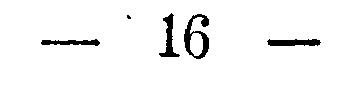 dem klassischsten Punkte Deutschlands für solche Forschung,
zu einer Schrift über dessen Denkmäler und Geschichte angeregt,
und hielt die Copie, die er von einer Inschrift aus der
Nähe Triers nahm, für wert an Kaiser Max abgeschickt zu
werden. Peutinger, eifriger Sammler wie von Büchern, so von
Bildwerken und Münzen, publizierte 1505 die Inschriften seiner
Vaterstadt Augsburg und der zugehörigen Diözese, Johann
Huttich aus gleichem patriotischen Antrieb 1520 ein Werk
über die römischen Denkmäler der Stadt Mainz und ihrer Umgebung.
dem klassischsten Punkte Deutschlands für solche Forschung,
zu einer Schrift über dessen Denkmäler und Geschichte angeregt,
und hielt die Copie, die er von einer Inschrift aus der
Nähe Triers nahm, für wert an Kaiser Max abgeschickt zu
werden. Peutinger, eifriger Sammler wie von Büchern, so von
Bildwerken und Münzen, publizierte 1505 die Inschriften seiner
Vaterstadt Augsburg und der zugehörigen Diözese, Johann
Huttich aus gleichem patriotischen Antrieb 1520 ein Werk
über die römischen Denkmäler der Stadt Mainz und ihrer Umgebung.
Es wäre seltsam, wenn die Schweizer Humanisten in diesem Stücke hätten zurückbleiben wollen. Einzelnes, das besonders in die Augen fiel, war schon in früherer Zeit beachtet worden. So giebt es von der bekannten Inschrift an der Pierre Pertuis bereits eine mittelalterliche Aufzeichnung. Jetzt nach Pirckheimers und Peutingers Vorgang wurde dieses Studium ernstlicher in Angriff genommen. Glarean, voll von dem echten Humanistenpatriotismus und aller antiquarischen Forschung zugeneigt, benützte, wie es scheint, das erste Jahr nach seiner Rückkehr ins Vaterland, um in Geleit des mit Zwingli befreundeten Freiburger Staatsmannes P. Falk die Ruinen von Aventicum aufzusuchen. 28) Bei Stumpf sind uns die dichterischen Worte bewahrt, in denen er den Eindruck, den die Trümmerstätte auf ihn machte, wiedergab. Daneben unterliess er es nicht, zugleich von neun dortigen Inschriften eine Copie zu nehmen und diese befreundeten Liebhabern des Altertums, wie z. B. Bonifacius Amerbach, mitzuteilen. 29) Seinem Beispiel folgte Beatus Rhenanus. Wie er selbst in einem Briefe erzählt, benutzte er 1522 eine vergnügliche Reise, die er in Erasmus' Gesellschaft nach Konstanz unternahm, mit dazu, um sich dort eine schon zur Zeit des Konzils von einem Italiener beachtete grössere Inschrift anzusehen, welche über das römische Winterthur lehrreiche Auskunft giebt. 30) Er war dann weiterhin der erste, der über lateinische Inschriften unseres Landes öffentlich Bericht gab. Er that dies 1531 in senem grossen Geschichtswerke "Rerum Germanicarum libri tres", 31) und ihm
 verdankten vielleicht auch die Ingolstadter Professoren Apianus
und Amantius die fünf schweizerischen Inschriften, die ihre
1534 unter Fuggers Patronat erschienenen ,,Inscriptiones sacrosanctae
vetustatis" aufweisen.
verdankten vielleicht auch die Ingolstadter Professoren Apianus
und Amantius die fünf schweizerischen Inschriften, die ihre
1534 unter Fuggers Patronat erschienenen ,,Inscriptiones sacrosanctae
vetustatis" aufweisen.
Die ein halbes Menschenalter später (1547) publizierte Schweizer Chronik Johannes Stumpfs zeigt in der Kenntnis des römischen Helvetiens und in der Zahl der mitgeteilten Inschriften einen ausserordentlichen Fortschritt über das bisher Bekannte hinaus; Mit glänzendem Scharfsinn hat Vögelin 32) erwiesen, dass das Hauptverdienst hieran nicht, wie Mommsen angenommen hatte, Stumpf gebührt, obwol er seine 1544 unternommene Reise durch die Schweiz auch zu einigen epigraphischen Forschungen benützt hat, sondern dem bekannten Aegidius Tschudy. Dieser hatte den römischen Altertümern früh sein Interesse zuzuwenden begonnen, nach seiner Angabe schon 1520. da er als fünfzehnjähriger Knabe in Konstanz die vor erwähnte merkwürdige Inschrift will abgeschrieben haben. 33) Sicher war er um diese Dinge eifrig bemüht in den Jahren seiner ersten Vogtei in Baden (1533-1535). Als im Mai 1534 in der Nähe der Stadt ein Meilenstein aus Trajans Regierungszeit zum Vorschein gekommen war, liess er denselben nicht bloss ins Schloss bringen; er wies ihn den um diese Zeit in Baden versammelten eidgenössischen Tagherrn vor und verstand es ihnen die Aufschrift des Steins gelehrt zu deuten. 34) Man kannte ihn als Altertumsliebhaber und beschenkte ihn etwa mit einem Fundstück. 35) Mit besonderem Eifer verlegte er sich damals und bis an sein Lebensende auf die Inschriften. Viele Dutzende solcher copierte er auf seinen mehrfachen Reisen durch die Schweiz. Andere kamen ihm durch seine Freunde zu. Und diese Denkmäler behandelte er nun mit einer bewundernswerten Einsicht und Sachkenntnis. Man sieht es den betreffenden Arbeiten an, wie belesen er in den alten Autoren und wie vertraut er mit dem gesamten römischen Inschriftenwesen war. Selbst in den Feinheiten byzantinischer Chronologie war er völlig zu Hause. 36) - -
- Überhaupt war bei Tschudy, dem Schüler und vertrauten
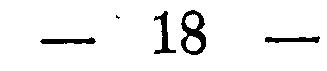 Freunde Glareans, der Humanist viel stärker vertreten, als
man aus seinen wesentlich nur der schweizerischen Vergangenheit
geltenden gedruckten Werken zu schliessen geneigt wäre.
Sein Interesse für das römische Altertum beschränkte sich
nicht auf den Anteil, den die Schweiz an demselben hat. Als er
im Frühling 1536 an der Spitze einer vom französischen Könige
gedungenen Söldnerschar Südfrankreich durchzog, fand er mitten
in den Strapazen und dem kriegerischen Leben Zeit, in
mehrern Städten die alten Inschriften zu copieren und wurde
so z. B. der erste, der in Lyon den merkwürdigen Resten der
Rede des Kaisers Claudius Aufmerksamkeit zuwandte. Später,
da er nochmals in diesen Gegenden ankehrte, setzte er diese
Forschungen gleich wieder fort. Und als er, vielleicht 1546, in
Geleit Josts von Meggen nach Rom reiste, lag er unterwegs
und besonders in der Weltstadt selbst emsig seinem Forscherberufe
ob. Am wenigsten fesselten ihn die eigentlichen Kunstdenkmäler. 37)
Freunde Glareans, der Humanist viel stärker vertreten, als
man aus seinen wesentlich nur der schweizerischen Vergangenheit
geltenden gedruckten Werken zu schliessen geneigt wäre.
Sein Interesse für das römische Altertum beschränkte sich
nicht auf den Anteil, den die Schweiz an demselben hat. Als er
im Frühling 1536 an der Spitze einer vom französischen Könige
gedungenen Söldnerschar Südfrankreich durchzog, fand er mitten
in den Strapazen und dem kriegerischen Leben Zeit, in
mehrern Städten die alten Inschriften zu copieren und wurde
so z. B. der erste, der in Lyon den merkwürdigen Resten der
Rede des Kaisers Claudius Aufmerksamkeit zuwandte. Später,
da er nochmals in diesen Gegenden ankehrte, setzte er diese
Forschungen gleich wieder fort. Und als er, vielleicht 1546, in
Geleit Josts von Meggen nach Rom reiste, lag er unterwegs
und besonders in der Weltstadt selbst emsig seinem Forscherberufe
ob. Am wenigsten fesselten ihn die eigentlichen Kunstdenkmäler. 37)
Tschudy ist der hervorragendste Vertreter derjenigen Art von Altertumsforschung, die in der Verbindung humanistischer Bildung und philologischer Kenntnisse einerseits mit patriotischer Begeisterung für alles Heimatliche andrerseits ihre Wurzel hat. Er hatte darin manchen Genossen und Nachfolger. Man kann überhaupt sagen, dass damals alle Bemühungen die Zusammenhänge der Schweiz mit dem Altertum aufzudecken lebhafte Teilnahme fanden.
Auch Basel ist nicht zurückgeblieben. Es fehlte hier nie an gelehrten Männern, die den Denkmälern der römischen Vergangenheit ihre Aufmerksamkeit zuwandten. Von Bonifacius Amerbach besitzt unsere Bibliothek einen stattlichen epigraphischen Sammelband, 38) in den er von seiner Freiburger Studienzeit an teils grössere Inschriftensammlungen, wie die ungefähr achthundert Nummern zählende des Elsässers Thomas Wolf, 39) teils einzelne von ihm selbst gefundene oder ihm von Freunden mitgeteilte Inschriften eintrug. Basilius Amerbach war auch hierin seines Vaters würdiger Nachfolger; seinen Zeichnungen und Beschreibungen - verdanken die gleich zu
 erwähnenden Augster Ausgrabungen ihre bleibende Bedeutung.
Und besonders ehrenvolle Erwähnung verdient Christian
Wurstisen, der Verfasser der 1580 erschienenen Basler Chronik:
Entsprechend seiner überraschend guten Einsicht in den
Wert der monumentalen Geschichtsquellen hat er neben den
Denkmälern der mittelalterlichen Zeit auch die des Altertums
fleissig ausgenutzt und die Ruinen von Augusta wie die Inschriften
von Aventicum durchforscht. 40)
erwähnenden Augster Ausgrabungen ihre bleibende Bedeutung.
Und besonders ehrenvolle Erwähnung verdient Christian
Wurstisen, der Verfasser der 1580 erschienenen Basler Chronik:
Entsprechend seiner überraschend guten Einsicht in den
Wert der monumentalen Geschichtsquellen hat er neben den
Denkmälern der mittelalterlichen Zeit auch die des Altertums
fleissig ausgenutzt und die Ruinen von Augusta wie die Inschriften
von Aventicum durchforscht. 40)
Allein das Interesse für die römische Vergangenheit unseres Landes beschränkte sich in Basel nicht auf die eigentlich gelehrten Kreise. Schon zur Zeit von Rhenanus' hiesigem Aufenthalt war man bei uns mit dem Inhalt jener Inschrift von Gaeta bekannt geworden, in welcher der mit Cicero und Horaz befreundete Munatius Plancus als Gründer von "Raurica", also eben von Augst, bezeichnet war. Es kennzeichnet die Stimmung der Zeit, dass man Plancus nun zum baslerischen Stadtheros erhob, ein Bild von ihm an das Haus zum Pfauen gegenüber dem Rathaus anmalen liess und Beatus Rhenanus beauftragte, dazu eine lateinische Inschrift zu fertigen. 41). In den 1570er Jahren entstand dann das noch heute im Rathaushofe stolz sich erhebende Standbild; einige Leute vom Rat, offenbar nicht eigentliche Gelehrte, hatten einen von Strassburg zugewanderten Künstler, der sich nach einem Gegenstand umsah, auf den. Gedanken gebracht eine solche Statue zu fertigen. 42) Und wiederum waren es eine Anzahl wissbegieriger Bürger, die von 1582 an etwa sieben Jahre lang unter Andreas Ryffs Leitung in Augst graben liessen. 43)
IV.
Sind solche Unternehmungen ein erfreuliches Zeichen dafür, wie weit über die eigentlich gelehrten Kreise hinaus die antiken Traditionen lebendig und wertgeschätzt waren, so bieten sich auf der. andern Seite bald weniger ansprechende Bilder. Zwar muss es mit Nachdruck gesagt werden, dass unsere reformatorische Bewegung, wiewohl sie dem Basler Humanismus
 eine schwere Wunde schlug, ihrerseits doch eine Freundin
der humanistischen Studien war. Die Schweizer Reformatoren
reihen sich in dieser Beziehung würdig an Melanchthon an.
Voran Zwingli, der die gründliche Kenntnis der alten Sprachen,
die er teils auf der Schule in Bern und auf den Universitäten
Basel und Wien, teils durch fleissiges Privatstudium als Pfarrer
in Glarus erworben hatte, nun in langjähriger an das geistliche
Amt sich anschliessender Lehrthätigkeit verwertete. Besonders
förderte er das Studium des Griechischen. In Zürich
sammelte sein Unterricht in dieser Sprache sogar ältere Männer
um ihn, und auswärts schrieb man sich die Erklärungen
zu Homer ab, die er in Zürich vorgetragen hatte. 44) Auch
schriftstellerisch wies er sich über seine philologischen Kenntnisse
aus, durch seine Mitarbeit an einer Ausgabe des Pindar,
und daneben fand er Freude daran, die Aufführung jenes aristophaneischen
Lustspiels, das dem Gott des Reichtums gilt, zu
unterstützen. Und dieselbe Gesinnung lebte in dem ganzen reformatorischen
Kreise Zürichs. An Konrad Gesner, dem auch
die Philologie manches verdankt, und an den gelehrten Josias
Simler, den Freund Pithou's, sei nur kurz erinnert. Unser
Basler Reformator Oekolampad sodann schrieb eine der ältesten
griechischen Grammatiken. Und gegen den Schluss des Jahrhunderts
war Genf gerade vermöge seiner Eigenschaft als Hauptstadt
des welschen Protestantismus der Aufenthaltsort mehrerer
der grössten Philologen aller Zeiten, des Henricus Stephanus,
des Joseph Scaliger, des Isaac Casaubonus.
eine schwere Wunde schlug, ihrerseits doch eine Freundin
der humanistischen Studien war. Die Schweizer Reformatoren
reihen sich in dieser Beziehung würdig an Melanchthon an.
Voran Zwingli, der die gründliche Kenntnis der alten Sprachen,
die er teils auf der Schule in Bern und auf den Universitäten
Basel und Wien, teils durch fleissiges Privatstudium als Pfarrer
in Glarus erworben hatte, nun in langjähriger an das geistliche
Amt sich anschliessender Lehrthätigkeit verwertete. Besonders
förderte er das Studium des Griechischen. In Zürich
sammelte sein Unterricht in dieser Sprache sogar ältere Männer
um ihn, und auswärts schrieb man sich die Erklärungen
zu Homer ab, die er in Zürich vorgetragen hatte. 44) Auch
schriftstellerisch wies er sich über seine philologischen Kenntnisse
aus, durch seine Mitarbeit an einer Ausgabe des Pindar,
und daneben fand er Freude daran, die Aufführung jenes aristophaneischen
Lustspiels, das dem Gott des Reichtums gilt, zu
unterstützen. Und dieselbe Gesinnung lebte in dem ganzen reformatorischen
Kreise Zürichs. An Konrad Gesner, dem auch
die Philologie manches verdankt, und an den gelehrten Josias
Simler, den Freund Pithou's, sei nur kurz erinnert. Unser
Basler Reformator Oekolampad sodann schrieb eine der ältesten
griechischen Grammatiken. Und gegen den Schluss des Jahrhunderts
war Genf gerade vermöge seiner Eigenschaft als Hauptstadt
des welschen Protestantismus der Aufenthaltsort mehrerer
der grössten Philologen aller Zeiten, des Henricus Stephanus,
des Joseph Scaliger, des Isaac Casaubonus.
Das enge Band zwischen Reformation und Humanismus kam auch den öffentlichen Schuleinrichtungen zu gute. Wol waren die damals teils neu eingerichteten, teils umgestalteten obersten Schulen, das an das Zürcher Chorherrenstift angelehnte Carolinum, die Akademien von Bern, Lausanne, Genf, wesentlich dazu bestimmt zum geistlichen Amte vorzubereiten. Es ist aber höchlich anzuerkennen, dass keine dieser Anstalten das Studium der Alten vernachlässigt hat. Das Zürcher Carolinum verdient in dieser Beziehung besonders ehrende Erwähnung. 45)

In Basel wurde der durch die Einführung der Reformation
bewirkte Wegzug der bedeutendsten Humanisten dadurch
einigermassen wettgemacht, dass bei der von Oekolampad ausgehenden
Neugestaltung der Universität im Jahre 1532 die
klassische Philologie nunmehr förmliche Berücksichtigung fand.
In dem Einladungsschreiben des Rektors Oswald Bär hiess es:
linguas Sebastianus Munsterus, Simon Grynaeus, Albanus
Torinus docent, nämlich der Kosmograph Münster als Professor
des Hebräischen, Simon Grynaeus, den Oekolampad schon
1529 aus Heidelberg herbeigerufen hatte, als Professor des
Griechischen, endlich Alban zum Tor als solcher, des Latein. 46)
Der spezifisch protestantische Geist der Universitätsgründung
äussert sich nicht blos in der Creierung eines hebräischen, sondern
auch in der eines griechischen Lehrstuhls. Mit vollem Recht
hat man 47) darauf hingewiesen, dass das Studium des Griechischen
erst durch die Reformation recht in den Gang gekommen
ist. Mehrern der bedeutendsten Vertreter des vorreformatorischen
Humanismus in Deutschland, wie Wimpheling und Peutinger,
war das Griechische fremd. Ebenso berichtet Plater 48)
von seinem Gönner Myconius, dass er noch 1528 nicht wagte
Griechisch zu docieren; "denn die griekisch sprach was noch
seltzam, ward wenig brucht". Selbst Glarean hat es im Griechischen
nie weit gebracht und sich als philologischer Schriftsteller
so gut wie gänzlich auf lateinische Autoren beschränkt.
Basel wurde der durch die Einführung der Reformation
bewirkte Wegzug der bedeutendsten Humanisten dadurch
einigermassen wettgemacht, dass bei der von Oekolampad ausgehenden
Neugestaltung der Universität im Jahre 1532 die
klassische Philologie nunmehr förmliche Berücksichtigung fand.
In dem Einladungsschreiben des Rektors Oswald Bär hiess es:
linguas Sebastianus Munsterus, Simon Grynaeus, Albanus
Torinus docent, nämlich der Kosmograph Münster als Professor
des Hebräischen, Simon Grynaeus, den Oekolampad schon
1529 aus Heidelberg herbeigerufen hatte, als Professor des
Griechischen, endlich Alban zum Tor als solcher, des Latein. 46)
Der spezifisch protestantische Geist der Universitätsgründung
äussert sich nicht blos in der Creierung eines hebräischen, sondern
auch in der eines griechischen Lehrstuhls. Mit vollem Recht
hat man 47) darauf hingewiesen, dass das Studium des Griechischen
erst durch die Reformation recht in den Gang gekommen
ist. Mehrern der bedeutendsten Vertreter des vorreformatorischen
Humanismus in Deutschland, wie Wimpheling und Peutinger,
war das Griechische fremd. Ebenso berichtet Plater 48)
von seinem Gönner Myconius, dass er noch 1528 nicht wagte
Griechisch zu docieren; "denn die griekisch sprach was noch
seltzam, ward wenig brucht". Selbst Glarean hat es im Griechischen
nie weit gebracht und sich als philologischer Schriftsteller
so gut wie gänzlich auf lateinische Autoren beschränkt.
Ein so bedeutsamer Schritt die förmliche Aufnahme der Philologie in den Kreis der Universitätsfächer war, so darf doch nicht verschwiegen werden, dass dieselbe hier keine wesentlich höhere Stellung einnahm als an den vorerwähnten, nicht auf Universitätsrang stehenden schweizerischen Lehranstalten. Der Unterricht an der Artistenfakultät war überhaupt nunmehr wesentlich ein propädeutischer, der Kreis der gelesenen alten Autoren in Folge dessen ein sehr enger. 49) Die Tragiker und Lyriker, selbst Herodot, werden auf dem Pensum vermisst, und unter den Lateinern nicht blos die Komiker, sondern auch Horaz und Tacitus. So wenigstens im XVI. Jahrhundert. Es war eine Ausnahme, wenn im Jahr 1543 (?) Pantaleon
 auf Aufforderung des Dekans über Persius' Satiren las.
Das XVII. und XVIII. Jahrhundert hindurch ist es wesentlich
hiebei verblieben. Und dem Wie der Lektüre und den Zielen,.
die dabei verfolgt wurden, forscht man wol besser gar nicht
nach. 50) Da kann es nicht Wunder nehmen, dass es die Inhaber der
philologischen Lehrstühle zu keinen grossen wissenschaftlichen
Leistungen gebracht haben. In den ersten Jahrzehnten begegnen
wir darunter noch einigen tüchtigen Männern. Neben
Simon Grynäeus, der gleich zur Theologie übergieng, dürfen
Coelius Secundus Curio, Sebastian Castellio, sowie auch noch
Hieronymus Gemusaeus mit Anerkennung genannt werden.
Aber dann erlischt die gute Tradition. Es lohnte sich ja nicht
mehr, mit der Philologie recht Ernst zu machen. Für Lehrer
wie für Studierende war die Beschäftigung mit den Alten nur
Durchgangsstufe zu einem der Lehrfächer der drei obern Fakultäten.
Was half es, dass Johann Rudolf Wettstein, 51) der Enkel
des Bürgermeisters, als zwanzigjähriger Jüngling durch gewandte
Handhabung des Griechischen in mündlichem Ausdruck
einen Opponenten niederschmetterte: er hat doch, nachdem er
1684 Professor des Griechischen geworden war, nicht gezögert
sich das Jahr darauf im Schooss der theologischen Fakultät zu
bergen, hat auch zeitlebens nicht für irgend eine noch so kleine
ernsthafte philologische Aufgabe die Hand gerührt.
auf Aufforderung des Dekans über Persius' Satiren las.
Das XVII. und XVIII. Jahrhundert hindurch ist es wesentlich
hiebei verblieben. Und dem Wie der Lektüre und den Zielen,.
die dabei verfolgt wurden, forscht man wol besser gar nicht
nach. 50) Da kann es nicht Wunder nehmen, dass es die Inhaber der
philologischen Lehrstühle zu keinen grossen wissenschaftlichen
Leistungen gebracht haben. In den ersten Jahrzehnten begegnen
wir darunter noch einigen tüchtigen Männern. Neben
Simon Grynäeus, der gleich zur Theologie übergieng, dürfen
Coelius Secundus Curio, Sebastian Castellio, sowie auch noch
Hieronymus Gemusaeus mit Anerkennung genannt werden.
Aber dann erlischt die gute Tradition. Es lohnte sich ja nicht
mehr, mit der Philologie recht Ernst zu machen. Für Lehrer
wie für Studierende war die Beschäftigung mit den Alten nur
Durchgangsstufe zu einem der Lehrfächer der drei obern Fakultäten.
Was half es, dass Johann Rudolf Wettstein, 51) der Enkel
des Bürgermeisters, als zwanzigjähriger Jüngling durch gewandte
Handhabung des Griechischen in mündlichem Ausdruck
einen Opponenten niederschmetterte: er hat doch, nachdem er
1684 Professor des Griechischen geworden war, nicht gezögert
sich das Jahr darauf im Schooss der theologischen Fakultät zu
bergen, hat auch zeitlebens nicht für irgend eine noch so kleine
ernsthafte philologische Aufgabe die Hand gerührt.
Am ehesten darf vielleicht der 1667 geborene Samuel Battier genannt werden. 52) Zwar zu einer wahrhaft bedeutenden Leistung hat auch er es nicht gebracht. Aber nicht bloss im öffentlichen Leben hat er als Gehilfe Johannes Bernoullis bei seinen Bemühungen das Basler Schulwesen zu reformieren seinen Mann gestellt; 53) er ist auch ein Gelehrter von achtungswertem Fleiss gewesen. Er wandte den griechischen Manuscripten der öffentlichen Bibliothek und privater Bibliotheken seine Aufmerksamkeit zu: seine Abschriften von Psellus Paraphrase der Ilias, von Hermias Commentar zu Plato und von Origenes contra Celsum sind noch vorhanden. Auch in der Textkritik arbeitete er, besonders der des Euripides und des Diogenes . Laertius, und lieferte mehrern ausländischen Gelehrten,
 darunter dem berühmten Hemsterhuys, zu ihren Ausgaben
teils Conjecturen, teils Lesarten aus Basler Handschriften.
Ganz freiwillig war diese philologische Emsigkeit nicht: 1705
im Alter von 38 Jahren zur griechischen Professur berufen, bewarb
er sich dreimal um eine erledigte medizinische Professur.
Aber, wie die Athenae Rauricae 54) sich ausdrücken, "Deo visum
fuit, ut ad finem usque vitae graecae linguae docendae insudaret".
Und da er dies während seiner 39jährigen Amtsthätigkeit redlich
gethan, wollen wir ihm neben andern Mängeln auch die
sprachlichen und metrischen Schnitzer seiner Conjecturen zu
Gute halten.
darunter dem berühmten Hemsterhuys, zu ihren Ausgaben
teils Conjecturen, teils Lesarten aus Basler Handschriften.
Ganz freiwillig war diese philologische Emsigkeit nicht: 1705
im Alter von 38 Jahren zur griechischen Professur berufen, bewarb
er sich dreimal um eine erledigte medizinische Professur.
Aber, wie die Athenae Rauricae 54) sich ausdrücken, "Deo visum
fuit, ut ad finem usque vitae graecae linguae docendae insudaret".
Und da er dies während seiner 39jährigen Amtsthätigkeit redlich
gethan, wollen wir ihm neben andern Mängeln auch die
sprachlichen und metrischen Schnitzer seiner Conjecturen zu
Gute halten.
Jedenfalls stehn seine Vorgänger und nächsten Nachfolger tief unter ihm; sie nennen hiesse nur die traurigste Sterilität an den Pranger stellen. Die par Heftchen Observationen und die par Neuauflagen schlechter philologischer Handbücher, die von ihnen aufgeführt werden, können den Vorwurf natürlich nicht entkräften. Nicht besser sah es in der übrigen Schweiz aus. Die theologischen Interessen drückten überall das Studium nieder, wie z. B. in Lausanne der Professor des Griechischen gesetzlich gehalten war, Neues Testament und Kirchenväter zu lesen. Selbst Zürich 55) kann für die zwei Jahrhunderte nach der Reformation keinen namhaften Philologen und keine einzige wertvollere philologische Publication aufweisen. Und derjenige, dessen es sich um die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit einem gewissen Recht rühmte, der in ganz Europa gefeierte Epigraphiker Hagenbuch, hat, wie wir gleich sehen werden, nur auf sehr bedingtes Lob Anspruch.
Nichts ist vielleicht für die philologische Unfruchtbarkeit auch der Zürcher von damals bezeichnender, als dass selbst Breitinger, der bekannte Genosse Bodmers, obwol er Jahrzehnte lang Griechisch dozierte und Griechisch anerkanntermassen sein Lieblingsfach war, doch zeitlebens ausser seiner von theologischem Interesse eingegebnen und kaum als selbständige wissenschaftliche Leistung in Betracht fallenden Ausgabe der Septuaginta 56) für das Griechische nichts geleistet hat, als eine Rede über die Gründe der Vernachlässigung des Griechischen,
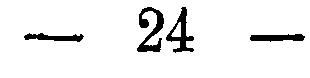 und daneben fürs Lateinische ein paar Bemerkungen zu
Ciceros erster Catilinaria und einen kleinen Aufsatz über
einige dunkle Verse des Persius: letzterer das einzige Ergebnis
der umfassenden Vorarbeiten für die grosse Quartausgabe
dieses Dichters, die er einst als Studierender. zusammen mit
Hagenbuch geplant hatte. -
und daneben fürs Lateinische ein paar Bemerkungen zu
Ciceros erster Catilinaria und einen kleinen Aufsatz über
einige dunkle Verse des Persius: letzterer das einzige Ergebnis
der umfassenden Vorarbeiten für die grosse Quartausgabe
dieses Dichters, die er einst als Studierender. zusammen mit
Hagenbuch geplant hatte. -
Und doch bestand damals von der Schweiz aus ein ziemlich reger Verkehr mit den Hauptstätten des Altertumsstudiums. Theologen wie auch akademisch gebildete Weltleute dehnten gern ihre Reisen nach den Niederlanden und nach England aus und suchten dort die grossen Philologen auf. Aber im Grunde leer kehrte man von den Reisen zurück, höchstens dass einer, wenn er so begütert war wie der Zürcher Junker Blarer von Wartensee, 57) ein paar Kisten schöner holländischer Editionen als Frucht des bei einem Graenvius oder einem Gronovius getriebenen Studiums mit nach Hause brachte. Das ist überhaupt fast das einzige, woraus wir auf ein gewisses Miterleben der Fortschritte der Philologie bei jenen Gelehrtengenerationen. schliessen können, das einzige auch, wofür wir ihnen Dank schuldig sind, dass sie wenigstens den gelehrten Arbeiten der Zeitgenossen in grosser Zahl Aufnahme in ihre öffentlichen und privaten Bibliotheken gewährt haben. Es genüge auf die reichen Schätze der 1629 von begeisterten Jünglingen gegründeten Zürcher Stadtbibliothek und auf die kostbaren philologischen Bestandteile der Bibliothek des von 1711 bis 1759 in Basel lehrenden Theologen Johann Ludwig Frey hinzuweisen. .
An dem Gefühl, dass nicht alles war, wie es sein sollte, fehlte es nicht. Dass das Griechische nicht seine gehörige Stellung im Unterricht habe, dass es mehr gepflegt werden solle, wurde von manchen bei feierlichen akademischen Anlässen betont, so vorn schon genannten Samuel Battier 1704, als er das Vikariat der griechischen Professur übernahm, so 1745 von. Breitinger und ein halbes Jahr nachher von Anton Birr in Basel beim Antritt eben dieses Lehramtes. Wir haben von dieser Vernachlässigung des Griechischen aus Birrs und Breitingers
 Zeit und auch noch aus späterer Zeit charakteristische
Proben. So war ums Jahr 1760 der als gelehrter Historiker
hochgeschätzte Jacob Christoph Beck, einer der Koryphäen
unserer Universität, nicht einmal im Stande einer leicht verständlichen
poetischen Inschrift aus Augst, die ihm der Altertumsforscher
Bruckner zur Begutachtung vorgelegt hatte, einen
vernünftigen Sinn abzugewinnen. 58) Und Johannes von Müller,
der in gereifterem Alter Griechisch als die höchst stehende
aller Sprachen bezeichnet und sich in dithyrambischen Lobpreisungen
der Herrlichkeiten der griechischen Litteratur ergeht, 59)
rieth 1773 seinem Freunde Bonstetten ab, Griechisch
zu lernen. Er lese selber die Griechen französisch. 60) Freilich
lag das Studium des Griechischen vor anderthalb, und zwei
Jahrhunderten fast überall darnieder, in den Niederlanden bis
auf Hemsterhuys 'und ziemlich auch in Deutschland bis auf
Reiske. 61) Und jene schweizerischen Klagereden sind nur ein
Widerhall ähnlicher in den Niederlanden z. B. von Hemsterhuys
und Valckenaer gehaltener. 62)
Zeit und auch noch aus späterer Zeit charakteristische
Proben. So war ums Jahr 1760 der als gelehrter Historiker
hochgeschätzte Jacob Christoph Beck, einer der Koryphäen
unserer Universität, nicht einmal im Stande einer leicht verständlichen
poetischen Inschrift aus Augst, die ihm der Altertumsforscher
Bruckner zur Begutachtung vorgelegt hatte, einen
vernünftigen Sinn abzugewinnen. 58) Und Johannes von Müller,
der in gereifterem Alter Griechisch als die höchst stehende
aller Sprachen bezeichnet und sich in dithyrambischen Lobpreisungen
der Herrlichkeiten der griechischen Litteratur ergeht, 59)
rieth 1773 seinem Freunde Bonstetten ab, Griechisch
zu lernen. Er lese selber die Griechen französisch. 60) Freilich
lag das Studium des Griechischen vor anderthalb, und zwei
Jahrhunderten fast überall darnieder, in den Niederlanden bis
auf Hemsterhuys 'und ziemlich auch in Deutschland bis auf
Reiske. 61) Und jene schweizerischen Klagereden sind nur ein
Widerhall ähnlicher in den Niederlanden z. B. von Hemsterhuys
und Valckenaer gehaltener. 62)
Nur auf einem Gebiet, das halb ausserhalb der Aufgaben zünftiger Philologie zu liegen schien, hat sich ein gewisser, man kann nicht sagen wissenschaftlicher, aber doch wissbegieriger Eifer während dieser ganzen toten Zeit geregt. Glarean und Tschudy, die erlauchten Begründer der Altertumsforschung im engem Sinn, haben, zumal im Kreis lokaler Antiquare, in Pfarrherren und Kuriositätenliebhabern, eine fast ununterbrochene Reihe von Nachfolgern gehabt. Die Zahl der aufgespeicherten Altertümer, der abgeschriebnen Inschriften wuchs in einem fort. Es gehört zu den vielen Vorzügen des XVIII. vor dem XVII. Jahrhundert, dass es auch, auf diesem Gebiete regeres Leben erweckte. 63) Die Zahl der Liebhaber nahm zu, man begann systematisch zu graben. Auch die Regierungen begannen eine andere Stellung zu diesen Dingen einzunehmen. Während in den 1580er Jahren die Basler Regierung sich, für ihren Beitrag an die Kosten der Augster Ausgrabungen durch Verwertung der gehobenen Bausteine schadlos hielt 64) und 1633 die acht zu Wettingen gefundnen aus einem Isis-Tempel stammenden
 Silbergefässe ohne Zögern auf die acht Orte, denen die
Grafschaft Baden gehörte, verteilt und samt und sonders eingeschmolzen
wurden, 65) begann nunmehr sich, nicht bloss die
Berner Regierung um Aventicum und die römischen Funde des
Aargau zu kümmern. 66) Auch den Regierungen von Basel und
Zürich finden wir es wiederholt nachgerühmt, dass sie nun das
einst Gefundne schützen, neue Ausgrabungen fördern, in einem
fort gelehrte Gutachten einholen.
Silbergefässe ohne Zögern auf die acht Orte, denen die
Grafschaft Baden gehörte, verteilt und samt und sonders eingeschmolzen
wurden, 65) begann nunmehr sich, nicht bloss die
Berner Regierung um Aventicum und die römischen Funde des
Aargau zu kümmern. 66) Auch den Regierungen von Basel und
Zürich finden wir es wiederholt nachgerühmt, dass sie nun das
einst Gefundne schützen, neue Ausgrabungen fördern, in einem
fort gelehrte Gutachten einholen.
Von besonderer Bedeutung war aber, dass zu den vielen dilettantischen oder bloss historisch gebildeten Forschern nunmehr auch solche kamen, die in vollem philologischem Rüstzeug an die Aufgabe treten konnten. Vorzüglich besass Zürich in dem Chorherrn Johann Kaspar Hagenbuch 67) einen Mann, der ein Leben voll strenger Arbeit an diese Studien setzte. Sein Eifer galt insbesondere den römischen Inschriften des Vaterlandes, die er vermöge seiner grossen Belesenheit und. seiner vielen sich allmählich auf die ganze Schweiz ausdehnenden Reisen in grosser Vollständigkeit zusammenbrachte. Er erkannte es dabei als seine Pflicht auch von den ausserschweizerischen genaue Kenntnis zu erwerben. So sammelte er ein ungeheures Wissensmaterial an; als er starb, hatte er 110 Quartanten voll geschrieben. Kaum kam er ob dem stäten Sammeln dazu, sein Wissen nutzbar zu machen. Sein schönster Erfolg war, als er für den 1747 auf dem Lindenhof in Zürich gefundnen Grabstein, dem andre Gelehrte ratlos gegenüber gestanden hatten, zu erklären wusste. Er wies daraus nach, dass sich in römischer Zeit zu Zürich eine Zollstation befunden hatte, und. dass damals der Ort schon den mittelalterlichen Namen Turicum geführt, also die seit der Humanistenzeit beliebte, dem Stolz der Zürcher so sehr schmeichelnde Beziehung von Zürich auf den alten helvetischen Gau der Tiguriner irrig war.
Für diese Darlegung brauchte Hagenbuch 148 Druckseiten in Quart. Und. noch diffuser ist das verhältnissmässig Wenige, was sonst von ihm im Druck erschienen ist. Er hatte den Fehler, dass er "von kleinen Dingen ebenso viel zu sagen wusste, als von grossen und wichtigen", (wie ihn denn Nachweise falscher
 Citate oder von Druckfehlern seitenlang beschäftigten),
dass er, um einen Ausdruck Reiskes zu wiederholen, "seine
Leser mit Belesenheit überschüttete und erstickte, wie eine
Lampe mit Öl."
Citate oder von Druckfehlern seitenlang beschäftigten),
dass er, um einen Ausdruck Reiskes zu wiederholen, "seine
Leser mit Belesenheit überschüttete und erstickte, wie eine
Lampe mit Öl."
Geschmackvollern Forschern, wie einem Johannes von Müller, galt Hagenbuch als Typus monströser, das Wissensobjekt überwuchernder Gelehrsamkeit. 68) Immerhin zeigt gerade die Schilderung, die Müller, einer seit Tschudy und Stumpf aufgekommnen Gewohnheit folgend, von dem Helvetien der Kaiserzeit entworfen hat, dass auch für den freiem Ausblick des Geschichtsforschers jene fleissigen Antiquare nicht umsonst gearbeitet hatten. Aber freilich: von Kuriositätenliebhaberei und Polyhistorie konnte eine Erneuerung der Philologie nicht ausgehen.
V.
Der Anfang einer bessern Zeit ist in Zürich wahrzunehmen. Aber nicht in dem Zürich Hagenbuchs, sondern in dem Zürich, das in Bodmer den Anstoss zu einer grossen litterarischen Bewegung gab, das Klopstock und Wieland in seinen Mauern beherbergte. Ein von schwärmerischer Freundschaft getragener Verkehr wurde von dort aus mit dem grossen Manne unterhalten, der aus dem Norden nach Rom gekommen den Römern und der ganzen Welt wieder die Herrlichkeit des belvederischen Apolls und das Wesen griechischer Kunst und ihre Geschichte erschloss. 69) Wol waren Winkelmanns Schweizer Freunde, wie die Füssli und die Usteri, wie auch Salomon Gesner, wie ferner der ihm ebenfalls nahestehende Basler Kupferstecher Mechel, nicht so sehr Altertumsforscher als feinfühlende Liebhaber der Künste. Aber es bahnte sich doch das wahre Verhältnis zum. Altertum an.
Und bald kam auch die Zürcher Philologie zu den litterarischen Denkmälern in eine andere Stellung. Ihre Hauptvertreter in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts, die Chorherren Steinbrüchel und Hottinger, bezeichnenderweise
 beide dem Idyllendichter und Künstler Salomon Gesner
nahe stehend, 70) wussten nicht bloss ganz anders als ihre
Vorgänger im Lehramt die Schriften der Alten zu einer Lebensquelle
zu machen für die von ihnen herangebildete Jugend.
Sie bemühten sich auch litterarisch um die Aneignung der
klassischen Werke. Beide übten das Übersetzen als Kunst,
und Hottinger mit entschiedenem Erfolg. Mit Ehren steht er
neben Wieland und Jacobs als geschätzter Mitarbeiter des
attischen Museums da, das die Aufgabe hatte, die klassische
Litteratur durch gute Übersetzungen den Gebildeten näher zu
bringen. Goethe schätzte ihn seiner Freundschaft würdig und
suchte ihn zur Zeit der helvetischen Wirren nach Deutschland
zu ziehen.
beide dem Idyllendichter und Künstler Salomon Gesner
nahe stehend, 70) wussten nicht bloss ganz anders als ihre
Vorgänger im Lehramt die Schriften der Alten zu einer Lebensquelle
zu machen für die von ihnen herangebildete Jugend.
Sie bemühten sich auch litterarisch um die Aneignung der
klassischen Werke. Beide übten das Übersetzen als Kunst,
und Hottinger mit entschiedenem Erfolg. Mit Ehren steht er
neben Wieland und Jacobs als geschätzter Mitarbeiter des
attischen Museums da, das die Aufgabe hatte, die klassische
Litteratur durch gute Übersetzungen den Gebildeten näher zu
bringen. Goethe schätzte ihn seiner Freundschaft würdig und
suchte ihn zur Zeit der helvetischen Wirren nach Deutschland
zu ziehen.
Hottinger war aber nicht allein geschickter Übersetzer, er war auch der erste Schweizer Philologe, der sich wieder an grössere Ausgaben wagte. Seine Arbeit galt besonders ciceronianischen Schriften. Ganz dem kühnen kritischen Geiste gemäss, der der ganzen Zeit und ihm persönlich eigen war, schreckte er dabei vor energischen Versuchen den überlieferten Text zu bessern nicht zurück.
Hottinger war nicht bloss in seiner Vaterstadt, sondern auch in Göttingen geschult worden. Es ist bekannt, wie die dortige Universität bald nach ihrer Gründung 1737 an die Spitze der deutschen Universitäten zu treten begann, und welcher Strom frischen wissenschaftlichen Lebens von ihr ausgieng. Die klassische Philologie stand hiebei hinter andern Fächern nicht zurück. Gesner und später Heyne waren in ihrer Art ausgezeichnete Vertreter derselben. Und so hat wie die Göttinger Geschichts- und Staatswissenschaft, auch die Göttinger Philologie belebend auf die Schweiz gewirkt. Auch Basel stand zu ihr in gewisser Beziehung. Hier ist das erste Erwachen philologischer Arbeit durch Anton Birr, den Lehrer Isaak Iselins, bezeichnet, der es unternahm Robert Stephanus' Thesaurus der lateinischen Sprache neu zu bearbeiten und Tüchtiges damit geleistet hat. Ihm folgte Lukas Legrand, 71) dessen Lebensarbeit zwar nach alter Philologensünde in Conjecturen
 und Einzelbemerkungen zu alten Autoren aufgieng, aber
doch in diesen einiges Bleibende zu Tage gefördert hat. Er
konnte eben doch besser Griechisch und beherrschte einen weitern
Litteraturkreis als seine Basler Vorgänger, 72) er wagte
sich sogar in einer scharfsinnigen Arbeit an den bis dahin in
der Schweiz fast ganz vernachlässigten Aeschylus. Man merkt
ihm den Contact mit der eben damals auch aufstrebenden deutschen
Philologie an. Er stand mit dem Aeschylusherausgeber
Schütz und dem trefflichen Strassburger Gelehrten Schweighäuser
in Verbindung. Besonders wertvoll für den einsamen
verdüsterten Mann war aber die Freundschaft, die ihn mit dem
damals auf der Höhe seines Ruhmes stehenden Heyne verband
und die schliesslich zu einer Publication des von Legrand verbesserten
Parthenius durch Heyne führte.
und Einzelbemerkungen zu alten Autoren aufgieng, aber
doch in diesen einiges Bleibende zu Tage gefördert hat. Er
konnte eben doch besser Griechisch und beherrschte einen weitern
Litteraturkreis als seine Basler Vorgänger, 72) er wagte
sich sogar in einer scharfsinnigen Arbeit an den bis dahin in
der Schweiz fast ganz vernachlässigten Aeschylus. Man merkt
ihm den Contact mit der eben damals auch aufstrebenden deutschen
Philologie an. Er stand mit dem Aeschylusherausgeber
Schütz und dem trefflichen Strassburger Gelehrten Schweighäuser
in Verbindung. Besonders wertvoll für den einsamen
verdüsterten Mann war aber die Freundschaft, die ihn mit dem
damals auf der Höhe seines Ruhmes stehenden Heyne verband
und die schliesslich zu einer Publication des von Legrand verbesserten
Parthenius durch Heyne führte.
Auch nach Bern, wo seit dem dritten Jahrzehnt der wackre Altmann als Theolog, Philolog und Freund der schönen Litteratur gewirkt hatte, und wo hernach, unter Hallers Einfluss die Geister überhaupt reger wurden, 73) hat sich der Einfluss der Göttinger Philologie erstreckt. Haller hatte in Göttingen den trefflichen Erfolg des von Gesner ins Leben gerufenen philologischen Seminars beobachtet, des ersten auf einer deutschen Hochschule gemachten Versuchs die Schüler zu eigner Production und zur Kunst des Lehrens anzuleiten. Nach Bern zurückgekehrt richtete Haller als Mitglied des Schulrats an der dortigen Akademie ebenfalls ein philologisches Seminar ein, 74) um, wie er sich selbst ausdrückt, "der abnehmenden Kenntnis der beiden klassischen Sprachen und der unerträglich schlechten Gelehrsamkeit der meisten Schulleute"abzuhelfen. Der helvetische Minister Stapfer hat vierundzwanzig Jahre später den Versuch gemacht, ein ähnliches Institut in Zürich ins Leben zu rufen. 75)
Der Einfluss Göttingens wurde abgelöst durch denjenigen Halles. Friedrich August Wolf, einst Heynes Schüler, dann sein grimmiger Widerpart, der von den Meistern unserer Litteratur bewunderte und besungene Homerkritiker, zog auch aus der Schweiz eine grosse Anzahl Studierender an. Von ihm
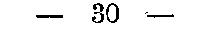 konnte man lernen, dass Philologie eine selbständige Wissenschaft,
nicht bloss eine Magd der Theologie, und wie umfassend
ihr Bau sei als einer das Altertum in der Gesamtheit seiner
Lebenserscheinungen umfassenden Wissenschaft. Wolf muss
auf die grosse Schar seiner philologischen Zuhörer einen wahrhaft
fascinierenden Einfluss ausgeübt haben. Aber man darf
wohl sagen, dass die Schweizer ihm ganz besonders nahe standen,
keiner mehr als der Zürcher Ochsner, 76) der jahrelang in täglichem
Umgang mit ihm stand und ihn auch 1797 auf einer
grossen philologischen Reise nach Holland begleitete, später
dann freilich die auf ihn gesetzten Hoffnungen nicht verwirklichte.
Auch für sein Andenken haben die Schweizer vorzüglich
gesorgt, Orelli und Usteri Stücke seiner Vorlesungen publiziert, 77)
Fäsi die von ihm liegen gelassene Ausgabe von Murets
Variae Lectiones zu Ende geführt, 78) unser alter Rektor
Hanhart ihm in einer Basler Schulschrift 79) einen begeisterten
Panegyricus gewidmet.
konnte man lernen, dass Philologie eine selbständige Wissenschaft,
nicht bloss eine Magd der Theologie, und wie umfassend
ihr Bau sei als einer das Altertum in der Gesamtheit seiner
Lebenserscheinungen umfassenden Wissenschaft. Wolf muss
auf die grosse Schar seiner philologischen Zuhörer einen wahrhaft
fascinierenden Einfluss ausgeübt haben. Aber man darf
wohl sagen, dass die Schweizer ihm ganz besonders nahe standen,
keiner mehr als der Zürcher Ochsner, 76) der jahrelang in täglichem
Umgang mit ihm stand und ihn auch 1797 auf einer
grossen philologischen Reise nach Holland begleitete, später
dann freilich die auf ihn gesetzten Hoffnungen nicht verwirklichte.
Auch für sein Andenken haben die Schweizer vorzüglich
gesorgt, Orelli und Usteri Stücke seiner Vorlesungen publiziert, 77)
Fäsi die von ihm liegen gelassene Ausgabe von Murets
Variae Lectiones zu Ende geführt, 78) unser alter Rektor
Hanhart ihm in einer Basler Schulschrift 79) einen begeisterten
Panegyricus gewidmet.
Die Wirksamkeit von Wolfs Schweizer Schülern, unter denen der Zürcher Chorherr Bremi jedenfalls der bedeutendste war, fällt der Hauptsache nach bereits in die Anfangszeiten unseres Jahrhunderts hinein. Beredt und geistvoll hat der letzte der gelehrten Hottinger am Ende seines der vaterländischen Geschichtsforschung geweihten Lebens die Mediations- und Restaurationszeit als eine Periode des Wiedererwachens des wissenschaftlichen Lebens in der Schweiz geschildert. 80) Vor allem fällt die durch den trefflichen Stapfer nach manchen vereinzelten frühern Versuchen umfassend angebahnte Unterrichtsreform ins Auge. Wol brach das Staatsgebäude, das für seine Schöpfungen Raum bieten sollte, zusammen, bevor dieselben ins Leben getreten waren. Aber andere traten nun in die Lücke. Fellenberg machte sein weltberühmtes Hofwyl zu einem Sitze auch der klassischen Studien. In den neuen Schweizer Kantonen beeiferte man sich Gymnasien zu errichten. 1802 entstand auf Betrieb des Patrioten und Naturfreundes Rudolf Meyer die Kantonsschule von Aarau, 1804 folgte die von Chur, 1809 die von St. Gallen. Andere schon längst bestehende
 Schulen dieser Stufe, wie die von Luzern und von Solothurn.
wurden eben damals ihrer Bestimmung näher gebracht. Auch
die alten Akademien wurden Gegenstand erhöhter Aufmerksamkeit.
Genf 81) sah, allerdings unter der Tyrannei eines napoleonischen
Präfekten, seine oberste .Anstalt durch eine Ecole
préparatoire de médecine erweitert. 1806 reorganisierte der
junge Kanton Waadt samt dem übrigen Schulwesen auch die
Lausanner Akademie, die einst die Berner der neueroberten
Waadt geschenkt, und die schon sie immer mehr aus einer rein
theologischen zu einer allgemeinen Bildungsanstalt ausgebaut
hatten. Und die Berner Akademie erhielt 1805 so ziemlich den
Lehrplan einer deutschen Universität, wenn sie auch nicht
wie eine solche organisiert war, und die philosophisch-philologische
Abteilung wesentlich den Charakter eines höhern
Gymnasiums hatte. Später folgte dann auch Basel nach.
Schulen dieser Stufe, wie die von Luzern und von Solothurn.
wurden eben damals ihrer Bestimmung näher gebracht. Auch
die alten Akademien wurden Gegenstand erhöhter Aufmerksamkeit.
Genf 81) sah, allerdings unter der Tyrannei eines napoleonischen
Präfekten, seine oberste .Anstalt durch eine Ecole
préparatoire de médecine erweitert. 1806 reorganisierte der
junge Kanton Waadt samt dem übrigen Schulwesen auch die
Lausanner Akademie, die einst die Berner der neueroberten
Waadt geschenkt, und die schon sie immer mehr aus einer rein
theologischen zu einer allgemeinen Bildungsanstalt ausgebaut
hatten. Und die Berner Akademie erhielt 1805 so ziemlich den
Lehrplan einer deutschen Universität, wenn sie auch nicht
wie eine solche organisiert war, und die philosophisch-philologische
Abteilung wesentlich den Charakter eines höhern
Gymnasiums hatte. Später folgte dann auch Basel nach.
Es versteht sich von selbst, dass das gelehrte Altertumsstudium aus diesem Aufschwung mit seinen Gewinn zog. Am sichtbarsten in der Weise, dass die Ausbreitung des humanistischen Unterrichts neue Aufgaben stellte und für die Philologen die Gelegenheit zu berufsmässiger Lehrthätigkeit vermehrte. Mit Dankbarkeit gedenken wir, dass die junge Kantonsschule Graubündens es war, die Orelli vom Pfarramte wegholte, dass die Kantonsschule des Aargaus unter einer Reihe tüchtiger Schulmänner auch Philologen von anerkanntem Rufe, darunter den ehrwürdigen Rudolf Rauchenstein, zählte, das später das reorganisierte Zürcher Gymnasium nicht bloss den eben genannten Orelli, sowie Baiter und Fäsi, beides gründliche Kenner der alten Litteratur, zu Lehrern hatte, sondern auch einen Gelehrten von Sauppes Bedeutung anderthalb Jahrzehnte in der Schweiz festhielt, und dass endlich unser Gymnasium in Roth einen Mann besass, der philologische Arbeiten von bleibender Bedeutung geliefert hat und der der würdigste Vertreter seines Faches an der Universität, gewesen wäre.
Und ähnlich wirkten die verjüngten Hochschulen Bern und Basel, zumal da sie, die eine in Abraham F. von Mutach, die andere in Johann Heinrich Wieland, schwungvolle Leiter und
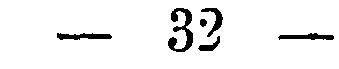 mutige Beschützer hatten, die es verstanden vorzügliche Lehrkräfte
zugewinnen, die namentlich von der unwürdigen Auffassung
frei waren, dass die Lehrstellen dazu da seien, um den
Landeskindern eine gute Versorgung zu bieten, und die wol
wussten, dass dem Vaterland mit tüchtiger Schulung von
Scharen lernbegieriger Jünglinge besser gedient sei als mit
der ökonomischen Sicherstellung eines einzelnen Bürgersohnes.
Sie konnten ja beobachten, wie andere Zweige des deutschschweizerischen
Schulwesens ihre Blüte zum Teil eben solchen
von aussen herangezogenen Lehrkräften zu verdanken hatten;
so das Hofwyler Institut 82) und die neuen Kantonsschulen.
mutige Beschützer hatten, die es verstanden vorzügliche Lehrkräfte
zugewinnen, die namentlich von der unwürdigen Auffassung
frei waren, dass die Lehrstellen dazu da seien, um den
Landeskindern eine gute Versorgung zu bieten, und die wol
wussten, dass dem Vaterland mit tüchtiger Schulung von
Scharen lernbegieriger Jünglinge besser gedient sei als mit
der ökonomischen Sicherstellung eines einzelnen Bürgersohnes.
Sie konnten ja beobachten, wie andere Zweige des deutschschweizerischen
Schulwesens ihre Blüte zum Teil eben solchen
von aussen herangezogenen Lehrkräften zu verdanken hatten;
so das Hofwyler Institut 82) und die neuen Kantonsschulen.
Bei jener Bereicherung, welche die schweizerischen Universitäten damals von Deutschland her empfiengen, gieng auch unsere Wissenschaft nicht leer aus. Neben Gerlach, dem langjährigen Senior unserer Universität, sind besonders der mehrere Jahre in Bern wirkende feinsinnige Exeget. und Sprachforscher Döderlein, sowie der Bern mit Basel gemeinsame Historiker Kortüm zu nennen, dessen aus tiefster Seele kommenden und tief in die Seelen seiner Schüler dringenden geschichtlichen Vorträge und Schriften mit Vorliebe dem Altertum galten.
Der Zustand der schweizerischen Philologie in den ersten Friedensjahren, die in ganz Europa ein so reiches geistiges. Leben zur Entwicklung brachten, spiegelt sich am deutlichsten in einem litterarischen Unternehmen wieder, zu dem sich 1819 einer jener deutschen Gelehrten mit einem altzürcherischen Philologen verband. Im Vorwort der von Döderlein und Bremi herausgegebenen "philologischen Beiträge aus der Schweiz"wird es ziemlich unverholen ausgesprochen, dass auf diesem Wissenschaftsgebiete die Arbeitskräfte noch zerstreut seien, noch schlummerten, dass es gelte sie zu sammeln und zu wecken, und zwar unter Verwertung dessen, was man von der deutschen Wissenschaft empfangen, was der einzelne auf seiner deutschen Universität gelernt habe, und dass es gelte die Schweiz zur Teilnahme an der wissenschaftlichen Arbeit Deutschlands heranzuziehen.
Diese philologischen Beiträge erfüllten in der That, so
 kurz ihr Leben war, den erstrebten Zweck. Auch die aus der
Schweiz gebürtigen Mitarbeiter leisteten Anerkennenswertes,
vor Allem der Herausgeber Bremi selbst, dessen Arbeiten überhaupt
noch jetzt mit Achtung. genannt werden, wie er auch
als Lehrer die edelste Zierde des Carolinums war. Eifrig griffen
er und seine Zeitgenossen, unter denen der emsige Editor
J. Konrad Orelli, ein Vetter des bekannteren Johann Kaspar
Orelli, besondere Erwähnung verdient, in die allgemeine Gelehrtenarbeit
ein.
kurz ihr Leben war, den erstrebten Zweck. Auch die aus der
Schweiz gebürtigen Mitarbeiter leisteten Anerkennenswertes,
vor Allem der Herausgeber Bremi selbst, dessen Arbeiten überhaupt
noch jetzt mit Achtung. genannt werden, wie er auch
als Lehrer die edelste Zierde des Carolinums war. Eifrig griffen
er und seine Zeitgenossen, unter denen der emsige Editor
J. Konrad Orelli, ein Vetter des bekannteren Johann Kaspar
Orelli, besondere Erwähnung verdient, in die allgemeine Gelehrtenarbeit
ein.
Gleichzeitig machte sich der Einfluss deutscher Wissenschaft auf unser Land immer stärker fühlbar, mit einer Übermacht, der sich auch die welsche Schweiz nicht ganz entziehen konnte. 83) Wie die jungen Theologen aus Deutschland voll von Schleiermachers Lehre zurückkehrten, so wirkten Gottfried Hermann und Niebuhr, Welcker und Böckh auf ihre Schweizer Schüler. Die grossen Werke, die die Meister schufen, die machtvolle Kraft der Persönlichkeit, die manchen derselben eigen war, prägten sich tief ein, und die gerade damals in heftigen Kämpfen sich äussernden Gegensätze der verschiedenen Schulen brachten den jungen Philologen zum Bewusstsein,. welch grosse Probleme ihre Wissenschaft noch barg. Und als hernach auch in Zürich und Bern Universitäten nach deutschem Muster entstanden und bei der Gründung und zu wiederholten Malen nachher; gleich wie die unsrige, deutsche Altertumsforscher in unser Land brachten, darunter den ausserordentlich anregenden, mit wahrhaft sprühender Kraft begabten Hermann Köchly, da war die Schweiz das wirklich geworden, was man 1819 nur gewünscht hatte, vollgültige Mitarbeiterin in der klassischen Philologie.
Auch die Erforschung der heimischen Reste des Altertums fand nun eine viel würdigere Pflege. Mit dem zerfahrenen Dilettantismus früherer Zeit, der in Hallers immerhin gelehrtem Werke "Helvetien unter den Römern" (1811 und 1812) zum letzten Mal' in umfänglicher Darstellung zu Wort gekommen war; hatte es nun ein Ende. Die Fortschritte deutscher Denkmälerkunde kamen auch unserm Land zu Gute, in vollendetster
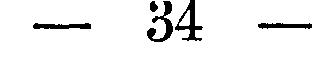 Weise durch die epigraphischen und historischen Arbeiten
Theodor Mommsens, dessen mehrjährigen Besitz Zürich den
politischen Verfolgungen der 50er Jahre zu danken hatte. Besonders
folgenreich war aber, dass den sozialen Gewohnheiten
unseres Jahrhunderts entsprechend die antiquarische Forschung
nun gesellschaftlich organisiert wurde. Dem Vorgang anderer
Länder folgend, unmittelbar aber veranlasst durch den Fund
einiger Hünengräber, traten 1832 in Zürich einige Altertumsfreunde
zusammen und gründeten die antiquarische Gesellschaft,
die so Hervorragendes leisten sollte. Basel und andere
Schweizerstädte folgten später. Nun begann man systematisch
nachzugraben und aufzudecken, den Ertrag von Entdeckungen
genau festzustellen und sorgfältig zu bewahren, umfassende
Publikationen zu veranstalten. Auch die umfänglichste schweizerische
Stadtruine, das alte Aventicum, das trotz des Stolzes
den man darauf setzte, von der befreiten Waadt viel mehr vernachlässigt
worden ist, als von deren einstigen Beherrschern,
den gnädigen Herren zu Bern, 84) hat endlich durch die 1885
gegründete Gesellschaft "pro Aventico" die gebührende Pflege
gefunden. -
Weise durch die epigraphischen und historischen Arbeiten
Theodor Mommsens, dessen mehrjährigen Besitz Zürich den
politischen Verfolgungen der 50er Jahre zu danken hatte. Besonders
folgenreich war aber, dass den sozialen Gewohnheiten
unseres Jahrhunderts entsprechend die antiquarische Forschung
nun gesellschaftlich organisiert wurde. Dem Vorgang anderer
Länder folgend, unmittelbar aber veranlasst durch den Fund
einiger Hünengräber, traten 1832 in Zürich einige Altertumsfreunde
zusammen und gründeten die antiquarische Gesellschaft,
die so Hervorragendes leisten sollte. Basel und andere
Schweizerstädte folgten später. Nun begann man systematisch
nachzugraben und aufzudecken, den Ertrag von Entdeckungen
genau festzustellen und sorgfältig zu bewahren, umfassende
Publikationen zu veranstalten. Auch die umfänglichste schweizerische
Stadtruine, das alte Aventicum, das trotz des Stolzes
den man darauf setzte, von der befreiten Waadt viel mehr vernachlässigt
worden ist, als von deren einstigen Beherrschern,
den gnädigen Herren zu Bern, 84) hat endlich durch die 1885
gegründete Gesellschaft "pro Aventico" die gebührende Pflege
gefunden. -
Ich kann nun nicht ausführlich schildern, wie die Behörden durch Erweiterung der Lehrpläne und Kreierung besonderer Lehrstühle für grammatische und für archäologische Forschung; durch Einrichtung von Seminarien, durch Anlage von Sammlungen, welche die Kunst des Altertums veranschaulichen sollten, den wachsenden Forderungen, die die philologische Arbeit stellt, gerecht wurden und für die Ebenbürtigkeit unserer Anstalten mit den deutschen bemüht waren. 85) Ebenso muss ich darauf verzichten, die seit den Dreissigerjahren in die Arbeit getretenen schweizerischen Philologen aufzuzählen und zu würdigen, oder auch auseinanderzusetzen, wie auf diese nun wiederum die deutsche Philologie, zumal der zur Nutzbarmachung von Talenten wunderbar begabte Friedrich Ritschl einwirkte. Noch steht diese Generation uns zu nahe. Aber mit Dankbarkeit und Stolz sei immerhin zweier Männer gedacht, die der schweizerischen Philologie vom vierten und vom sechsten
 Jahrzehnt unseres Jahrhunderts an besondere Ehre gemacht
haben, des vor einem halben Menschenalter Basel entrissenen
Wilhelm Vischer und des nun schon seit Jahren durch
schweres Leiden allem Wirken entzogenen Zürchers Arnold
Hug. Durch scharfsinnige und immer zuverlässige Arbeit haben
sie beide unsere Kenntnis der griechischen Litteratur und noch
mehr die der griechischen Altertümer bleibend gefördert.
Jahrzehnt unseres Jahrhunderts an besondere Ehre gemacht
haben, des vor einem halben Menschenalter Basel entrissenen
Wilhelm Vischer und des nun schon seit Jahren durch
schweres Leiden allem Wirken entzogenen Zürchers Arnold
Hug. Durch scharfsinnige und immer zuverlässige Arbeit haben
sie beide unsere Kenntnis der griechischen Litteratur und noch
mehr die der griechischen Altertümer bleibend gefördert.
VI.
Darf man nun nach dem allem von der schweizerischen Philologie als etwas Besonderm sprechen, da sie doch in ihrer ersten Blütezeit gar keinen speziell schweizerischen Charakter und gar nicht vorzugsweise Schweizer zu Trägern gehabt hat, und da sie späterhin nach langer Erstarrung nur durch Contact mit der deutschen Wissenschaft allmählich wieder emporgewachsen ist und es jetzt als ihr Höchstes betrachten muss, dass das, was ihre Lehrer hervorbringen, als Arbeit deutscher Wissenschaft anerkannt, und was sie lehren, dem Unterricht deutscher Fachgenossen gleichwertig sei?
Zu dieser völligen Unselbständigkeit der schweizerischen Philologie kommt noch ein zweites. Sonst wenn ein Volk seine Fackel an der des andern entzündet, so wird nicht selten durch die Übertragung die Flamme mächtiger als sie gewesen. Aber bei unserer Wissenschaft muss es offen bekannt werden, dass wir uns keiner Grösse ersten Ranges rühmen können, dass die Schweiz keinen Philologen aufweisen kann, der in seinen Fache auch nur annähernd die Stellung einnähme wie Buxtor in. der Hebraistik, oder Euler und die drei grossen Bernoulli in der Mathematik und Physik, oder Haller und. die Candolle's und Saussure's in ihren Disziplinen. Es giebt keinen schweizerischen Philologen von dem Ruhme Johannes von Müllers. Denn Erasmus dürfen wir doch nur sehr bedingt für uns in Anspruch nehmen. Und Orelli auf der andern Seite, den etwa die neuere schweizerische Philologie als ihren glänzendsten
 Namen verzeichnen möchte, kann man, will man der Wahrheit
die Ehre geben, nicht als einen grossen, wahrhaft bedeutenden
Gelehrten bezeichnen. 86) So bewundernswert sein Fleiss ist
und jene Empfänglichkeit für alle Äusserungen des geistigen
Lebens, die ihn befähigte, neben fruchtbarster klassisch-philologischer
Tätigkeit bis an sein Lebensende auch für die Theologie
und für die ihm einst in Bergamo näher getretene italienische
Litteratur tätig zu sein, so wirkungsvoll er ferner als
Lehrer gewesen sein muss vermöge seiner Fähigkeit sich zu
begeistern und andre zu begeistern, so muss man sich doch sehr
hüten, darum seine Leistungen als philologischer Fachmann
zu überschätzen. Er war nicht ein origineller Geist, hat der
Wissenschaft keine neuen Bahnen gewiesen, nicht einmal für
die Einzelforschung wichtige neue Gesichtspunkte gewonnen.
Und seine grossen Publikationen sind alle mit zu wenig Schärfe
und. Genauigkeit angefertigt, als dass ihnen bleibender Wert
zugesprochen werden könnte.
Namen verzeichnen möchte, kann man, will man der Wahrheit
die Ehre geben, nicht als einen grossen, wahrhaft bedeutenden
Gelehrten bezeichnen. 86) So bewundernswert sein Fleiss ist
und jene Empfänglichkeit für alle Äusserungen des geistigen
Lebens, die ihn befähigte, neben fruchtbarster klassisch-philologischer
Tätigkeit bis an sein Lebensende auch für die Theologie
und für die ihm einst in Bergamo näher getretene italienische
Litteratur tätig zu sein, so wirkungsvoll er ferner als
Lehrer gewesen sein muss vermöge seiner Fähigkeit sich zu
begeistern und andre zu begeistern, so muss man sich doch sehr
hüten, darum seine Leistungen als philologischer Fachmann
zu überschätzen. Er war nicht ein origineller Geist, hat der
Wissenschaft keine neuen Bahnen gewiesen, nicht einmal für
die Einzelforschung wichtige neue Gesichtspunkte gewonnen.
Und seine grossen Publikationen sind alle mit zu wenig Schärfe
und. Genauigkeit angefertigt, als dass ihnen bleibender Wert
zugesprochen werden könnte.
Mit dem Mangel an ganz hervorragenden philologischen Talenten hängt es auch zusammen, dass die Schweiz, die an das Ausland so viele wissenschaftliche Kräfte abgegeben, doch äusserst wenige klassische Philologen ausgesandt hat. Im XVI. Jahrhundert den ausgezeichneten St. Galler Vadian, der in Wien an die Studienzeit mehrjährige erfolgreiche, auch von litterarischen Arbeiten begleitete Lehrtätigkeit anknüpfte, aber dann doch im besten Alter die Heimat wieder aufsuchte, wo er keine Zeit und Gelegenheit mehr fand, sich um das Altertum zu kümmern. Dann im XVIII. Jahrhundert den Berner Wyttenbach, ausgezeichnet durch seine Arbeiten zu den. griechischen Philosophen, der in Holland seinen Wirkungskreis fand. und dort nach Ruhnkens Tode als Schulhaupt anerkannt war; doch kann er, obwol er sein Berndeutsch zeitlebens nicht verlernte, 87) nicht unbedingt für unser Land in Anspruch genommen werden, da er seine ganze höhere Bildung Deutschland verdankte. Und da wir von solchen billig schweigen müssen, die wie der Zürcher Hottinger zwar nach auswärts berufen würden, aber dem Ruf nicht folgten und so
 keine Gelegenheit hatten sich im Ausland zu bewähren, da wir
auch Numismatiker und Antiquare wie die Berner Andreas
Morell und Samuel v. Schmid bei Seite lassen müssen, bleibt
es nur noch übrig, der zwei baslerischen Mitbürger zu gedenken,
die jetzt in München und Jena philologische Lehrstühle
einnehmen. -
keine Gelegenheit hatten sich im Ausland zu bewähren, da wir
auch Numismatiker und Antiquare wie die Berner Andreas
Morell und Samuel v. Schmid bei Seite lassen müssen, bleibt
es nur noch übrig, der zwei baslerischen Mitbürger zu gedenken,
die jetzt in München und Jena philologische Lehrstühle
einnehmen. -
Dass die Philologie in der Schweiz andern Disziplinen nicht ganz ebenbürtig sei, wird endlich vielleicht mancher auch daraus folgern, dass während die Naturforscher und die Geschichtsforscher, die Juristen und die Mediziner zu allgemein schweizerischen Gesellschaften zusammengetreten sind, es an einer klassisch-philologischen Vereinigung fehlt. Auch zu einer schweizerischen Fachzeitschrift haben es die Philologen nicht gebracht. Alle Versuche, eine solche zu begründen; sind schliesslich gescheitert, und das Höchste, was man etwa erreichte, war Ausdehnung des Siechtums auf mehrere Jahre.
Man fragt nach der Ursache dieses ungünstigen Verhältnisses. Da dürfen wir nicht etwa auf den Umstand zu viel Gewicht legen, dass bei uns die Philologie nach herrlicher Blüte in Erasmus' Zeit, hernach in der Zeit eines Scaliger, eines Bentley mehr als zweihundert Jahre in Todesstarre lag und sich dann erst allmählich wieder erhob. Denn Analoges gilt für ganz Deutschland. Die unlösliche Verkettung unseres geistigen Lebens mit demjenigen Deutschlands zeigt sich hier auch nach der schlimmen Seite. Auch für das litterarische Gebiet hat man ja beobachtet, dass der Schweizer, ohne an dem materiellen und politischen Elend des Reichs teilzunehmen, doch an den Folgen dieses Elends nicht minder als der Reichsdeutsche litt.
Das Bemerkenswerte und. Unerfreuliche ist vielmehr, dass nur das XVI. Jahrhundert die Schweiz in führender Stellung, die gesamte folgende Zeit aber dieselbe im Hintertreffen zeigt. Die Stagnation ist bei uns ganz besonders schlimm und der Aufschwung nicht bloss nicht spontan, sondern auch, wenn schon erfreulich, doch gar nicht glänzend gewesen
Äussere Umstände fallen für die Erklärung dieser Inferiorität
 kaum in Betracht. Man könnte zwar unter Hinweis
auf den grossen Einfluss, den z. B. die Palatina 88) und dann wieder
die Göttinger Bibliothek auf die philologische Blüte der
zugehörigen Universitäten ausgeübt haben, der Dürftigkeit
der schweizerischen Bibliotheken etwelche Schuld beimessen
wollen. Insbesondere sind wir ja an Handschriften antiker Autoren
ganz besonders arm. Das einzige an derartigen Schätzen
wirklich reiche Kloster, das von St. Gallen, ist, bevor die Studien
bei uns erwachten, von den aus Konstanz zum Besuch gekommenen
italienischen Gelehrten geplündert worden. Und
wenn in anderen Ländern durch mäcenatisch geartete Fürsten
oder Männer fürstlicher Lebensstellung Sammlungen angelegt
wurden, die an Reichhaltigkeit alle klösterlichen Bibliotheken
weit übertreffen, so ist dies eben eine Gattung von Menschen,
für die bei uns niemals Raum war. Nur durch eine eigentümliche
Verkettung von Umständen ist die einzige auf solchem
Wege zu Stande gekommene Büchersammlung, die die Schweiz
besitzt, die Bongarsiana, nach Bern gelangt. Der reiche Ertrag,
den sie den Philologen unseres Jahrhunderts geliefert hat, 89)
lässt uns in der Tat lebhaft bedauern, dass der schweizerischen
Philologie nicht mehr Schätze dieser Art zu Gebote standen.
Aber, wie mir scheint, wird dieser Nachteil ziemlich aufgewogen
durch den Vorzug, den wir durch den, zu so vielfältiger
Forschung anregenden Besitz einheimischer römischer Altertümer
und durch den historischen Zusammenhang der Schweiz
mit dem römischen Altertum vor Norddeutschland und, vor den
Niederlanden haben. Der Mangel antiker Reste in den letztem
hilft die auffällige Vernachlässigung der Epigraphik und Archäologie
durch die niederländischen Gelehrten erklären.
kaum in Betracht. Man könnte zwar unter Hinweis
auf den grossen Einfluss, den z. B. die Palatina 88) und dann wieder
die Göttinger Bibliothek auf die philologische Blüte der
zugehörigen Universitäten ausgeübt haben, der Dürftigkeit
der schweizerischen Bibliotheken etwelche Schuld beimessen
wollen. Insbesondere sind wir ja an Handschriften antiker Autoren
ganz besonders arm. Das einzige an derartigen Schätzen
wirklich reiche Kloster, das von St. Gallen, ist, bevor die Studien
bei uns erwachten, von den aus Konstanz zum Besuch gekommenen
italienischen Gelehrten geplündert worden. Und
wenn in anderen Ländern durch mäcenatisch geartete Fürsten
oder Männer fürstlicher Lebensstellung Sammlungen angelegt
wurden, die an Reichhaltigkeit alle klösterlichen Bibliotheken
weit übertreffen, so ist dies eben eine Gattung von Menschen,
für die bei uns niemals Raum war. Nur durch eine eigentümliche
Verkettung von Umständen ist die einzige auf solchem
Wege zu Stande gekommene Büchersammlung, die die Schweiz
besitzt, die Bongarsiana, nach Bern gelangt. Der reiche Ertrag,
den sie den Philologen unseres Jahrhunderts geliefert hat, 89)
lässt uns in der Tat lebhaft bedauern, dass der schweizerischen
Philologie nicht mehr Schätze dieser Art zu Gebote standen.
Aber, wie mir scheint, wird dieser Nachteil ziemlich aufgewogen
durch den Vorzug, den wir durch den, zu so vielfältiger
Forschung anregenden Besitz einheimischer römischer Altertümer
und durch den historischen Zusammenhang der Schweiz
mit dem römischen Altertum vor Norddeutschland und, vor den
Niederlanden haben. Der Mangel antiker Reste in den letztem
hilft die auffällige Vernachlässigung der Epigraphik und Archäologie
durch die niederländischen Gelehrten erklären.
Sicherer wird uns die Erwägung leiten, dass die Schweiz mit ihrer philologischen Inferiorität innerhalb der deutschen Lande nicht allein steht. Vorerst hat das katholische Deutschland an den klassischen Studien nur ganz geringen Anteil gehabt, ist erst unter protestantischem Einfluss zur Mitarbeit herangewachsen. Sodann ist überhaupt das uns zunächst benachbarte Süddeutschland nach dieser Seite hin gar nicht
 fruchtbar gewesen. Um von Baiern zu schweigen, das erst
durch Thiersch und seine Schule allmählich aus der Barbarei
emporgehoben wurde, giebt es keinen grossen schwäbischen
Philologen, und unter den Badensern steht August Böckh, allerdings
der grössten einer, recht vereinsamt da. Seit dem XVII.
Jahrhundert hat die klassische Philologie Deutschlands ihren
Hauptsitz im protestantischen Norden. Dort hat sie die Höhe
erstiegen, auf der sie heute steht. Alle grossen Philologenschulen
haben protestantische Lehrer norddeutscher Hochschulen
zu Führern gehabt.
fruchtbar gewesen. Um von Baiern zu schweigen, das erst
durch Thiersch und seine Schule allmählich aus der Barbarei
emporgehoben wurde, giebt es keinen grossen schwäbischen
Philologen, und unter den Badensern steht August Böckh, allerdings
der grössten einer, recht vereinsamt da. Seit dem XVII.
Jahrhundert hat die klassische Philologie Deutschlands ihren
Hauptsitz im protestantischen Norden. Dort hat sie die Höhe
erstiegen, auf der sie heute steht. Alle grossen Philologenschulen
haben protestantische Lehrer norddeutscher Hochschulen
zu Führern gehabt.
Dieser Vorrang des protestantischen Nordens beruht unverkennbar auf der Macht der humanistischen Schultradition, die sich dort durch alle Zeiten des Niedergangs, der Verknöcherung hindurch aus dem Reformationszeitalter, von Melanchthon, dem praeceptor Germaniae, her, in die neuere Zeit hinübergerettet hat. Durch den gymnasialen Unterricht wurde so starkes Interesse für die alten Autoren, so sichere Beherrschung der alten Sprachen erzielt, er forderte ferner so viel von den Lehrern, dass auf diesem Gebiet gelehrtes Studium unmöglich ausbleiben konnte. Und nun stelle man etwa der ehrwürdigen Reihe altbewährter Sitze klassischen Studiums, die allein z. B. das albertinische Sachsen mit seinen drei Fürstenschulen Pforte, Grimma, St. Afra in Meissen, mit seiner Thomasschule aufweisen kann, die wenigen und meist völlig unzulänglichen gymnasialen Anstalten gegenüber, die die alte Schweiz besass. Eine derartige Vergleichung wird das Staunen über die Inferiorität der schweizerischen Philologie erheblich verringern.
Man könnte nun freilich gegen die hier gegebene Darlegung einwenden, dass der energische protestantische Humanismus nicht so ausschliesslich dem Norden eignete, um den so wesentlich norddeutschen Ursprung der deutschen Philologie zu erklären. Man könnte erstens darauf hinweisen, dass der sächsische Humanismus ein Ableger des strassburgischen ist, hier in Strassburg. Johannes Sturm ein weithin bewundertes und wirksames Mustergymnasium errichtet hatte. Nun gerade
 Strassburg ist zur Zeit tiefen sonstigen Niedergangs im XVII.
Jahrhundert Sitz einer eigentümlich gerichteten Philologenschule
gewesen und hat seine Ehrenstellung bis in unser Jahrhundert,
bis in die Zeit der entschiedenen Gallisierung behauptet.
Es genügt für die ältere Zeit an Freinsheim, für die jüngere
an Schöpflin, Brunck, Schweighäuser zu erinnern. Strassburg
bestätigt also gerade die aufgestellte These. Mitbedingt war
die dortige Blüte unserer Disziplin durch die, Strassburg vor
seinen schweizerischen Schwesterstädten auszeichnende Liberalität
in der Berufung Auswärtiger. Die Begründer der ältern,
sogen. historisch-politischen Schule stammten sämtlich aus andern
deutschen Landen.
Strassburg ist zur Zeit tiefen sonstigen Niedergangs im XVII.
Jahrhundert Sitz einer eigentümlich gerichteten Philologenschule
gewesen und hat seine Ehrenstellung bis in unser Jahrhundert,
bis in die Zeit der entschiedenen Gallisierung behauptet.
Es genügt für die ältere Zeit an Freinsheim, für die jüngere
an Schöpflin, Brunck, Schweighäuser zu erinnern. Strassburg
bestätigt also gerade die aufgestellte These. Mitbedingt war
die dortige Blüte unserer Disziplin durch die, Strassburg vor
seinen schweizerischen Schwesterstädten auszeichnende Liberalität
in der Berufung Auswärtiger. Die Begründer der ältern,
sogen. historisch-politischen Schule stammten sämtlich aus andern
deutschen Landen.
Mit besserm Recht als auf Strassburg könnte man auf .Würtemberg hinweisen, von Alters her so reich an trefflichen Schulen und verhältnismässig so arm an Philologen. Es kann uns dieses Beispiel allerdings mahnen, noch andere Momente als das der Schule für Lösung unseres Problems mit heranzuziehen. Es fällt für die Schwaben vielleicht zum Teil die weite Entfernung von den Niederlanden und England in Betracht, von denen ja Deutschland erst die rechte Philologie erlernen musste. Das Wesentliche scheint mir der im Volkscharakter liegende oder ihm anerzogene spekulative Sinn und die auch ausserhalb des Altertumsstudiums bemerkbare Abkehr von den mehr historisch gearteten Studien.
Auch bei den Schweizern müssen wir ein solches allgemeineres Moment mit in Betracht ziehen. Man vergegenwärtige sich die sonstige geistige Ausstattung, die ganze Sinnesweise unseres Volkes. Unsere litterarische Begabung ist ja anerkanntermassen bloss zweiten Ranges. Nun hat aber die Philologie ihr eigentliches Centrum in der Beschäftigung mit der Litteratur. Es ist natürlich, dass der litterarisch minder Begabte auch minder befähigt ist, Litterarisches zu würdigen und zu verstehen, minder befähigt, die verwischte Hand des Dichters, des grossen Stilisten mit nachschaffender Phantasie zu ergänzen. Man darf wohl sagen, die Schweiz hat aus demselben Grunde keinen Gottfried Hermann und keinen Welcker
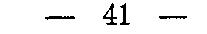 hervorgebracht, aus dem sie keinen Lessing und Herder — um
noch grössere Namen gar nicht zu nennen —hervorgebracht hat..
hervorgebracht, aus dem sie keinen Lessing und Herder — um
noch grössere Namen gar nicht zu nennen —hervorgebracht hat..
Zu entsprechendem Resultat gelangt man, wenn man fragt, was für Aufgaben sich die Schweizer am liebsten zugewandt haben. Man wird sie so auch am gerechtesten würdigen lernen. In der conjecturellen Kritik, besonders der Dichterkritik, haben sie im ganzen wenig Sicheres geleistet, mehr in der Erklärung; sie zeigen aber auch da erkennbare Vorliebe für bestimmte Litteraturgebiete. Homer freilich und Horaz, die jedes Herz höher schlagen machen, das der Poesie nicht völlig abgestorben ist, haben Pflege gefunden und zwar nicht unerspriessliche. Aber im Grunde wie wenig haben wir für die übrige antike Dichtung geleistet. Die auffällige Neigung für Persius und Juvenal, die den schweizerischen Philologen und Litteraten eignet, stimmt zu der Neigung fürs Sittenrichterliche, die der eigenen litterarischen Production der Schweiz anhaftet, 90) und ist, wenn man aufrichtig sein will, gerade ein Beweis für Mangel an poetischem Sinn. Dagegen die attischen Redner, ein Cicero, ein Sallust, ein Tacitus: das sind von jeher die Lieblingsautoren. unserer Philologen gewesen, und zwar mehr ihres Inhalts als ihrer Darstellungskunst wegen. Ihr Reichtum an geschichtlichem Stoff und an politischen Gedanken, ihr lehrhafter Ton wirkte anziehend. Und so waren schon die ersten Schweizer Humanisten, die von Geburt Schweizer Waren, Glarean und Vadian, in der Realerklärung von. Historikern und Geographen am stärksten. Darnach wundert es uns nicht, dass von den systematischen Arbeitsgebieten der Philologie die Litterärgeschichte sehr wenig, die Lehre von den Antiquitäten, zumal den politischen, sehr namhafte Förderung seitens der Schweizer erfahren hat. Es scheint mir. bemerkenswert, dass die durch Abstammung und einstige Verfassung den Schweizern so .nahe stehenden Strassburger bis auf Schweighäuser hinab mit einziger, Ausnahme Bruncks ebenfalls diese historisch-politische Richtung der Philologie vertreten.
Man hat oft darauf hingewiesen, wie belehrend für die
 englischen Historiker das bewegte politische Leben ihres Landes
von jeher gewesen ist. Man weiss auch, welchen Gewinn
Niebuhr für seine Darstellung der römischen Geschichte aus
dem Umstand gezogen hat, dass er inmitten der freiheitlich
lebenden Marschbauern aufgewachsen war, sodass er nach dem
Ausdruck seines neuesten Biographen 91) die Schemen römischer
Vorzeit, welche er von den Toten auferweckte, mit dem Blute
seiner Heimat nähren konnte. Nun auch manchem Schweizer
Philologen haben die kleinstaatlichen republikanischen Verhältnisse
der eigenen Heimat zum rechten Verständnis antiken,
besonders hellenischen Staatslebens verholfen. Selbst kleine
Einzelheiten des griechischen Verfassungswesens, wie das
Stimmrecht der in die delphische Amphiktyonie eingegliederten
Staaten, wie die Anwendung des Looses in Athen, wie das
Sitzen und Stehen in den Volksversammlungen, sind von schweizerischen
Forschern durch Vergleichung analoger heimischer
Einrichtungen erst ins rechte Licht gestellt worden. 92) Es kann
dies um so weniger Befremden erregen, als selbst Ausländer,
wie z. B. der hervorragende englische Historiker Georg Grote,
die schweizerischen Verhältnisse zu dem Zweck studiert haben,
um die politische Geschichte Griechenlands besser verstehen
zu lernen. 93) -
englischen Historiker das bewegte politische Leben ihres Landes
von jeher gewesen ist. Man weiss auch, welchen Gewinn
Niebuhr für seine Darstellung der römischen Geschichte aus
dem Umstand gezogen hat, dass er inmitten der freiheitlich
lebenden Marschbauern aufgewachsen war, sodass er nach dem
Ausdruck seines neuesten Biographen 91) die Schemen römischer
Vorzeit, welche er von den Toten auferweckte, mit dem Blute
seiner Heimat nähren konnte. Nun auch manchem Schweizer
Philologen haben die kleinstaatlichen republikanischen Verhältnisse
der eigenen Heimat zum rechten Verständnis antiken,
besonders hellenischen Staatslebens verholfen. Selbst kleine
Einzelheiten des griechischen Verfassungswesens, wie das
Stimmrecht der in die delphische Amphiktyonie eingegliederten
Staaten, wie die Anwendung des Looses in Athen, wie das
Sitzen und Stehen in den Volksversammlungen, sind von schweizerischen
Forschern durch Vergleichung analoger heimischer
Einrichtungen erst ins rechte Licht gestellt worden. 92) Es kann
dies um so weniger Befremden erregen, als selbst Ausländer,
wie z. B. der hervorragende englische Historiker Georg Grote,
die schweizerischen Verhältnisse zu dem Zweck studiert haben,
um die politische Geschichte Griechenlands besser verstehen
zu lernen. 93) -
Auch in Grammatik und Lexikographie haben die Schweizer bis in die Zeiten der Gegenwart Anerkennenswertes geleistet. Dies übrigens auch ausserhalb der klassischen Sprachen: ich erinnere an Konrad Gesners Arbeiten zur allgemeinen Linguistik; ferner an die Buxtorfe, denen sich eine weitere Reihe namhafter Orientalisten zugesellt; an die Sprachforscher auf germanistischem und romanistischem Gebiet. Ich hielte es nicht für undenkbar, 94) dass sich der grammatische. Sinn an dem Gegensatz zwischen Mundart und Schriftsprache, vielleicht auch an dem zwischen Deutsch und Welsch, geschult hätte.
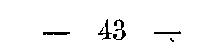
VII.
Das weit Wichtigste und Bedeutendste aber, was die Philologie leisten konnte, war, dass ihre Lehrer und Schüler durch Jahrhunderte hindurch unserm Vaterland humanistische Bildung vermittelt haben. Wie sie das gethan und mit welchem Erfolg sie es gethan haben; was für die Schweiz die humanistische Bildung bedeutet hat und noch bedeutet, ist eine viel zu umfassende und zu ernste Frage, als dass ich mich getraute sie so anhangsweise abzuthun. Jedenfalls, das kann man vielleicht der heute gegebenen Darstellung entnehmen, werden die weiteren Geschicke der klassischen Philologie in der Schweiz ganz wesentlich bedingt sein durch die Geschicke des humanistischen Unterrichts. Freilich wird ja auch nach dessen allfälliger Unterdrückung Studium des Griechischen und des Latein getrieben werden, so gut als am Ende Arabisch und Chinesisch studiert wird. Aber ihre Hauptaufgabe und ihren Hauptwert wird die klassische Philologie alsdann verloren haben. Doch was will der Niedergang einer einzelnen Disziplin gegenüber den anderweitigen Folgen der von Manchen ersehnten Umgestaltung bedeuten? Nicht dass die Alten selbst durch sie geschädigt würden. Sie stehen nicht weniger gross da, wenn die Zwerge ihnen den Rücken kehren. Wird aber für uns, für unsere ganze geistige Bildung der Schaden ausbleiben? Werden besonders wir Schweizer leicht den Zusammenhang mit einer Kultur missen können, aus der uns eine so männlich-patriotische, so freiheitliche, so wahrhaft republikanische Luft entgegenweht?
"Die Musen rächen sich an jedem, der sie hasst."
Anmerkungen.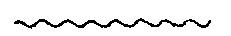
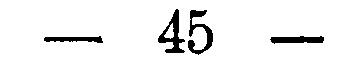
 bloss auf Inschriften von Aventicum erstreckt haben. Dass alle die genannten
neun auf ihn zurückgehen, ergiebt sich aus folgender Erwägung. Jene
neun Inschriften müssen als einheitliche Sammlung gefasst werden; denn
sie sind genau dieselben, welche der sogen. Antiquus Stumpfii im cod. L.
fol. Nr. 47 der Zürcher Stadtbibliothek S. 113 und 114 mitteilt. (Vgl. über
denselben Vögelin, Jahrbuch für schweizerische Geschichte 11, 41 f. Dübi,
die alten Berner und die römischen Altertümer S. 9. 11 f. Durch die Güte
des Hrn. Dr. H. Escher, Oberbibliothekars der Zürcher Stadtbibliothek,
konnte ich die Handschrift hier in Basel benützen.) Eine solche Übereinstimmung
kann nicht auf Zufall beruhen. Die Reihenfolge ist zum Teil
ebenfalls identisch; die Abweichungen erklären sich leicht aus den kalligraphischen
Neigungen des "Antiquus", der auf symmetrische Anordnung
das Hauptaugenmerk richtete. Bei beiden beginnt die Sammlung mit 164
und 198, und schliesst mit 154. Auf 198. folgen bei Amerbach 195, 175, 187,
178, 155, 300, beim Antiquus 175, 187, 155, 200, 178, 195. Ohne diese zwei
letzten Nummern, die der Antiquus nach äussern Rücksichten aus der bei
Amerbach bewahrten Reihenfolge herausgerissen zu haben scheint, wäre die
Übereinstimmung eine völlige.
Den vollen Entscheid geben die Texte selbst, die in zahlreichen Lesungen
übereinstimmen. 154, 12 haben beide zu Anfang der Zeile I statt P, Z. 14 beide LX
statt EX und LD statt LDDD.
155, 2 hat Am. wie der Ant. das richtige GEN (Tschudi und Stumpf
GENI), Z. 4 beide wie Tsch. und St. den Fehler FLORIANUS statt
FLORINUS, und beide lassen wie Tsch. und St. Zeile 9 und 10 weg.
164 giebt hier zu keiner Bemerkung Anlass.
175, 1 fehlt bei beiden LEGATO. Z. 2 beide IMPER. CAE. (Tsch.
und St. IMP. CAES.). Z, 5 beide FIRMIAE (was wahrscheinlich
richtiger ist als das FIRMAE der andern) und am Schluss fehlerhaft
PRAETOR statt PRAETORI. Z. 10 beide zu Anfang kein I. Z. 12
Amerbach wie der Antiquus das monströse IMPLA AETIOPUM, eine
Übereinstimmung, die allein schon den Ausschlag geben müsste. (Vgl.
Vögelin 11, 45).
178, 1 hat Am. wie der Ant. das richtige CAESARIS (Tsch. und
St. CAESAR). ' .
187, 2 beide CAMILLIUS (Tsch. handschriftlich CAMILLUS); Z. 8
beide LXXXXII (St. LXXXXI).
.195 hat Amerbach genau so unvollständig wie der Antiquus, d. h.
nur Stücke von Z. 3 und 4.
198 giebt hier zu keiner Bemerkung Anlass.
200, 3 haben beide den Fehler CA statt CN.
bloss auf Inschriften von Aventicum erstreckt haben. Dass alle die genannten
neun auf ihn zurückgehen, ergiebt sich aus folgender Erwägung. Jene
neun Inschriften müssen als einheitliche Sammlung gefasst werden; denn
sie sind genau dieselben, welche der sogen. Antiquus Stumpfii im cod. L.
fol. Nr. 47 der Zürcher Stadtbibliothek S. 113 und 114 mitteilt. (Vgl. über
denselben Vögelin, Jahrbuch für schweizerische Geschichte 11, 41 f. Dübi,
die alten Berner und die römischen Altertümer S. 9. 11 f. Durch die Güte
des Hrn. Dr. H. Escher, Oberbibliothekars der Zürcher Stadtbibliothek,
konnte ich die Handschrift hier in Basel benützen.) Eine solche Übereinstimmung
kann nicht auf Zufall beruhen. Die Reihenfolge ist zum Teil
ebenfalls identisch; die Abweichungen erklären sich leicht aus den kalligraphischen
Neigungen des "Antiquus", der auf symmetrische Anordnung
das Hauptaugenmerk richtete. Bei beiden beginnt die Sammlung mit 164
und 198, und schliesst mit 154. Auf 198. folgen bei Amerbach 195, 175, 187,
178, 155, 300, beim Antiquus 175, 187, 155, 200, 178, 195. Ohne diese zwei
letzten Nummern, die der Antiquus nach äussern Rücksichten aus der bei
Amerbach bewahrten Reihenfolge herausgerissen zu haben scheint, wäre die
Übereinstimmung eine völlige.
Den vollen Entscheid geben die Texte selbst, die in zahlreichen Lesungen
übereinstimmen. 154, 12 haben beide zu Anfang der Zeile I statt P, Z. 14 beide LX
statt EX und LD statt LDDD.
155, 2 hat Am. wie der Ant. das richtige GEN (Tschudi und Stumpf
GENI), Z. 4 beide wie Tsch. und St. den Fehler FLORIANUS statt
FLORINUS, und beide lassen wie Tsch. und St. Zeile 9 und 10 weg.
164 giebt hier zu keiner Bemerkung Anlass.
175, 1 fehlt bei beiden LEGATO. Z. 2 beide IMPER. CAE. (Tsch.
und St. IMP. CAES.). Z, 5 beide FIRMIAE (was wahrscheinlich
richtiger ist als das FIRMAE der andern) und am Schluss fehlerhaft
PRAETOR statt PRAETORI. Z. 10 beide zu Anfang kein I. Z. 12
Amerbach wie der Antiquus das monströse IMPLA AETIOPUM, eine
Übereinstimmung, die allein schon den Ausschlag geben müsste. (Vgl.
Vögelin 11, 45).
178, 1 hat Am. wie der Ant. das richtige CAESARIS (Tsch. und
St. CAESAR). ' .
187, 2 beide CAMILLIUS (Tsch. handschriftlich CAMILLUS); Z. 8
beide LXXXXII (St. LXXXXI).
.195 hat Amerbach genau so unvollständig wie der Antiquus, d. h.
nur Stücke von Z. 3 und 4.
198 giebt hier zu keiner Bemerkung Anlass.
200, 3 haben beide den Fehler CA statt CN.
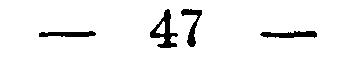 Es kann hienach kein Zweifel sein, dass der Text Amerbachs und der
des Antiquus die gleiche Abschrift wiedergeben. Nur bietet jener vielmehr.
Erstens genaue Notizen über den Fundort, während solche beim Antiquus
gänzlich fehlen. 154 "apud tabernam mensoriam". 155 "in templo iuxta
altare". 161 "Wibelspurg non longe a Murta". "Avantici: In ciuitate".
175 "in templo extra cinitatem". 178 "in foro". 187 ,;in pago Wiler, non
"longe ab Aventico. In introitu templi". 195 "in turri maximis litteris".
Vgl. Tschudi: "an einem Thurn der Stadt mit hohen grossen Buchstaben".
(Für 198 fehlt die Ortsangabe.) 200 "in vestibulo templi non inaugurato,
iam carie absumpta". Diese Angaben weichen von denen der andern Berichterstatter
mehrfach ab. 154 las Tschudi am Eckstein eines Bauernhauses;
zu 155 hat keiner sonst die genauere Angabe "iuxta altare"; "extra
civitatem" zu 175 ist treffend, da die, diese Inschrift bietende alte Martinskirche
ausserhalb des modernen Avenches lag, im Unterschied von der in
Mitte des letztem gelegenen Mariamagdalenenkapelle, wo sich Inschrift 164
befand; 178 las Tschudi an einem Bauernhaus in Münchweiler; 187 las
Tschudi in der Kirche beim Altar.
Zweitens hat Amerbach bei 154, 164, 187, 200 einen Umriss des Steins,
bei 198 den Schnörkel am Ende von Zeile 1 und durchweg genau die Zeilenabteilung
des Originals, während hierin der Antiquus mit grösster Willkür
verfährt. Und während dieser das PATRONO (175, 13) von der Inschrift
auf Seite 113 abtrennt und, ohne etwa durch Raumnot veranlasst zu
sein, seine neue Seite 114 mit diesem Wort beginnt, hat es Amerbach ganz
an richtiger Stelle. Er giebt auch 154, 12 links von L einen starken Zwischenraum,
während beim Antiquus sowie bei Tsch. und St. kein solcher
angegeben ist. (Vgl. Vögelin 11, 88 Anm.).
Drittens bietet Amerbach vielfach richtigere Lesarten: 154, 7 AVENTICENS.
155, 1 AVENTIAE. 175, 4 GERMAN. 175, 11 CONSTANS.
187, 2 L (nicht LV). 187, 4 die richtige Zahl. 198, 1 LIAE (der Antiquus,
Tsch. und St. AELIAE). 198, 5 FILIAE. DULCISSIMAE (der Antiquus
die umgekehrte Wortfolge). Von diesen Abweichungen ist die zu 198, 1
die interessanteste, weil sie zeigt, dass der Antiquus wenigstens einmal von
sich aus ergänzt hat. Vögelins Bemerkung (11, 98), dass die Anfangsbuchstaben
der Inschrift 198 im XVI. Jahrhundert noch vorhanden gewesen
seien, ist nun nicht mehr zu halten.
Viertens stimmt in der Anwendung und Nichtanwendung von Ligaturen
Amerbach fast ausnahmslos mit den Steinen selbst, während der Antiquus
auch hierin ganz seinem eigenen Belieben folgt. Das gilt auch für
155, 8, wo die Ligatur der beiden N von ANNUA nicht bloss vom Antiquus,
sondern auch von Tsch. und St. preisgegeben, aber bei Amerbach
richtig dargestellt ist.
Nur in wenigen Fällen zeigt sich Amerbach minder genau. 154, 8 hat
Es kann hienach kein Zweifel sein, dass der Text Amerbachs und der
des Antiquus die gleiche Abschrift wiedergeben. Nur bietet jener vielmehr.
Erstens genaue Notizen über den Fundort, während solche beim Antiquus
gänzlich fehlen. 154 "apud tabernam mensoriam". 155 "in templo iuxta
altare". 161 "Wibelspurg non longe a Murta". "Avantici: In ciuitate".
175 "in templo extra cinitatem". 178 "in foro". 187 ,;in pago Wiler, non
"longe ab Aventico. In introitu templi". 195 "in turri maximis litteris".
Vgl. Tschudi: "an einem Thurn der Stadt mit hohen grossen Buchstaben".
(Für 198 fehlt die Ortsangabe.) 200 "in vestibulo templi non inaugurato,
iam carie absumpta". Diese Angaben weichen von denen der andern Berichterstatter
mehrfach ab. 154 las Tschudi am Eckstein eines Bauernhauses;
zu 155 hat keiner sonst die genauere Angabe "iuxta altare"; "extra
civitatem" zu 175 ist treffend, da die, diese Inschrift bietende alte Martinskirche
ausserhalb des modernen Avenches lag, im Unterschied von der in
Mitte des letztem gelegenen Mariamagdalenenkapelle, wo sich Inschrift 164
befand; 178 las Tschudi an einem Bauernhaus in Münchweiler; 187 las
Tschudi in der Kirche beim Altar.
Zweitens hat Amerbach bei 154, 164, 187, 200 einen Umriss des Steins,
bei 198 den Schnörkel am Ende von Zeile 1 und durchweg genau die Zeilenabteilung
des Originals, während hierin der Antiquus mit grösster Willkür
verfährt. Und während dieser das PATRONO (175, 13) von der Inschrift
auf Seite 113 abtrennt und, ohne etwa durch Raumnot veranlasst zu
sein, seine neue Seite 114 mit diesem Wort beginnt, hat es Amerbach ganz
an richtiger Stelle. Er giebt auch 154, 12 links von L einen starken Zwischenraum,
während beim Antiquus sowie bei Tsch. und St. kein solcher
angegeben ist. (Vgl. Vögelin 11, 88 Anm.).
Drittens bietet Amerbach vielfach richtigere Lesarten: 154, 7 AVENTICENS.
155, 1 AVENTIAE. 175, 4 GERMAN. 175, 11 CONSTANS.
187, 2 L (nicht LV). 187, 4 die richtige Zahl. 198, 1 LIAE (der Antiquus,
Tsch. und St. AELIAE). 198, 5 FILIAE. DULCISSIMAE (der Antiquus
die umgekehrte Wortfolge). Von diesen Abweichungen ist die zu 198, 1
die interessanteste, weil sie zeigt, dass der Antiquus wenigstens einmal von
sich aus ergänzt hat. Vögelins Bemerkung (11, 98), dass die Anfangsbuchstaben
der Inschrift 198 im XVI. Jahrhundert noch vorhanden gewesen
seien, ist nun nicht mehr zu halten.
Viertens stimmt in der Anwendung und Nichtanwendung von Ligaturen
Amerbach fast ausnahmslos mit den Steinen selbst, während der Antiquus
auch hierin ganz seinem eigenen Belieben folgt. Das gilt auch für
155, 8, wo die Ligatur der beiden N von ANNUA nicht bloss vom Antiquus,
sondern auch von Tsch. und St. preisgegeben, aber bei Amerbach
richtig dargestellt ist.
Nur in wenigen Fällen zeigt sich Amerbach minder genau. 154, 8 hat
 er PRIN., der Antiquus PRIMI, beider Original bot gewiss das richtige
PRIM. — 164, 6 hat Amerbach fälschlich D. S. statt D. S. D. — 195 fehlt
bei Amerbach die Umrahmung, die Vögelin 11, 98 aus dem Antiquus mitteilt.
— 200, 3 hat Am. statt CAV durch Conjectur C. AVG.
Amerbach und der Antiquus geben also beide, nur jener viel genauer
und vollständiger, eine bestimmte Abschrift von neun Inschriften von Aventicum
wieder. Aus Amerbach ergiebt sich Glarean als gemeinsamer mittelbarer
oder unmittelbarer Gewährsmann. Und nun wird sofort verständlich,
wie der Antiquus dazu kommt, jenen Inschriften das Epigramm Glareans
auf Aventicum beizufügen.
Freilich wenn Dübi S. 9 Recht hätte mit der Behauptung, dass die
beim Antiquus. vorliegenden Abschriften nicht vor 1536 genommen seien,
so müssten wir von Glareans Urheberschaft absehen, da dieser in seiner
spätem Lebenszeit gewiss nicht mehr nach Avenches gelangt ist. Allein
aus Vögelin 11, 93 ergiebt sich bloss, dass Tschudi bei Redaction der von
ihm 1536 genommenen Abschrift von Nr. 175 den Text des Antiquus zuerst
nicht benutzte, nicht dass er diesen Text damals noch nicht besass. Und
noch viel weniger darf aus Vögelins Beobachtung gefolgert werden, dass
dieser Text damals noch gar nicht existierte.
er PRIN., der Antiquus PRIMI, beider Original bot gewiss das richtige
PRIM. — 164, 6 hat Amerbach fälschlich D. S. statt D. S. D. — 195 fehlt
bei Amerbach die Umrahmung, die Vögelin 11, 98 aus dem Antiquus mitteilt.
— 200, 3 hat Am. statt CAV durch Conjectur C. AVG.
Amerbach und der Antiquus geben also beide, nur jener viel genauer
und vollständiger, eine bestimmte Abschrift von neun Inschriften von Aventicum
wieder. Aus Amerbach ergiebt sich Glarean als gemeinsamer mittelbarer
oder unmittelbarer Gewährsmann. Und nun wird sofort verständlich,
wie der Antiquus dazu kommt, jenen Inschriften das Epigramm Glareans
auf Aventicum beizufügen.
Freilich wenn Dübi S. 9 Recht hätte mit der Behauptung, dass die
beim Antiquus. vorliegenden Abschriften nicht vor 1536 genommen seien,
so müssten wir von Glareans Urheberschaft absehen, da dieser in seiner
spätem Lebenszeit gewiss nicht mehr nach Avenches gelangt ist. Allein
aus Vögelin 11, 93 ergiebt sich bloss, dass Tschudi bei Redaction der von
ihm 1536 genommenen Abschrift von Nr. 175 den Text des Antiquus zuerst
nicht benutzte, nicht dass er diesen Text damals noch nicht besass. Und
noch viel weniger darf aus Vögelins Beobachtung gefolgert werden, dass
dieser Text damals noch gar nicht existierte.
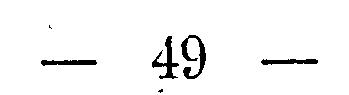 Seiten und Eintragungen seines Sohnes Basilius (S. 372 f., 405 ff.) bis S. 430,
der letzten des Bandes, verfolgen. Die Zeit dieser weitern Einzeichnungen
lässt sich im Ganzen nicht feststellen, ausser dass die selbstgelesene Inschrift
von Vienne auf S. 371 natürlich später geschrieben sein muss als 1520, mit
welchem Jahr Amerbachs Aufenthalt in Südfrankreich beginnt, die Inschriften
von Nimes auf S. 375 ff frühestens 1524, weil den Notizen darüber diese
Jahrzahl vorausgeschickt ist, und die Inschrift aus Altenburg auf S. 384
frühestens 1535, weil Amerbach dieselbe erst in diesem Jahre von Tschudi
erhielt. Autopsie bezeugt Amerbach an folgenden Stellen: S. 860a apud aedes
Divo Alano sacras in sarcophago Maguntiaci haec inveni. — S. 371:
Viennae in Gallia in quadam turri sie legi. —S. 375: MDXXIIII Nemausi
in Gallia Narbonensi haec ipse legi ac collegi; es folgt bis S. 382 eine Reihe
dort abgeschriebener Inschriften, S. 382 eine eben solche aus Avignon. —
S. 384: Spirae in porta civitatis prope montem et templum Sancti Guidonis
hanc inscriptionem legi. — S. 430: Viennae in Gallia nisi fallor legi.
Häufiger noch beruft er sich auf Gewährsmänner. Ausser Thomas
Wolf, der auf S. 325 für alle Inschriften bis S. 324 und dann noch auf
S. 336 und 337 für einzelnes citiert ist, und Glarean (s. Anm. 29) erscheinen
als solche: S. 326 Thomas Aucuparius, der 1532 verstorbene Strassburger
Humanist (Charles Schmidt, Histoire littéraire de l'Alsace 2, 149-154.
407) für eine Anzahl italienische Inschriften; S. 360 Johann Kreher (mir
unbekannt, wenn nicht der mit Erasmus und Rhenanus befreundete Johann
Kierher aus Schlettstadt, Canonicus in Speyer, gemeint ist) für eine Inschrift
aus Mainz; auf derselben S. Beatus Rhenanus ebenfalls für eine
Mainzer Inschrift; S. 360a "Vuilderus" für eine Inschrift aus Baden-Baden
(wenigstens steht dieser Name neben dem Text); S. 861 Zwick für die Konstanzer
Inschrift Nr. 239 Mommsen, womit offenbar derselbe gemeint ist,
der 1522 den Rhenanus bei seinem Besuch in Konstanz herumführte (Vögelin,
Anzeiger 1888, 8). Dazu kommt auf S. 368 über einer Inschrift aus
Worms: Ex munificentia Guilelmi Repshaimer (?) doctiss. pariter et iureconsultiss.
viri, und auf S. 384 unter der Altenburger Inschrift 257 M.: dedit
mihi praeses Badensis (später eingeschaltet Schudi Glareanus) in nundinis
Basiliens. Anno 1535, wodurch der Nachweis Vögelins (Jahrbuch 11, 112 f.),
dass Stumpf diese Inschrift von Tschudi hat, schön bestätigt wird. Bei
manchen Inschriften endlich hat. Amerbach unterlassen. anzugeben, woher
er sie hat. .
Was die von Amerbach mitgeteilten Inschriften selbst betrifft, so muss
ich mich hier auf die der Schweiz angehörigen beschränken.
Die erste derselben ist die Konstanzer Inschrift 239 M. auf S. 361 in
einem von allen bekannten Abschriften, auch derjenigen Hummelbergs von
1523 (Vögelin, Anzeiger 1888, S. 8), abweichenden Texte. Er ist ganz schlecht,
Seiten und Eintragungen seines Sohnes Basilius (S. 372 f., 405 ff.) bis S. 430,
der letzten des Bandes, verfolgen. Die Zeit dieser weitern Einzeichnungen
lässt sich im Ganzen nicht feststellen, ausser dass die selbstgelesene Inschrift
von Vienne auf S. 371 natürlich später geschrieben sein muss als 1520, mit
welchem Jahr Amerbachs Aufenthalt in Südfrankreich beginnt, die Inschriften
von Nimes auf S. 375 ff frühestens 1524, weil den Notizen darüber diese
Jahrzahl vorausgeschickt ist, und die Inschrift aus Altenburg auf S. 384
frühestens 1535, weil Amerbach dieselbe erst in diesem Jahre von Tschudi
erhielt. Autopsie bezeugt Amerbach an folgenden Stellen: S. 860a apud aedes
Divo Alano sacras in sarcophago Maguntiaci haec inveni. — S. 371:
Viennae in Gallia in quadam turri sie legi. —S. 375: MDXXIIII Nemausi
in Gallia Narbonensi haec ipse legi ac collegi; es folgt bis S. 382 eine Reihe
dort abgeschriebener Inschriften, S. 382 eine eben solche aus Avignon. —
S. 384: Spirae in porta civitatis prope montem et templum Sancti Guidonis
hanc inscriptionem legi. — S. 430: Viennae in Gallia nisi fallor legi.
Häufiger noch beruft er sich auf Gewährsmänner. Ausser Thomas
Wolf, der auf S. 325 für alle Inschriften bis S. 324 und dann noch auf
S. 336 und 337 für einzelnes citiert ist, und Glarean (s. Anm. 29) erscheinen
als solche: S. 326 Thomas Aucuparius, der 1532 verstorbene Strassburger
Humanist (Charles Schmidt, Histoire littéraire de l'Alsace 2, 149-154.
407) für eine Anzahl italienische Inschriften; S. 360 Johann Kreher (mir
unbekannt, wenn nicht der mit Erasmus und Rhenanus befreundete Johann
Kierher aus Schlettstadt, Canonicus in Speyer, gemeint ist) für eine Inschrift
aus Mainz; auf derselben S. Beatus Rhenanus ebenfalls für eine
Mainzer Inschrift; S. 360a "Vuilderus" für eine Inschrift aus Baden-Baden
(wenigstens steht dieser Name neben dem Text); S. 861 Zwick für die Konstanzer
Inschrift Nr. 239 Mommsen, womit offenbar derselbe gemeint ist,
der 1522 den Rhenanus bei seinem Besuch in Konstanz herumführte (Vögelin,
Anzeiger 1888, 8). Dazu kommt auf S. 368 über einer Inschrift aus
Worms: Ex munificentia Guilelmi Repshaimer (?) doctiss. pariter et iureconsultiss.
viri, und auf S. 384 unter der Altenburger Inschrift 257 M.: dedit
mihi praeses Badensis (später eingeschaltet Schudi Glareanus) in nundinis
Basiliens. Anno 1535, wodurch der Nachweis Vögelins (Jahrbuch 11, 112 f.),
dass Stumpf diese Inschrift von Tschudi hat, schön bestätigt wird. Bei
manchen Inschriften endlich hat. Amerbach unterlassen. anzugeben, woher
er sie hat. .
Was die von Amerbach mitgeteilten Inschriften selbst betrifft, so muss
ich mich hier auf die der Schweiz angehörigen beschränken.
Die erste derselben ist die Konstanzer Inschrift 239 M. auf S. 361 in
einem von allen bekannten Abschriften, auch derjenigen Hummelbergs von
1523 (Vögelin, Anzeiger 1888, S. 8), abweichenden Texte. Er ist ganz schlecht,
 zeugt aber auch dafür, dass schon im XVI. Jahrhundert das Tschudi'sche
CVR auf dem Steine fehlte. — S. 362 die Zurzacher Inschrift 267 M., mit
scheinbaren Buchstabenresten am Anfang von Z. 3 und 4. — S. 363-367
die Inschriften von Aventicum; siehe Anm. 29; — S. 371 die Wettinger
Inschrift 241 III.; Z. 1 SOIO und Z. 6 II.L sind weniger richtig als die
Stumpf'schen Lesungen SOLO bezw. FIL; das fehlerhafte VIR AQVENSIS
hat Amerbach. mit St. gemein. Aber die Buchstabengrösse und die Ligaturen
des Originals giebt A. viel genauer als die andern Gewährsmänner
des XVI. Jahrhunderts (vgl. Vögelin, Jahrbuch 11, 111). — S. 384 die A.
von Tschudi mitgeteilte Altenburger Inschrift in ungenauer Copie und bemerkenswerter
Weise bereits mit der Tschudi'schen Ergänzung CVR für C
in Zeile 8. — S. 385, Nr. 219 M. ("Salodori neu procul a macello") in
schlechtem Text, doch ohne Punkt hinter CVRA (vgl. Mommsen). — Auf
derselben Seite Nr. 226 M. mit sehr flüchtiger Zeichnung des Sarkophags,
darunter die Worte: in hoc inventa duo corpora sericeo lintheo segregatim
involuta, unius videbat ad orientem, alterius ad occiduam plagam respiciebat.
in eius cranio quod ad ortum conversum, inventa est lamina argentea
cui hic versus insculptus CONDITUR HOC TUMULO SANCTUS THEBAIDUS
(HE in Ligatur!), VRSUS. Links davon die Worte: A° 1519 die
6. aprilis a praetoribus eccles. et urbis aperta sunt. Vgl. Tschudi, Gallia
comata S. 164 f. Vögelin, Jahrbuch 11, 106 f. Der Amerbach'sche Bericht
ist insofern vollständiger als derjenige Tschudi's, als er das Datum der Öffnung
des Sarkophags giebt und die beiden Schädel genauer unterscheidet.
Auch an der Inschrift ist die Ligatur des HE, die Amerbach hat, aber
Tschudi nicht, gewiss dem Original entnommen. Dagegen hat Tschudis
Wortfolge hoc sanctus tumulo schon des leoninischen Reims wegen den Vorzug
vor der als Fehler leicht erklärbaren Amerbachs.
Nach Bonifacius Amerbachs Tode haben andere an dem Bande weiter
gearbeitet. Sein Sohn Basilius teilt S. 372 und 373 mit den einleitenden
Worten sequentia communicavit P. Pithoeus die Inschriften 116, 122, 127,
118, 181 M. mit; seine Abweichungen von der bei M. zu Grunde gelegten
Simler'schen Wiedergabe der Abschriften Pithous sind unwesentlich; Bei
1811 giebt er eine Zeichnung der ganzen Örtlichkeit und äussert Vermutungen
über die rätselhafte Zeile 4.-405 ff. stellt er eine Anzahl Epitaphien
aus der Humanistenzeit zusammen.
Sodann hat ein Gelehrter, wie es scheint des XVIII. Jahrhunderts, zu
der Mehrzahl der von S. 330 an zu lesenden Inschriften die Nummern und
Varianten des Gruter'schen Thesaurus beigefügt.
Zum Schluss fühle ich mich gedrungen, dankend hervorzuheben, dass
Hr. Bibliothekar Dr. Sieber mich auf diesen Band aufmerksam gemacht und
mir manche wertvolle Bemerkung dazu gegeben hat.
zeugt aber auch dafür, dass schon im XVI. Jahrhundert das Tschudi'sche
CVR auf dem Steine fehlte. — S. 362 die Zurzacher Inschrift 267 M., mit
scheinbaren Buchstabenresten am Anfang von Z. 3 und 4. — S. 363-367
die Inschriften von Aventicum; siehe Anm. 29; — S. 371 die Wettinger
Inschrift 241 III.; Z. 1 SOIO und Z. 6 II.L sind weniger richtig als die
Stumpf'schen Lesungen SOLO bezw. FIL; das fehlerhafte VIR AQVENSIS
hat Amerbach. mit St. gemein. Aber die Buchstabengrösse und die Ligaturen
des Originals giebt A. viel genauer als die andern Gewährsmänner
des XVI. Jahrhunderts (vgl. Vögelin, Jahrbuch 11, 111). — S. 384 die A.
von Tschudi mitgeteilte Altenburger Inschrift in ungenauer Copie und bemerkenswerter
Weise bereits mit der Tschudi'schen Ergänzung CVR für C
in Zeile 8. — S. 385, Nr. 219 M. ("Salodori neu procul a macello") in
schlechtem Text, doch ohne Punkt hinter CVRA (vgl. Mommsen). — Auf
derselben Seite Nr. 226 M. mit sehr flüchtiger Zeichnung des Sarkophags,
darunter die Worte: in hoc inventa duo corpora sericeo lintheo segregatim
involuta, unius videbat ad orientem, alterius ad occiduam plagam respiciebat.
in eius cranio quod ad ortum conversum, inventa est lamina argentea
cui hic versus insculptus CONDITUR HOC TUMULO SANCTUS THEBAIDUS
(HE in Ligatur!), VRSUS. Links davon die Worte: A° 1519 die
6. aprilis a praetoribus eccles. et urbis aperta sunt. Vgl. Tschudi, Gallia
comata S. 164 f. Vögelin, Jahrbuch 11, 106 f. Der Amerbach'sche Bericht
ist insofern vollständiger als derjenige Tschudi's, als er das Datum der Öffnung
des Sarkophags giebt und die beiden Schädel genauer unterscheidet.
Auch an der Inschrift ist die Ligatur des HE, die Amerbach hat, aber
Tschudi nicht, gewiss dem Original entnommen. Dagegen hat Tschudis
Wortfolge hoc sanctus tumulo schon des leoninischen Reims wegen den Vorzug
vor der als Fehler leicht erklärbaren Amerbachs.
Nach Bonifacius Amerbachs Tode haben andere an dem Bande weiter
gearbeitet. Sein Sohn Basilius teilt S. 372 und 373 mit den einleitenden
Worten sequentia communicavit P. Pithoeus die Inschriften 116, 122, 127,
118, 181 M. mit; seine Abweichungen von der bei M. zu Grunde gelegten
Simler'schen Wiedergabe der Abschriften Pithous sind unwesentlich; Bei
1811 giebt er eine Zeichnung der ganzen Örtlichkeit und äussert Vermutungen
über die rätselhafte Zeile 4.-405 ff. stellt er eine Anzahl Epitaphien
aus der Humanistenzeit zusammen.
Sodann hat ein Gelehrter, wie es scheint des XVIII. Jahrhunderts, zu
der Mehrzahl der von S. 330 an zu lesenden Inschriften die Nummern und
Varianten des Gruter'schen Thesaurus beigefügt.
Zum Schluss fühle ich mich gedrungen, dankend hervorzuheben, dass
Hr. Bibliothekar Dr. Sieber mich auf diesen Band aufmerksam gemacht und
mir manche wertvolle Bemerkung dazu gegeben hat.
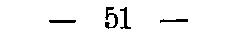


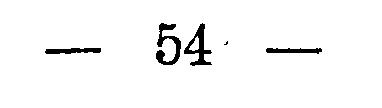 einstige Anwendung desselben in den schweizerischen Landsgemeinden. —
Über das Sitzen und Stehen in den antiken und schweizerischen Landsgemeinden
s. Vischer, Kl. Sehr. 1, 409. —Andere Analogien hat Arnold Hug,
Studien S. 13. 34. 55. 115, angedeutet.
einstige Anwendung desselben in den schweizerischen Landsgemeinden. —
Über das Sitzen und Stehen in den antiken und schweizerischen Landsgemeinden
s. Vischer, Kl. Sehr. 1, 409. —Andere Analogien hat Arnold Hug,
Studien S. 13. 34. 55. 115, angedeutet.






