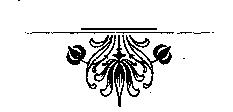Die
Schweizerische Landschaft
einst und jetzt.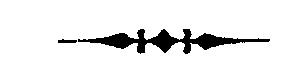
Rektoratsrede
Professor der Geographie an der Universität Bern.
Bern Schmid & Francke 1900.Hochansehnliche Versammlung!
65 Jahre sind dahingegangen, seit unsere Alma mater durch einen hochherzigen Beschluss der Vertreter des Berner Volkes ins Leben gerufen wurde. Wie hat sie sich in diesen Jahren entwickelt! Wie ist sie zu stattlicher Grösse herangewachsen! Klein nur war zuerst das Häuflein derer, die sich hier einführen liessen in die weiten Gebiete der Wissenschaft; heute am Ende des Jahrhunderts ist es deren nahezu ein volles Tausend! Aber auch die Zahl der Lehrenden wie die der vorgetragenen Disciplinen hat sich gemehrt. Gar manche Wissenschaft ist neu entstanden seit jenem Gründungsjahr und hat auch an unserer Hochschule eine Stätte gefunden, unter ihnen als eine der jüngsten die Geographie.
Zwar hat die Geographie schon in früheren Jahrzehnten an unserer Hochschule eine nicht officielle beredte Vertretung gefunden, als Bernhard Studer hier über physikalische Geographie las; ihn, den grossen Geologen, nehmen auch die Geographen als den Ihrigen in Anspruch. Aber ein besonderer Lehrstuhl bestand nicht. Auf dem Verbandstag der schweizerischen geographischen Gesellschaften, der im August 1882 in Genf zusammentrat, war es, dass Theophil Studer die Einführung der Geographie als Unterrichtsfach an den höheren schweizerischen
Lehranstalten und die Gründung entsprechender Lehrstühle au den Universitäten empfahl. Unmittelbar darauf habilitierte sich in Bern Eduard Petri 1 flur Geographie. 1886 wurde auf Antrag des gegenwärtigen Direktors des bernischen Unterrichtswesens, Regierungsrat Dr. Gobat, durch Beförderung von Petri zum ausserordentlichen Professor ein eigener Lehrstuhl der Geographie kreiert und 1891 das Extraordinariat in ein Ordinariat umgewandelt. Es folgte dadurch Bern als erste der schweizerischen Hochschulen den Universitäten des Deutschen Reichs, Frankreichs und Oesterreichs, an denen kurz vorher ordentliche Lehrstühle für Geographie errichtet worden waren. 2
Kein Zufall ist es, dass gerade in jenen Jahren die Geographie an den Universitäten Mitteleuropas akademisch wurde; hatte sich doch gerade damals ein gewaltiger Aufschwung dieser Wissenschaft vollzogen. Er wurde äusserlich gefördert durch die Entwickelung des Handels und Verkehrs zum Welthandel und Weltverkehr, innerlich ganz besonders durch die Annäherung der Geographie an die Naturwissenschaften.
Mächtig befruchtend hatte die Entwicklungslehre auf die naturgeschichtlichen Disciplinen eingewirkt. Zoologie, Botanik, Anatomie hatten einen ungeahnten Inhalt erhalten; die zahllosen Einzelerscheinungen, die bisher unvermittelt nebeneinander standen, gewannen unter den grossen Gesichtspunkten der Entwicklungslehre eine neue Bedeutung und engen Zusammenhang. Die Geologie war schon immer eine historische Wissenschaft gewesen; aber auch hier war erst durch die Entwicklungslehre ein schon vorher angebahnter Umschwung allgemein geworden. an Stelle, der Lehre von den Katastrophen,
die die organischen und anorganischen Erscheinungen der Erde wie mit einem Zauberschlag umwandeln sollten, trat die Lehre von der allmählichen Entwicklung, an Stelle der Revolution die Evolution. Das alles hat auch auf die Entwicklung dei Geographie eingewirkt.
War ihre Aufgabe, wie sie früher mehr oder minder allgemein aufgefasst wurde, —und, muss ich hinzufügen, zum Teil auch heute. noch in aussergeographischen Kreisen aufgefasst wird, — ausschliesslich die Aufzählung und äusserliche Beschreibung der Länder und Meere, der Gebirge und Ebenen, der Seen und Flüsse, der Staaten und Städte, der Bahnen und Wege, so konnte das jetzt nicht mehr genügen. Wie Zoologie und Botanik nicht mehr bei der äussern Beschreibung und Klassifizierung der Lebewesen stehen bleiben, sondern deren Physiologie und Biologie, deren Entwicklungsgeschichte in den Vordergrund ihrer Forschung gerückt haben, so legt auch die moderne Geographie ein Hauptgewicht auf das Erfassen und Darstellen des Zusammenwirkens der verschiedenen geographischen Erscheinungen, auf die Feststellung der Gesetze, die jene regeln. Die Geographie ist heute — nach der Definition F. von Richthofens — die Wissenschaft von der Erdoberfläche in ihrer dreifachen Zusammensetzung aus Atmosphäre, Hydrosphäre und Lithosphäre und den mit ihr in ursächlichem Zusammenhang stehenden Dingen und Erscheinungen. 1 Es gibt eine Physiologie und eine Biologie der geographischen Erscheinungen, es gibt auch eine Entwicklungsgeschichte derselben.
Die geographischen Erscheinungen, wie sie uns heute entgegentreten, sind etwas Gewordenes und noch in Entwickelung und Veränderung Begriffenes; dieses Werden gilt es zu forschen, seinen Gesetzen nachzuspüren. Insbesondere bei
den Erscheinungen der physischen Geographie lässt sich dieses Werden auf einfache Gesetze zurückführen. Viel komplizierter ist das Werden der anthropogeographischen Phänomene, weil hier der Wille des Menschen in Aktion tritt, dessen Bedeutung quantitativ meist schwer abzuschätzen ist. Oft aber spielen beide Momente ineinander: die menschlichen Siedelungen eines Landes, seine wirtschaftlichen Verhältnisse — sie werden auf das allerintimste beeinflusst von der Natur des Landes; diese prägt ihnen geradezu ihren Stempel auf. Andererseits greift der Mensch in die physischen Verhältnisse seiner Umgebung ein und gestaltet sie, wenn auch in beschränktem Masse, nach seinen Zwecken um. Es gibt keine Anthropogeographie ohne genaue Kenntnis der physischen Geographie; aber auch die physische Geographie kann der Anthropogeographie nicht mehr entraten. Letzteres drängt sich uns z. B. auf, wenn wir untersuchen, was für Aenderungen das Landschaftsbild der Schweiz im Laufe der Zeit, da der Mensch hier lebt und wirkt, erfahren hat.
I.
Die schweizerische Landschaft, wie sie mit ihrer Mannigfaltigkeit das Auge des Fremden, wie das des Einheimischen entzückt, ist nicht immer das gewesen, was sie heute ist.
Gehen wir in die entlegene Vergangenheit zurück, die uns durch die Forschungen der Geologie entschleiert worden ist, so sehen wir dort, wo heute Gebirge ragen, in zeitlichem Wechsel bald tiefe Meere, bald weite Landflächen sich dehnen. Die Anlage des heutigen Reliefs, dessen hervorgehender Zug in der Gegenüberstellung von Alpen und Jura und in der Zwischenlagerung des Mittellandes zwischen beide besteht, fällt erst relativ spät, in die jüngere Tertiärzeit. Damals setzten Pressungen und Hebungen ein, die die Gesteine der Erdkruste zu mächtigen Gebirgen emportürmten. Wenig gegliedert waren zuerst diese Erhebungen; erst allmählich wurde
 durch die feine Bildhauerarbeit der Verwitterung und des
rinnenden Wassers jene Formenfülle geschaffen, die wir heute
im Alpengebirge bewundern. Die Thäler entstanden als Werk
der ihr Bett einschneidenden Flüsse, während links und rechte
Gesteinsmassen stehen blieben, abgeböscht vom abfliessenden
Regenwasser — die Bergkämme.
durch die feine Bildhauerarbeit der Verwitterung und des
rinnenden Wassers jene Formenfülle geschaffen, die wir heute
im Alpengebirge bewundern. Die Thäler entstanden als Werk
der ihr Bett einschneidenden Flüsse, während links und rechte
Gesteinsmassen stehen blieben, abgeböscht vom abfliessenden
Regenwasser — die Bergkämme.
Die grossen Züge des Reliefs waren durchaus vorhanden, lange ehe der Mensch, dessen Ueberreste wir in den Höhlen bei Schaffhausen finden, vom Schweizerland Besitz ergriff. Gleichwohl bot die Landschaft kurz vor dem Auftreten des ältesten auf dem Boden der Schweiz bisher entdeckten Menschen ein gang anderes Bild als heute. 1 Es war in der Eiszeit; kälter war das Klima, nicht mehr zwar, als nur etwa 4°C. 2; doch das hatte genügt, um den Schneefall im Gebirge so zu steigern, dass gewaltige Gletscher nicht nur die Thäler der Alpen erfüllten, sondern ihre Zungen noch weit in das Vorland hinaus erstreckten; nahezu das ganze Mittelland war von ihnen eingenommen. Der Rheingletscher hatte den Bodensee ausgefüllt und sich bis über Schaffhausen nach Westen vorgeschoben. Bei Killwangen, zwischen Zürich und Baden, stand das Ende des Linthgletschers, bei Mellingen dasjenige eines Armes des Reussgletschers. Die Moränen in der Umgebung von Bern markieren noch heute das alte Ende des Aaregletschers. Am gewaltigsten waren die Eismassen, die dem Rhonethal entquollen. Nicht nur dass sie den Genfersee erfüllten, sie drangen nach Nordosten bis über Wangen an der Aare hinaus und legten sich bei Bern dicht an den Aaregletscher heran. Eisfrei war nur ein kleiner, Bruchteil des
Mittellandes. 1 Von unsern Seen keine Spur! Sie waren alle unter dem Eis der Gletscher begraben.
Den Gletschern entquollen an ihren Enden mächtige Gletscherbäche, die die Thäler des eisfreien Mittellandes durchströmten, sich mehrfach teilend und die Schuttmassen, die sie vom Gletscher empfingen, in den Thalsohlen aufhaltend, dadurch weite Kiesflächen schaffend. Eine dürftige baumlose Vegetation deckte den Boden, so weit nicht Gletscher und Eismassen ihn in Anspruch nahmen.
Das Schweizerland bot ein landschaftliches Bild, wie heute die Umgebung des Mount Elias in Alaska, wo gewaltige Gletscher sich am Fuss des Gebirges zu einer weiten Eisfläche vereinigen. 2 20-25,000 Jahre liegt nach übereinstimmenden Schätzungen von Th. Steck in Bern, A. Heim in Zürich und J. Nüesch in Schaffhausen der Schluss der Eiszeit, d. h. das Eisfreiwerden des Mittellandes und der tiefen Alpenthäler zurück. 3 5000 Jahre später etwa lebte nach Nüesch der Renntierjäger, dessen Spuren uns im Schweizersbild bei Schaffhausen erhalten sind.
Völlig geändert hat sich seit jener Zeit das Landschaftsbild, nicht sowohl in orographischer, als in hydrographischer und floristischer Hinsicht. Lässt sich diese Aenderung, die feststeht, nicht auch in historischer Zeit verfolgen? Gibt es Mittel und Wege, um ihr messend nachzugehen, zu konstatieren wie rasch oder wie langsam sie sich vollzog? Für
 die prähistorische Zeit ist das freilich ausgeschlossen, desgleichen
für den grössten Teil der historischen; da müssen
wir uns mit der Feststellung der erfolgten Aenderung begnügen.
Für die letzten Jahrhunderte aber vermögen wir
manche Aenderungen an der Hand alter Karten ganz im einzelnen
zu verfolgen; sie sind freilich unbedeutend und klein
im Vergleich zu den grossen seit der Eiszeit erfolgten, darum
aber doch nicht ohne Interesse. Nur wenige Karten sind für
solche Untersuchungen genau genug. In dieser Beziehung
werden es unsere Nachkommen weit besser haben als wir,
wenn sie nach Jahrhunderten ihre Karten mit den unsrigen
vergleichen. Immerhin lässt sich doch auch heute schon auf
Grund einer kritischen Kartenvergleichung manche Aenderung
konstatieren und quantitativ verfolgen; das gilt besonders
für die Nordschweiz, für die wir aus der Mitte des 17. Jahrhunderts
die ausgezeichnete Karte von Hans Conrad Gyger
besitzen; schon durch ihren Massstab, der mit 1 32000 nur
wenig hinter dem Massstab der grössten heutigen Karten
zurückbleibt, noch mehr aber durch ihren Inhalt ragt sie
über andere Karten ihrer Zeit hinaus. 1
die prähistorische Zeit ist das freilich ausgeschlossen, desgleichen
für den grössten Teil der historischen; da müssen
wir uns mit der Feststellung der erfolgten Aenderung begnügen.
Für die letzten Jahrhunderte aber vermögen wir
manche Aenderungen an der Hand alter Karten ganz im einzelnen
zu verfolgen; sie sind freilich unbedeutend und klein
im Vergleich zu den grossen seit der Eiszeit erfolgten, darum
aber doch nicht ohne Interesse. Nur wenige Karten sind für
solche Untersuchungen genau genug. In dieser Beziehung
werden es unsere Nachkommen weit besser haben als wir,
wenn sie nach Jahrhunderten ihre Karten mit den unsrigen
vergleichen. Immerhin lässt sich doch auch heute schon auf
Grund einer kritischen Kartenvergleichung manche Aenderung
konstatieren und quantitativ verfolgen; das gilt besonders
für die Nordschweiz, für die wir aus der Mitte des 17. Jahrhunderts
die ausgezeichnete Karte von Hans Conrad Gyger
besitzen; schon durch ihren Massstab, der mit 1 32000 nur
wenig hinter dem Massstab der grössten heutigen Karten
zurückbleibt, noch mehr aber durch ihren Inhalt ragt sie
über andere Karten ihrer Zeit hinaus. 1
Zur Ergänzung dieser Kartenvergleichung sind Angaben, wie sie z. B. Chroniken geben, heranzuziehen, was noch viel zu wenig geschehen ist; nicht zuletzt hat man durch direkte Beobachtung an Ort und Stelle die aus der Kartenvergleichung gezogenen Schlüsse zu prüfen. Historische und naturwissenschaftliche Methode reichen sich hier die Hand. Gross ist besonders schon das Material, das für unser Jahrhundert vorliegt. Die wiederholten topographischen und Katasteraufnahmen, die Vermessungen aller Art, deren Dokumente teils in den eidgenössischen, teils in den kantonalen Bureaux aufbewahrt werden, sind von unschätzbarem Wert für Fragen, wie sie uns hier beschäftigen.

II.
Untersuchen wir zunächst, ob sich das Landschaftsbild der Schweiz in orographischen Einzelheiten geändert hat. Da entsteht die Frage: Sind die unterirdischen Kräfte erloschen, die einst die Alpen emportürmten, oder wirken sie noch fort? In der That kann es einem Zweifel nicht unterliegen, dass die Erdkruste im Gebiet der Schweiz noch nicht völlig zur Ruhe gekommen ist. Noch finden Bewegungen gewaltiger Massen statt, aber um so geringe Beträge nur, dass wir die letztem bisher nicht messend feststellen konnten. Wir spüren nur die Bewegung selbst den Ruck, der sich in einem Erdbeben äussert. Solcher Erdbeben suchten die Schweiz in den Jahren 1880-98 im ganzen 138 mit 751 Stössen heim; das macht im Durchschnitt jährlich 7,3 Erdbeben mit 39,5 Stössen 1; sie sind uns ein untrügliches Zeichen für die Fortexistenz von Spannungen in der Erdrinde, die sich von Zeit zu Zeit ausgleichen. Dass diese Beben mit Verschiebungen der Erdkruste zusammenhängen, ähnlich denen, die einst im Laufe von vielen Tausenden von Jahren die Alpen und den Jura emportürmten, geht aus ihrer engen Beziehung zu den tektonischen Linien des Schweizerlandes hervor. Aber jede einzelne dei Verschiebungen ist zu klein, als dass wir sie wahrnehmen könnten. 2
In einigen Fällen hat man allerdings geglaubt, direkt horizontale oder vertikale Verschiebungen nachweisen zu können. In den 30er Jahren ist die Schweiz trigonometrisch vermessen worden; die Vermessung wurde in den 60er und 70er Jahren wiederholt. Aus den Differenzen, die sich zeigten, schloss A. Heim, dass der Jura sich in diesen 40 Jahren den Alpen
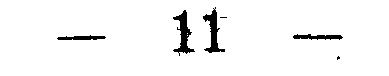 um 1 m genähert habe. Allein eine Kritik der alten Beobachtungen
ergab, dass sie nicht genau genug sind, um so weit
gehende Schlüsse zu gestatten. 1 Nichts destoweniger wird die
von Heim eingeschlagene Methode einst zu Resultaten führen. 2
um 1 m genähert habe. Allein eine Kritik der alten Beobachtungen
ergab, dass sie nicht genau genug sind, um so weit
gehende Schlüsse zu gestatten. 1 Nichts destoweniger wird die
von Heim eingeschlagene Methode einst zu Resultaten führen. 2
Im Jura sind an einigen Stellen eigentümliche Veränderungen der Sichtbarkeit ferner Objekte beobachtet worden. So fand J. Jegerlehner unter der Bevölkerung nördlich von Grandson die Tradition, man habe vor 40-50 Jahren vorn Schlosse von Grandson nur den obersten Teil gesehen, während heute die Türme fast ganz sichtbar sind. Ebenso sei der Genfersee früher von Stellen aus nicht sichtbar gewesen, von denen man ihn heute sehen kann. 3 Aehnliche Angaben macht Girardet aus dem französischen Jura bei Doucier. Danach scheint es, als wenn Bergrücken, die früher das Sehfeld beschränkten, ihre Höhe verändert hätten. Doch wäre es voreilig, aus solchen Indicien sofort auf Krustenbewegungen zu schliessen. Immerhin bieten sie wichtige Fingerzeige, die weiter verfolgt werden.
Ist es so nicht möglich, die Arbeit der dislocierenden Kräfte auf dem Boden der Schweiz messend zu verfolgen, so gelingt das trefflich mit der Arbeit der abtragenden Kräfte. Als die diluvialen Gletscher, die die Thäler der Alpen bis zu 1400 m, ja im Rhonethal bis zu 2000 m Höhe erfreuten, abschmolzen da verloren grosse Felsmassen, die vorher durch das Eis gestützt waren, ihren Halt und stürzten zu Thal. So
 ist im ganzen Alpenland das Ende der Eiszeit von gigantischen
Bergstürzen begleitet. Da stürzten die Schuttmassen ab, die
bei Flims den Rhein stauten, und durch die er sich im Laufe
der Jahrtausende seine enge Schlucht gebahnt hat. 1 Vom
Glärnisch brach ein Bergsturz hernieder, für eine Zeit die Linth
zu. einem See aufdämmend 2, ebenso einer von der Varneralp
im Rhonethal 3; diesem danken die Hügel von Siders ihre
Entstehung. Im Berner Oberland stürzte bei Kandersteg ein
Teil des Fisistocks zur Tiefe, so den Oeschinensee aufdämmend.
Fast bis Frutigen flogen in mächtigem Schwung dem Boden
entlang die Trümmer. 4 Eingebettet in ihnen liegt der idyllische
Blaue See.
ist im ganzen Alpenland das Ende der Eiszeit von gigantischen
Bergstürzen begleitet. Da stürzten die Schuttmassen ab, die
bei Flims den Rhein stauten, und durch die er sich im Laufe
der Jahrtausende seine enge Schlucht gebahnt hat. 1 Vom
Glärnisch brach ein Bergsturz hernieder, für eine Zeit die Linth
zu. einem See aufdämmend 2, ebenso einer von der Varneralp
im Rhonethal 3; diesem danken die Hügel von Siders ihre
Entstehung. Im Berner Oberland stürzte bei Kandersteg ein
Teil des Fisistocks zur Tiefe, so den Oeschinensee aufdämmend.
Fast bis Frutigen flogen in mächtigem Schwung dem Boden
entlang die Trümmer. 4 Eingebettet in ihnen liegt der idyllische
Blaue See.
Zahllos sind auch die Bergstürze, die in historischer Zeit niedergegangen sind, mehrfach Ortschaften unter sieh begrabend und ganze Thaler verschüttend. 1584 stürzte eine Felsmasse mitsamt dem darauf stehenden Ort herab ins Rhonethal und auf Yvorne. 5 Verschüttet wurde 1618 Plurs im BergeIl 6, 1806 Goldau, 1881 EIm u. s. w.
So gross die hier bewegten Massen sind, so verschwinden sie doch gegenüber den Schuttmassen, die durch regelmässigen Absturz und durch Abspülung in den Schutthalden und Schuttdecken der Gehänge ins Thal herabrutschen und durch die
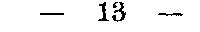 Flüsse aus dem Gebirge herausgeschafft werden, teils als Geschiebe
teils als Sand, teils auch als Schlamm oder im Wasser
gelöst. Dort, wo ein Alpenfluss in einen See mündet, ist er
gezwungen, sein Geschiebe abzulagern, und hier gelingt es,
dessen Menge zu bestimmen. Dr. Th. Steck fand aus den
Anschwemmungen, die die Kander im Thunersee abgelagert
hat, dass zur Bewältigung des Geschiebetransportes der Kander
jedes Jahr mindestens 100,000 Eisenbahnwagen nötig wären.
Aehnlich ist der Betrag, den Heim für die Reuss fand. 1 Und
doch, wenn man diese dem Gebirge entnommenen Massen
gleichmässig auf das Gebiet verteilt, dem sie entnommen
wurden, so ergibt sich nur eine ganz geringe Abtragung.
2203 Jahre sind nötig, um das Einzugsgebiet der Kander um
1 m abzutragen, 3333 Jahre, um das der Reuss und ca. 4000,
um das der Saane und Sense um den gleichen Betrag zu
erniedrigen. 2 So gewaltig die hier bewegten Massen absolut
sind, so klein sind sie im Vergleich zu den mächtigen Massen
des Gebirges. So ist es verständlich, dass sich die Abtragung,
von einigen wenigen Stellen abgesehen, wo grosse Abstürze
in der Höhe und entsprechende Anhäufungen in der Tiefe
stattfanden, im Landschaftsbild innerhalb der Zeiträume, die
wir zu überblicken im stande sind, nicht geäussert hat.
Flüsse aus dem Gebirge herausgeschafft werden, teils als Geschiebe
teils als Sand, teils auch als Schlamm oder im Wasser
gelöst. Dort, wo ein Alpenfluss in einen See mündet, ist er
gezwungen, sein Geschiebe abzulagern, und hier gelingt es,
dessen Menge zu bestimmen. Dr. Th. Steck fand aus den
Anschwemmungen, die die Kander im Thunersee abgelagert
hat, dass zur Bewältigung des Geschiebetransportes der Kander
jedes Jahr mindestens 100,000 Eisenbahnwagen nötig wären.
Aehnlich ist der Betrag, den Heim für die Reuss fand. 1 Und
doch, wenn man diese dem Gebirge entnommenen Massen
gleichmässig auf das Gebiet verteilt, dem sie entnommen
wurden, so ergibt sich nur eine ganz geringe Abtragung.
2203 Jahre sind nötig, um das Einzugsgebiet der Kander um
1 m abzutragen, 3333 Jahre, um das der Reuss und ca. 4000,
um das der Saane und Sense um den gleichen Betrag zu
erniedrigen. 2 So gewaltig die hier bewegten Massen absolut
sind, so klein sind sie im Vergleich zu den mächtigen Massen
des Gebirges. So ist es verständlich, dass sich die Abtragung,
von einigen wenigen Stellen abgesehen, wo grosse Abstürze
in der Höhe und entsprechende Anhäufungen in der Tiefe
stattfanden, im Landschaftsbild innerhalb der Zeiträume, die
wir zu überblicken im stande sind, nicht geäussert hat.
III.
Einen besondern Reiz der Schweizerlandschaft bilden in ihrem Gegensatz zu den grünen Thälern die schneebedeckten Höhen der Firn- und Gletscherregion.
Geschwunden sind die mächtigen Gletscher der Eiszeit, zurückgezogen haben sie sich auf die höchsten Zinnen des Gebirges. Steht so der Rückzug der Gletscher seit der Eiszeit
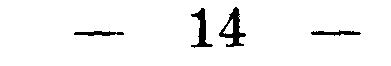 fest, so berichtet uns gleichwohl die im Volk lebende
Tradition, deren Angaben für die Schweiz Gottlieb Studer zusammengestellt
hat 1, nicht von einem Schwinden, sondern
gerade umgekehrt mehrfach von einer Ausdehnung der Gletscher.
In allen Teilen der Alpen stösst man bald in dieser bald in
jener Form auf die Blümlisalpsage. Sie ist eigentlich nichts
anderes als eine Variante der Paradiessage. Zur Strafe für
die Bosheit der Menschen, so berichtet sie, hätte die Gottheit
Schnee- und Eismassen auf blumenreiche Alpweiden hereinbrechen
lassen, und dort, wo einst der Aelpler seinen Reichtum
fand, dehnen sich heute Gletscher. Allein verkehrt wäre es,
diese Traditionen für bare Münze nehmen zu wollen. Zweifellos
liegt ihnen oft etwas Thatsächliches zu Grunde: die Verschüttung
von fruchtbaren Alpwiesen durch Lawinen, die der
Mensch vielleicht selbst durch leichtsinniges Schlagen des
achtenden Waldes geweckt hat. Die Erinnerung an solche
Katstrophen lebte im Volke lange nach und krystallisierte sich,
begünstigt durch die thatsächlich von Zeit zu Zeit auftretenden
Gletschervorstösse, nachträglich zu einer Blümlisalpsage.
fest, so berichtet uns gleichwohl die im Volk lebende
Tradition, deren Angaben für die Schweiz Gottlieb Studer zusammengestellt
hat 1, nicht von einem Schwinden, sondern
gerade umgekehrt mehrfach von einer Ausdehnung der Gletscher.
In allen Teilen der Alpen stösst man bald in dieser bald in
jener Form auf die Blümlisalpsage. Sie ist eigentlich nichts
anderes als eine Variante der Paradiessage. Zur Strafe für
die Bosheit der Menschen, so berichtet sie, hätte die Gottheit
Schnee- und Eismassen auf blumenreiche Alpweiden hereinbrechen
lassen, und dort, wo einst der Aelpler seinen Reichtum
fand, dehnen sich heute Gletscher. Allein verkehrt wäre es,
diese Traditionen für bare Münze nehmen zu wollen. Zweifellos
liegt ihnen oft etwas Thatsächliches zu Grunde: die Verschüttung
von fruchtbaren Alpwiesen durch Lawinen, die der
Mensch vielleicht selbst durch leichtsinniges Schlagen des
achtenden Waldes geweckt hat. Die Erinnerung an solche
Katstrophen lebte im Volke lange nach und krystallisierte sich,
begünstigt durch die thatsächlich von Zeit zu Zeit auftretenden
Gletschervorstösse, nachträglich zu einer Blümlisalpsage.
In manchen Fällen aber knüpfen Angaben über wachsende Ausdehnung der Gletscher an bestimmte Orte und Zeiten an. So soll nach einer seit Altmann (1751) oft wiederholten Nachricht im 16. Jahrhundert ein begangener Gletscherpass aus dem Wallis nach Grindelwald geführt haben. 2 M. Venetz 3, der ausgezeichnete Gletscherkenner, und nach ihm Hugi, G. Studer u. a., haben eine grosse Reihe von andern Pässen, besonders aus dem Wallis, namhaft gemacht,. deren Gangbarkeit sich wesentlich verschlechtert haben soll, so den Col de Fenêtre
 im Bagnethal, den Monte Moro, den Col d'Hérens, den Col de
Collon, den Col de Géant etc. Eduard Richter hat 1891 dargethan,
dass diese Angaben gleichwohl nicht gestatten, auf einen
früher viel kleinem Gletscherstand zu schliessen. 1 Zum Teil
erklären sie sich durch die oscillatorischen Schwankungen der
Gletscher in einer 35jährigen Periode, durch die in 35jährigen
Intervallen die Gangbarkeit besser und schlechter wird, wie
beim Col de Fenêtre. Zum Teil sind sie überhaupt ganz von
der Hand zu weisen; das gilt vor allem vom angeblichen Uebergang
von Grindelwald ins Wallis, der nur über das Mönchsjoch,
heute ein beschwerlicher Gletscherpass, gegangen sein
kann. A. Waeber hat Richters Vermutung glänzend bestätigt. 2
Nach der Tradition sollten über diesen Grindelwaldpass nicht
nur protestantische Walliser zur Trauung nach Grindelwald
gekommen, sondern auch Täuflinge zur Taufe getragen worden
sein. Waeber zeigte nun aus dem Kirchenbuch, dass diese
Walliser Trauungen und Taufen in Grindelwald zum guten
Teil im Winter stattfanden, zu einer Zeit, wo auch die zahmsten
Alpenpässe, wie Gemmi und Grimsel, unpassierbar sind. Es
können sich also jene Angaben des Kirchenbuches nur auf
Taufen und Trauungen von Mitgliedern einer ständigen Walliser-Kolonie
in Grindelwald beziehen. So schrumpft das thatsächliche
Material in ein Nichts zusammen, und wir müssen mit
Richter ganz allgemein aussprechen, dass wir keinen Grund
haben, anzunehmen, die Gletscher der Alpen seien in früheren
Jahrhunderten wesentlich kleiner gewesen als heute. Bei der
Entstehung der Traditionen aber hat fraglos ein Moment lebhaft
mitgewirkt, der Pessimismus, die Unzufriedenheit des
Menschen, der nur zu leicht die Vergangenheit gegenüber der
Gegenwart überschätzt. Jene Zeit angeblich geringer Gletscherausdehnung,
die Hand in Hand mit grösserem Alpreichtum
im Bagnethal, den Monte Moro, den Col d'Hérens, den Col de
Collon, den Col de Géant etc. Eduard Richter hat 1891 dargethan,
dass diese Angaben gleichwohl nicht gestatten, auf einen
früher viel kleinem Gletscherstand zu schliessen. 1 Zum Teil
erklären sie sich durch die oscillatorischen Schwankungen der
Gletscher in einer 35jährigen Periode, durch die in 35jährigen
Intervallen die Gangbarkeit besser und schlechter wird, wie
beim Col de Fenêtre. Zum Teil sind sie überhaupt ganz von
der Hand zu weisen; das gilt vor allem vom angeblichen Uebergang
von Grindelwald ins Wallis, der nur über das Mönchsjoch,
heute ein beschwerlicher Gletscherpass, gegangen sein
kann. A. Waeber hat Richters Vermutung glänzend bestätigt. 2
Nach der Tradition sollten über diesen Grindelwaldpass nicht
nur protestantische Walliser zur Trauung nach Grindelwald
gekommen, sondern auch Täuflinge zur Taufe getragen worden
sein. Waeber zeigte nun aus dem Kirchenbuch, dass diese
Walliser Trauungen und Taufen in Grindelwald zum guten
Teil im Winter stattfanden, zu einer Zeit, wo auch die zahmsten
Alpenpässe, wie Gemmi und Grimsel, unpassierbar sind. Es
können sich also jene Angaben des Kirchenbuches nur auf
Taufen und Trauungen von Mitgliedern einer ständigen Walliser-Kolonie
in Grindelwald beziehen. So schrumpft das thatsächliche
Material in ein Nichts zusammen, und wir müssen mit
Richter ganz allgemein aussprechen, dass wir keinen Grund
haben, anzunehmen, die Gletscher der Alpen seien in früheren
Jahrhunderten wesentlich kleiner gewesen als heute. Bei der
Entstehung der Traditionen aber hat fraglos ein Moment lebhaft
mitgewirkt, der Pessimismus, die Unzufriedenheit des
Menschen, der nur zu leicht die Vergangenheit gegenüber der
Gegenwart überschätzt. Jene Zeit angeblich geringer Gletscherausdehnung,
die Hand in Hand mit grösserem Alpreichtum
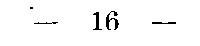 im Gebirge gegangen sein soll, ist nichts anderes als jene
gute alte Zeit, die stets Vergangenheit und niemals Gegenwart
war.
im Gebirge gegangen sein soll, ist nichts anderes als jene
gute alte Zeit, die stets Vergangenheit und niemals Gegenwart
war.
Fehlen so sichere Beweise für eine dauernde Aenderung im Gletscherstand nach einer Richtung, so sind darum die Gletscher doch nicht konstant; es bestehen vielmehr periodische Oscillationen der Gletscher von gewaltigem Betrag, die den 36jährigen Schwankungen des Klimas folgen. 1 Die Jahre um 1815 und ebenso um 1850 waren durch Kalte und Schneereichtum und daher durch einen grossen Gletscherstand ausgezeichnet, die Jahre um 1835 durch Wärme und Trockenheit und einen kleinen Gletscherstand. Seit 1855 ist ein ganz ungewöhnlich starker Schwund der Gletscher eingetreten, der nur bei relativ wenigen Gletscher in der regenreichen Periode von 1880 durch eine kurze Periode des Vorstosses unterbrochen war. 2
Vergleichen. wir das Bild, das uns die Gletscher von heute bieten, mit dem von 1850! Welch ein Unterschied! Die Gletscher sind runzlig und von Moränen schmutzig geworden und haben sich weit zurückgezogen, der Rhonegletscher z. B. 1,3 km, der Untergrindelwaldgletscher 1 km, der Vernagtgletscher in den Oetzthaler Bergen 2,1 km. Sterile Kiesflächen markieren das verlassene Gletscherbett. Das eisfrei gewordene Areal beziffert sich in den Hohen Tauern auf 14 Prozent des ursprünglichen Gletscherareals 3, das ist auf 60 km². Für die Schweiz fehlt zur Zeit noch eine solche Berechnung; doch dürfte mit 200 km² das durch den Rückgang seit 1850 eisfrei gewordene Gebiet nicht überschätzt sein, denken wir an all die
 kleinen Schneefelder, die früher perennierten, jetzt aber geschwunden
sind. Allein dauernd ist diese Veränderung nicht.
Ist es gestattet, aus den vergangenen, Schwankungen der
Gletscher, deren Richter seit 1570 acht nachgewiesen hat, und
des Klimas — seit 1000 25 Schwankungen — für die Zukunft
Schlüsse zu ziehen, so dürfen wir nach ca. 20-25 Jahren einen
neuen Hochstand der Gletscher erwarten. Wie gross dieser
Hochstand werden wird, lässt sich heute freilich um so weniger
voraussagen, als wir alle Ursache haben, anzunehmen, dass
neben den 35jährigen Klimaschwankungen mit diesen interferierend
solche von mehr als 100jähriger Dauer bestehen. 1
kleinen Schneefelder, die früher perennierten, jetzt aber geschwunden
sind. Allein dauernd ist diese Veränderung nicht.
Ist es gestattet, aus den vergangenen, Schwankungen der
Gletscher, deren Richter seit 1570 acht nachgewiesen hat, und
des Klimas — seit 1000 25 Schwankungen — für die Zukunft
Schlüsse zu ziehen, so dürfen wir nach ca. 20-25 Jahren einen
neuen Hochstand der Gletscher erwarten. Wie gross dieser
Hochstand werden wird, lässt sich heute freilich um so weniger
voraussagen, als wir alle Ursache haben, anzunehmen, dass
neben den 35jährigen Klimaschwankungen mit diesen interferierend
solche von mehr als 100jähriger Dauer bestehen. 1
IV.
Durchgreifende Aenderungen im Landschaftsbild der Schweiz haben sich vollzogen und vollziehen sich noch weiter in hydrographischer Beziehung. In der Eiszeit war es, dass die hydrographischen Verhältnisse des Schweizerlandes ihren Stempel erhielten. Ihr verdankt vor allem die Schweiz ihren Reichtum an Seen. Auf mannigfache Weise schufen die Gletscher der Diluvialzeit Seen. Wo sich eine Moräne wallartig vor ein Thal legte, entstand ein Seebecken; bei der unregelmässigen Ablagerung des Schuttes wurden Becken ausgespart. Die grossen Seen der Schweiz aber sind wohl als ein Werk der Gletschererosion zu deuten; sie sind die Enden der Thäler, in denen die Gletscher sich abwärts schoben und die durch die Gletscher bedeutend vertieft wurden. An dieser 1885 von mir für die Seen des Salzachgebietes und der Schweiz ausgesprochenen Ansicht 2 glaube ich auch heute festhalten zu
müssen, obwohl ich dadurch zu manchen Forschern, so besonders zu Heim, in Gegensatz trete.
Da die Seen in Gegensatz der Eiszeit ihre Entstehung verdanken, so sind mit dem Schwinden der Eiszeit auch die seebildenden Faktoren geschwunden; sie sind tot, eine Neubildung von Seen fehlt, von ganz lokalen Erscheinungen abgesehen, wie z. B. der Bildung von Seen durch Bergstürze und durch Schuttkegel. Wohl aber sind die seezerstörenden Kräfte an der Arbeit. Jeder See zeigt das. - - -
Am Schluss der Eiszeit dehnte sich im Aarethal von Meiringen bis unterhalb Thun ein einheitlicher langgestreckter See. Ueberall, wo in ihn grössere, Geschiebe führende Flüsse mündeten, wurde er partiell ausgefüllt; die Aare, im Verein mit Lambach und Schwandenbach, schüttete den obern Teil bis Kienholz zu. Die Lütschine und . der aus dem Habkernthal kommende Lombach warfen ihre Deltas in der Mitte des Sees auf; es entstand das Bödeli das den ursprünglich einheitlichen See zerlegte. Analog füllte die Reuss den Vierwaldstättersee, die Linth den Walensee und Zürichsee, der Rhein den Bodensee, die Rhone den Genfersee von oben her zu. Langer Zeit bedurfte es um die heutigen Verhältnisse herzustellen, zur Aufschüttung des Bödeli z. B. nach einer Schätzung von Th. Steck ca. 20,000 Jahre. 1 Der Prozess geht noch heute fort und hat sich sogar beschleunigt. Seitdem die Berner 1714 die Kander, die früher unterhalb Thun in den Thunersee mündete, in den See eingeleitet haben, hat sie hier gewaltige Geschiebemassen abgesetzt. Wenn die Zuschüttung im gleichen Mass weitergeht, wird nach Verlauf von 1200-1500 Jahren der untere Teil des Thunersees von Einigen abwärts zugeschüttet sein. Die Zuschüttung des Bielersees ist auch nur noch eine Frage der Zeit, seit die Aare 1878 in denselben geleitet wurde. Nach den Messungen des
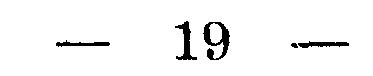 eidgenössischen Oberbauinspektorats 1 sind in den 20 Jahren
1878-98 hier durch die Aare nahezu 9 Millionen m³ Geschiebe,
Sand und Schlamm aufgeschüttet worden. Schon ist
der Boden des Sees zwischen dem südlichen Ufer und der
Petersinsel um etwa zwei Meter aufgefüllt. Nach wenigen
Jahrhunderten wird der Bielersee verschwunden sein mit Ausnahme
desjenigen Zipfels, der durch die Petersinsel geschützt
ist. Längere Zeit wird es brauchen, bis der Walensee zugefüllt
ist. Doch war auch sein Untergang besiegelt, als 1811
Escher von der Linth die Linth in ihn leitete.
eidgenössischen Oberbauinspektorats 1 sind in den 20 Jahren
1878-98 hier durch die Aare nahezu 9 Millionen m³ Geschiebe,
Sand und Schlamm aufgeschüttet worden. Schon ist
der Boden des Sees zwischen dem südlichen Ufer und der
Petersinsel um etwa zwei Meter aufgefüllt. Nach wenigen
Jahrhunderten wird der Bielersee verschwunden sein mit Ausnahme
desjenigen Zipfels, der durch die Petersinsel geschützt
ist. Längere Zeit wird es brauchen, bis der Walensee zugefüllt
ist. Doch war auch sein Untergang besiegelt, als 1811
Escher von der Linth die Linth in ihn leitete.
Nicht nur vom Rande aus durch Geschiebe erfolgt die Zufüllung des Sees; auch weit vom Ufer setzt sich langsam, sehr langsam der Schlamm ab, den Flüsse und Abspülung in den See bringen. A. Heim hat schon vor Jahren versucht, diesen Schlammabsatz zu messen, indem er Kasten in den Vierwaldstättersee versenkte; die Kasten gingen leider verloren. Neue von ihm nach der gleichen Methode im Namen der Flusskommission der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft angestellte Messungen ergaben als Absatz von Schlamm innerhalb eines Jahres im obern Teil des Vierwaldstättersees eine Schicht von 1 1/2 cm Dicke, für den Teil bei Treib sogar 8 cm. Der letztere hohe Betrag erklärt sich zum Teil vielleicht aus Korrektionen an der Muotta die gerade im Beobachtungsjahr eine starke Abspülung hervorriefen. 2 Nehmen wir im Mittel einen Schlammabsatz von 1 cm im Jahr. so ergibt das in 100 Jahren eine Minderung der Seetiefe durch Schlamm um 1 m. Zur Ausfüllung des 200 m tiefen Sees bedürfte es also cirka 20,000 Jahre; berücksichtigt man die Auspressung des Wassers unter hohem Druck, so ist diese
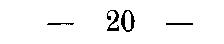 Zahl zu vergrössern. Allein wie klein ist sie auch dann im
Vergleich zur Zahl der Jahre des Bestehens unserer Alpen!
Zahl zu vergrössern. Allein wie klein ist sie auch dann im
Vergleich zur Zahl der Jahre des Bestehens unserer Alpen!
Allein nicht nur verkleinert haben sich zahlreiche Seen in historischer Zeit. Manche sind überhaupt geschwunden. H. Walser hat das in seiner Dissertation an der Hand der früher erwähnten Gygerkarte vom Jahre 1660 nachweisen können. 1 Im Bereich des alten Kantons Zürich gibt diese Karte 149 Seen an; von diesen sucht man 73 allerdings kleine Seen heute vergeblich. An ihrer Stelle finden sich nur Spuren in Form von Sümpfen; oft sind auch diese geschwunden. Ausserdem sind 16 Seen, darunter ein grösserer, in diesen 240 Jahren stark reduziert, 20 fernere etwas reduziert worden. Für eine Reihe Seen konnte Walser die Ursache des Untergangs feststellen; drei sind verwachsen, indem Schwingrasen von den Ufern aus, auch Schilfmassen sie allmählich zufüllten. Fünf sind durch Bäche zugeschüttet worden; bei sechs kombinieren sich beide Vorgänge; elf endlich sind durch Menschenhand trockengelegt. Alle diese Thatsachen zerstreuen jeden Zweifel daran, dass die Seen auf Aussterbeetat gesetzt sind. Dabei zeigt sich, dass die Geschwindigkeit des Aussterbens sich in den letzten anderthalb Jahrhunderten gesteigert hat. Das Eingreifen des Menschen trägt die Schuld daran. "Wiesen-, Streue- und Torfland werden, weit höher gewertet als je zuvor; ihnen wichen zahllose kleine Seen. Um sich vor Ueberschwemmungen der Flüsse durch plötzliche Hochwasser zu schützen, leitete man diese in Seen; dem werden nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden auch die grossen Seen zum Opfer fallen. So kam es, als der Mensch unbewusst zuerst als geologisches Agens an dem Jahrtausende alten Prozess des Schwindens der Seen sich zu beteiligen anfing, zu einer gewaltigen Beschleunigung desselben."
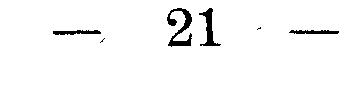
F. A. Forel hat uns gelehrt, verschiedene Altersstufen im Leben eines Sees zu unterscheiden. 1 In der Zeit der Jugend trägt sein Becken durchaus noch die Formen, wie sie der Vorgang, der den See schuf, hervorbrachte. In der Zeit der Reife haben die Absätze von Geschieben, Sand und Schlamm und der Wellenschlag das Becken schon völlig umgestaltet: eine nur ganz schwach sich senkende, in geringer Tiefe befindliche Uferbank, an die sich seewärts ein relativ steiler Abfall zur Tiefe des Sees anschliesst, endlich eine völlig horizontale, durch Schlammabsatz entstandene Sohle sind für dieses Stadium charakteristisch. Die Zufüllung geht weiter, die Uferbank, durch Sand- und Geschiebeansatz vergrössert, rückt immer weiter seewärts vor, wird also immer breiter; dadurch wird der tiefe Teil des Sees immer mehr eingeengt. Zugleich mindert sich hier auch die Tiefe durch Schlammabsatz, die Sohle rückt der Wasseroberfläche näher, bis sie endlich in der Höhe der Uferbank sich befindet. Damit ist das Stadium des Alters erreicht, die Tiefe des Sees ist ganz gering geworden, sie beträgt nur noch einige Meter. Bald wandelt sich der See in einen Weiher und in einen Sumpf, in dem eine üppige Vegetation gedeiht, die ihre Triebe über den Wasserspiegel treibt — der See ist vernichtet. Ueberblicken wir die Seen des Schweizerlandes so treffen wir unter ihnen kaum einen, der noch im Stadium der Jugend wäre; unsere grossen Seen sind alle ausgereift; nicht gering ist dagegen, besonders unter den kleinen Seen; die Zahl der alternden und die der erlöschenden und erloschenen Seen. Kein Zweifel, unsere Seen gehen zu Grunde!
Nicht so einschneidend wie bei den Seen sind die Veränderungen die an Flüssen festzustellen sind. Das hat seinen guten Grund: Seen sind eine accessorische Erscheinung in der Landschaft, die schwinden kann, ohne dass in der Oekonomie
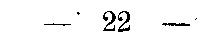 der Natur eine Störung erfolgt. 1 Anders die Flüsse, sie können
nicht versiegen, es sei denn dass die klimatischen Verhältnisse
eine durchgreifende Aenderung erfahren. So lange Regen
und Verdunstung in gleicher Weise auftreten, wie heute, so
lange ist die Existenz der Flüsse gewährleistet. Wir dürfen
daher von vornherein kein Verschwinden des einen oder des
andern Flusses erwarten, sondern nur Aenderungen ihres
Laufes. Solcher Aenderungen sind in der That im Laufe der
Jahrhunderte eine Reihe erfolgt. Wieder ist es der Mensch, der
sie veranlasste. Die Einleitung der Kander in den Thunersee
1714, der Linth in den Walensee 1811, der Aare in den Bielersee
1878 haben wir zum Teil oben erwähnt. Aber auch sonst
sind Aenderungen der Flussläufe zu konstatieren.
der Natur eine Störung erfolgt. 1 Anders die Flüsse, sie können
nicht versiegen, es sei denn dass die klimatischen Verhältnisse
eine durchgreifende Aenderung erfahren. So lange Regen
und Verdunstung in gleicher Weise auftreten, wie heute, so
lange ist die Existenz der Flüsse gewährleistet. Wir dürfen
daher von vornherein kein Verschwinden des einen oder des
andern Flusses erwarten, sondern nur Aenderungen ihres
Laufes. Solcher Aenderungen sind in der That im Laufe der
Jahrhunderte eine Reihe erfolgt. Wieder ist es der Mensch, der
sie veranlasste. Die Einleitung der Kander in den Thunersee
1714, der Linth in den Walensee 1811, der Aare in den Bielersee
1878 haben wir zum Teil oben erwähnt. Aber auch sonst
sind Aenderungen der Flussläufe zu konstatieren.
Wo Flüsse in niedrigem Gelände in flach eingesenktem Bett dahinfliessen, hat man gar oft zu einer Geradelegung gegriffen, um so den Lauf des Flusses zu kürzen, dadurch sein Gefälle zu mehren und ihn zu. einem Einschneiden seines Bettes zu veranlassen. Die Ueberschwemmungsgefahr wird durch den erleichterten Abfluss gemindert. Oft wird dabei ein guter Teil der Korrektionsarbeit vorn Flusse selbst geleistet. Nur ein schmaler Leitungskanal wird ausgehoben, ein Teil des Flusses hineingeleitet und diesem dann die Ausspühlung und Erweiterung des Kanals überlassen. Gerade in unsern Tagen sehen wir eine gewaltige Flusskorrektion und Flussverkürzung dieser Art im Rheinthal oberhalb des Bodensees in Arbeit. Der Rhein hat hier das Thal durch seine Kiesabsätze von Sargans abwärts erhöht. Diese Erhöhung ist in erster Reihe der unmittelbaren Nachbarschaft des Flusses zu gute gekommen, während die an den Seiten des breiten Thales gelegenen Flächen zurückblieben. Sie liegen heute zum guten Teil tiefer als der Spiegel des Rheins, der auf seinen eigenen
 Kiesabsätzen wie auf einem Damme dahinfliesst. Jedes bedeutende
Hochwasser lässt den Fluss austreten und jene Niederungen
unter Wasser setzen. Durch die gemeinsam mit Oesterreich
unternommene Korrektion des Rheinlaufes wird das anders
werden. Zwei grosse Schlingen des Rheins werden abgeschnitten,
dadurch der Rheinlauf um volle 10 km verkürzt. Das verstärkte
Gefäll wird den Fluss befähigen, sein Bett einzuschneiden, und
es wird von selbst eine Tieferlegung desselben im Maximum um
3,6 m und unter das Niveau jener gefährdeten Flachen erfolgen. 1
Welchen Einfluss die Geradelegungen der Orbe und der Broye
auf die Entsumpfung weiter Flächen gehabt, wie die Meliorationen
durch Tieferlegen der Ziehl weiter vollendet worden sind,
darauf begnüge ich mich kurz hinzuweisen.
Kiesabsätzen wie auf einem Damme dahinfliesst. Jedes bedeutende
Hochwasser lässt den Fluss austreten und jene Niederungen
unter Wasser setzen. Durch die gemeinsam mit Oesterreich
unternommene Korrektion des Rheinlaufes wird das anders
werden. Zwei grosse Schlingen des Rheins werden abgeschnitten,
dadurch der Rheinlauf um volle 10 km verkürzt. Das verstärkte
Gefäll wird den Fluss befähigen, sein Bett einzuschneiden, und
es wird von selbst eine Tieferlegung desselben im Maximum um
3,6 m und unter das Niveau jener gefährdeten Flachen erfolgen. 1
Welchen Einfluss die Geradelegungen der Orbe und der Broye
auf die Entsumpfung weiter Flächen gehabt, wie die Meliorationen
durch Tieferlegen der Ziehl weiter vollendet worden sind,
darauf begnüge ich mich kurz hinzuweisen.
V.
Ein Waldland war das heutige Schweizergebiet in prähistorischer Zeit und auch noch zur Zeit der Römer. Ursprünglich waren wohl nur die Sümpfe und Ueberschwemmungsgebiete der Flüsse waldfrei, wenn wir von der Hochgebirgsregion absehen. Hierin hat sich das Landschaftsbild durch das Eingreifen des Menschen völlig geändert: eine gewaltige Rodungsarbeit ist geleistet. Nach der Ansicht von A. Bühler war sie schon im 13. Jahrhundert ziemlich vollendet. Bühler schliesst das daraus, dass damals schon nahezu sämtliche der heutigen grössern Dörfer bestanden. Wenn auch ihre Einwohnerzahl kleiner war als heute, so beanspruchte doch die alte Betriebsform des Landbaus damals bedeutend grössere Summen relativen Areals. Berücksichtigt man das, so kommt man zu dem Resultat, dass im grossen und ganzen schon damals der Wald auf seinen heutigen Umfang beschränkt war. 2

Die hauptsächlichsten Lichtungen fallen nach Bühler in eine Zeit, die 600 Jahre hinter uns zurückliegt. Er schätzt die Rodung seit 1250 auf nur 1 % der gesamten Waldfläche. Dieses Urteil steht nun freilich in direktem Gegensatz zu der sonst ganz allgemein herrschenden Meinung, dass die Entwaldung auch in unserem Jahrhundert noch in den Niederungen so erhebliche, Fortschritte gemacht habe, dass man daraus geradezu eine Aenderung des Klimas ableiten müsse. Man hat sich zu dem Satz verstiegen: Wir entwalden, daher trocknen wir aus. Die Irrigkeit dieser Ansicht hat Walser in seiner schon erwähnten Dissertation an der Hand der Gygerschen Karte für den Kanton Zürich schlagend nachgewiesen. 1 Hier hat die Entwaldung in den letzten 2 1/2 Jahrhunderten nennenswerte Fortschritte nicht gemacht. 1650 war der Kanton Zürich zu 30,7 % seines Areals bewaldet, heute zu 27,85 % Es ergibt sich also eine Entwaldung von nur 2,8 % Der Waldreichthum von 1650 war nicht wesentlich grösser als heute; immerhin ist die Abholzung doch erheblich grösser als Bühler sie schätzt, nämlich nicht 1 % des Waldlandes, sondern 9 % Was vom Kanton Zürich gilt, gilt wohl auch von den andern Kantonen des Mittellandes; das Mittelland wies in Bezug auf seinen Waldbestand. schon 1650 Verhältnisse auf, wie wir sie heute treffen.
Wenn nun auch eine nennenswerte Minderung des Waldbestandes im Mittelland nicht stattgefunden hat, so hat sich doch die Verbreitung des Waldes verschoben. Auf den heute noch funktionierenden Inundationsflächen hat nach Walser der Wald zugenommen, ebenso auf steilen Abhängen. Im Gegensatz sind die Wälder auf den dem Ackerbau und der Wiesenkultur zugänglichen Terrassenflächen bedeutend gelichtet worden. Dabei zeigt sich ein Einfluss der Art der Besiedelung auf den Rückgang des Waldes. Wo die Siedelungen sich in Dörfern
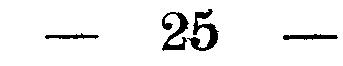 gruppieren, herrscht Gemeindewald vor; dieser hat sich seit
1650 wenig verändert erhalten; zerstreute Siedelungen bedingen
dagegen Privatwaldungen, und diese sind stark parzelliert, ja
zum Teil ganz geschwunden. Im allgemeinen vollzogen sich
die Veränderungen im Waldbestand durchaus im Sinn einer
bessern Anpassung an die Geländeformen.
gruppieren, herrscht Gemeindewald vor; dieser hat sich seit
1650 wenig verändert erhalten; zerstreute Siedelungen bedingen
dagegen Privatwaldungen, und diese sind stark parzelliert, ja
zum Teil ganz geschwunden. Im allgemeinen vollzogen sich
die Veränderungen im Waldbestand durchaus im Sinn einer
bessern Anpassung an die Geländeformen.
Während die angebliche starke Entwaldung in den Niederungen Mitteleuropas als Ursache einer Klimaänderung angesprochen wurde, glaubte man im Hochgebirge einen Rückgang des Waldes, eine Senkung der Baumgrenze beobachten zu können, die man als Folge einer Klimaänderung, einer Erniedrigung der Temperatur deutete. Doch ist hier eine gewisse Zurückhaltung am Platz; denn der Nachweis eines allgemeinen Sinkens stösst auf gewisse Schwierigkeiten.
Dass die Lage der Wald- und Baurngrenze in der Schweiz von Ort zu Ort sehr verschieden ist, ist längst bekannt und z. B. durch Christ ausgesprochen. E. Imhof hat in einer im geographischen Institut der Berner Universität ausgeführten Untersuchung gezeigt, wie ungeheuer diese Schwankungen sind. 1 Nur bis 1560 m reicht im Mittel der Waldwuchs im Gebiete des Säntis; bei 1600-1650 liegt die Waldgrenze am Saum der Alpen der Mittelschweiz. Im Wallis aber erhebt sie sich in den südlichen Seitenthälern bis auf 2300 m, ja lokal bis fast 2400 m, im Engadin auf 2200 m, während sie im nahen Gotthardgebiet und im Tessin im allgemeinen unter 2000 m bleibt und sich meist bei 1900 m hält. Dabei ist sie in hohem Masse abhängig von der Exposition, derart, dass die: Sonnseite der Berge eine etwa 80-100 m höhere Waldgrenze hat als die Schattseite. Ja noch mehr, jeder Grat, jedes Thälchen hat seine eigene Wald- und Baumgrenze. So kommt es, dass die Waldgrenze nur aus grösserer Entfernung betrachtet sich scharf und bestimmt darstellt; in der Nähe machen
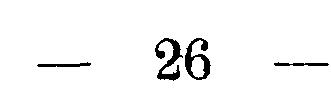 sich zahllose Unregelmässigkeiten geltend, Einbuchtungen nach
unten wie nach oben zeigen sich. Imhof hat daher stets die
mittlere Waldgrenze bestimmt, ausserdem aber auch für jedes
Gebiet die extremen Höhen des Vorkommens des Waldes und
Baumwuchses angegeben. Unter solchen Umständen lassen
sich Angaben über die Höhe der Waldgrenze in früheren
Zeiten nicht wohl zur Feststellung von Aenderungen benutzen,
weil die Identifizierung der Punkte nicht mit ausreichender
Genauigkeit erfolgen kann.
sich zahllose Unregelmässigkeiten geltend, Einbuchtungen nach
unten wie nach oben zeigen sich. Imhof hat daher stets die
mittlere Waldgrenze bestimmt, ausserdem aber auch für jedes
Gebiet die extremen Höhen des Vorkommens des Waldes und
Baumwuchses angegeben. Unter solchen Umständen lassen
sich Angaben über die Höhe der Waldgrenze in früheren
Zeiten nicht wohl zur Feststellung von Aenderungen benutzen,
weil die Identifizierung der Punkte nicht mit ausreichender
Genauigkeit erfolgen kann.
Gleichwohl lässt sich nicht leugnen, dass der Wald an manchen Stellen des Hochgebirges zurückgegangen ist. Ein untrügliches Zeichen hierfür ist das Auftreten von abgestorbenen Bäumen oberhalb der heute an Ort und Stelle bestehenden Wald- und Baumgrenze. Eine Umfrage des eidgenössischen Oberforstinspektorats, die für die Zwecke der Imhofschen Arbeit gemacht wurde, lässt erkennen, wie häufig solche tote Baumstümpfe sind. Sie gehen in der Regel nicht mehr als 100 bis höchstens 150 m über die heutige Waldgrenze und ca. 50-100 rn über die heutige Grenze des Vorkommens einzelner Bäume hinaus. Allein sie als Beweis für eine erfolgte Klimaänderung zu deuten bin ich ebensowenig geneigt, wie vor Jahren Coaz. 1 Zweifellos hat dieser recht, wenn er vor allem dem leichtsinnigen Weidetrieb des Viehes die Schuld an der Vernichtung gerade der höchst gelegenen und daher auch klimatisch am meisten exponierten Bäume gibt. Abstürze von Felstrümmern, Schutthaldenbildung, Lawinen, wie sie im Hochgebirge so häufig sind, haben wohl mitgeholfen. Dass auf eine Klimaänderung nicht geschlossen werden darf, lehren die Erfolge des eidgenössischen Oberforstinspektorats bei Anlage von Wald im Engadin in Höhen etwas über der Waldgrenze, wie sie an Ort und Stelle heute liegt. Bei Pontresina sind am Gehänge der "Schwestern" (Las Sours) Anpflanzungen
 von Arven bis 2300 m angelegt werden. 1 Vom
Menschen geschützt, gedeiht hier der junge Wald zwar langsam
und unter mannigfachen Nachbesserungen, aber er gedeiht
doch, obwohl er der Unbill der Witterung dieser Höhen ausgesetzt
ist. Man plant, die Anpflanzungen versuchsweise bis
2500 m zu treiben und so experimentell die äusserste Höhe
zu bestimmen, in der an Ort und Stelle Wald bei sorgfältigster
Pflege noch zu gedeihen vermag.
von Arven bis 2300 m angelegt werden. 1 Vom
Menschen geschützt, gedeiht hier der junge Wald zwar langsam
und unter mannigfachen Nachbesserungen, aber er gedeiht
doch, obwohl er der Unbill der Witterung dieser Höhen ausgesetzt
ist. Man plant, die Anpflanzungen versuchsweise bis
2500 m zu treiben und so experimentell die äusserste Höhe
zu bestimmen, in der an Ort und Stelle Wald bei sorgfältigster
Pflege noch zu gedeihen vermag.
Viel durchgreifender als dieser durch einzelne abgestorbene Baume angedeutete wohl nur lokale Rückgang des Waldes an seiner obern Grenze ist für das Landschaftsbild des Gebirges das verhängnisvolle Schlagen des Waldes an den Thalgehängen durch den Menschen. Ist der Rodungsprozess im Mittelland seit langem abgeschlossen, so gilt das nicht vom Hochgebirge. Hier ist noch bis in die jüngsten Zeiten gerodet und so dem Lande unsäglicher Schaden zugefügt worden. Nur ein Beispiel: Hoch hinauf bewaldet waren einst die Thalgehänge des Ursernthales bis zu einer Höhe von 1900 m und etwas darüber. Sie sirid völlig kahl geschlagen worden 2, und ähnlich ist es in vielen Gebirgsthälern gegangen. Unser Alpengebirge, das in seinen Thalern einst durchaus ein Waldgebirge war, ist es heute. nicht mehr. Nicht nur eines reizvollen Schmuckes entkleidet hat der Mensch dadurch das Thal; er hat es auch eines mächtigen Schutzes gegen Gefahren beraubt. Erst durch das Abholzen ist die Wildbach- und Lawinenthätigkeit in dem Umfang geweckt worden, dass grosse Gebiete verwüstet und für lange Zeit der Kultur entzogen worden sind. Zwar steht es nicht so schlimm bei uns, wie in den Alpen der Provence und der Dauphiné, aber immer noch schlimm genug.
Wo Wald das Gebirge deckt, da saugt der Waldboden den fallenden Regen wie ein Schwamm auf nun gibt ihn
 langsam weiter an die Flüsse ab. Die Wurzeln der Waldbäume
halten das lockere Erdreich zusammen, das nur äusserst
langsam, dem Zuge der Schwere folgend, das Gehänge abwärts
kriecht, mit einer Geschwindigkeit, die unmessbar klein
ist. Fällt der Wald, so spült der Regen weit heftiger, der
Moosboden wird zerstört; und' das Wasser schneidet ein in die
lockern Schuttmassen, die so oft die Gehänge auskleiden; rasch
werden sie abwärts gefördert, es entsteht ein Riss, eine erste
Wunde nur, die aber weiter frisst. Bei jedem Regenguss wird
Schutt hinab ins Thal geführt . und so das Gehänge seines
Bodens beraubt. Weit schlimmer aber ist, dass diese Schuttmassen
sich ins Thal ergiessen, dasselbe verwüsten und
unfähig für Kultur machen.
langsam weiter an die Flüsse ab. Die Wurzeln der Waldbäume
halten das lockere Erdreich zusammen, das nur äusserst
langsam, dem Zuge der Schwere folgend, das Gehänge abwärts
kriecht, mit einer Geschwindigkeit, die unmessbar klein
ist. Fällt der Wald, so spült der Regen weit heftiger, der
Moosboden wird zerstört; und' das Wasser schneidet ein in die
lockern Schuttmassen, die so oft die Gehänge auskleiden; rasch
werden sie abwärts gefördert, es entsteht ein Riss, eine erste
Wunde nur, die aber weiter frisst. Bei jedem Regenguss wird
Schutt hinab ins Thal geführt . und so das Gehänge seines
Bodens beraubt. Weit schlimmer aber ist, dass diese Schuttmassen
sich ins Thal ergiessen, dasselbe verwüsten und
unfähig für Kultur machen.
Aehnlich wirkt das Schlagen des Waldes auf die Entwicklung der Lawinen. Der Wald heftet den Schnee an den Boden; bricht oberhalb des Waldes eine Lawine los, so fängt der Wald sie auf. Ist der Wald gefallen, so schiesst sie durch nichts gehemmt ins Thal hinab, Zerstörung und Tod mit sich bringend.
Noch immer ist die Bevölkerung sich zu wenig der hohen Bedeutung des Waldes im Gebirge bewusst und lässt sich durch die Aussicht auf einen raschen Gewinn verführen, Wälder zu schlagen, die erhalten bleiben sollten. Das eidgenössische Gesetz betreffend die Oberaufsicht des Bundes über die Forstpolizei. im Hochgebirge vorn Jahre 1878 hat zwar gut gewirkt, doch muss noch mehr erstrebt werden. Es ist daher ein neues Forstgesetz in Vorbereitung, das unter anderm die Oberaufsicht des Bundes auf die Wälder des Jura ausdehnt. Seine Annahme wird für die Wohlfahrt der Gebirgsbevölkerung von höchster Bedeutung sein. 1
Die Wildbäche und Lawinenzüge, die durch den Leichtsinn des Menschen entfesselt worden, gilt es wieder zu bändigen.
 Verbauungen müssen mit grossen Kosten angelegt werden.
Der Bund, der hier den Gemeinden und Privaten zur Seite
steht, ermöglicht Erfolge. Auf 157 Millionen Franken sind
die Kosten der Flusskorrektionen, Wildbachverbauungen, Seeregulierungen
und Entsumpfungsanlagen veranschlagt, deren
Pläne bis zum 1. November 1899 bei der Eidgenossenschaft
eingingen. 1 Der Bund hat zu denselben Beiträge in der Höhe
von 63 1/2 Millionen bewilligt. Etwa ein Fünftel dieser Summen
entfällt allein auf Wildbachverbauungen.
Verbauungen müssen mit grossen Kosten angelegt werden.
Der Bund, der hier den Gemeinden und Privaten zur Seite
steht, ermöglicht Erfolge. Auf 157 Millionen Franken sind
die Kosten der Flusskorrektionen, Wildbachverbauungen, Seeregulierungen
und Entsumpfungsanlagen veranschlagt, deren
Pläne bis zum 1. November 1899 bei der Eidgenossenschaft
eingingen. 1 Der Bund hat zu denselben Beiträge in der Höhe
von 63 1/2 Millionen bewilligt. Etwa ein Fünftel dieser Summen
entfällt allein auf Wildbachverbauungen.
Jedem, der aus dem Gebiet des Deutschen Reiches oder Frankreichs die Schweiz betritt, fällt hier das Ueberwiegen der Wiesen über die Aecker auf, Goldgelb liegt zur Zeit des Hochsommer im Norden Deutschlands die Landschaft dem Beschauer zu Füssen — wogende Getreidefelder, .so weit das Auge reicht; nur an Flüssen und auf steilen Abhängen der Hügel Wiesen. Im Schweizer Mittelland überwiegt in der Landschaft durchaus das Grün der Wiesen. Das war nicht immer so; das starke Vorgehen der Wiesenkultur auf Kosten des Ackerbaues ist vielmehr erst eine Errungenschaft der letzten Jahrzehnte. In frühern Zeiten, da war die Schweiz ein vorwiegend Ackerbau treibendes Land, so weit Boden und Klima es irgend gestatteten. Im XIII. Jahrhundert und später noch war der Ackerbau die Hauptkultur in Gegenden, in denen er seit langer Zeit ganz geschwunden ist. Obwalden z. B. baute damals nicht nur genug Getreide für den eigenen Bedarf, sondern exportierte sogar zu Zeiten von seinem Ueberschuss nach Luzern. 2 Aehnlich stand es in andern Gebirgskantonen, wo heute der Ackerbau fast ganz aufgehört hat. Diese Gebiete waren von Natur weit besser zum Futterbau geeignet; doch
 mussten sie damals Getreide für den eigenen Bedarf bauen,
da die schlechten Kommunikationsverhältnisse einen Import
von Getreide nicht gestatteten. Als die Bevökerung wuchs
und die eigene Produktion doch nicht mehr reichte, da
entschloss man sich zu einer Verbesserung der Wege und
begann, Getreide aus Gegenden einzuführen, in denen es besser
und billiger gewonnen werden konnte, d. h. zunächst aus dem
Mittelland. Ein analoger Prozess hat sich in unsern Jahren
auch im Mittelland vollzogen. Noch in der Mitte der 50er Jahre
deckte hier die eigene Produktion den Getreidebedarf zu einem
guten Teil. Die Einfuhr war des Transportes wegen teuer
und das eingeführte Getreide konnte daher dem einheimischen
keine grosse Konkurrenz machen. Da aber kamen die Eisenbahnbauten,
die in kurzer Zeit die beiden Riesen unter den
Getreideproduzenten der Welt der Schweiz in nächste Nähe
rückten — Russland und die Vereinigten Staaten. So wurde
dem schweizerischen Ackerbau ein schwerer Schlag versetzt,
doch nicht zum Schaden des Landes. Denn Klima und Boden
sind dem Getreidebau auch im Mittelland wenig günstig. Das
Klima ist zu feucht, und Misswachs infolge der feuchten
Witterung sehr häufig; nur die seltenen trockenen Jahre
liefern gute Ernten, gerade umgekehrt wie in Russland und
in den Vereinigten Staaten, wo die Ernte besonders unter Dürre
leidet. Dagegen ist das Klima des Mittellandes der Wiesenkultur
sehr zuträglich. So lange der Bedarf an Getreide nicht
anders gedeckt werden konnte, musste man dem Klima trotzen
und die Missernten mit in Kauf nehmen. Das hörte mit der
Entwicklung des Verkehrs auf: mit ihm kam der Getreideimport.
Nun vermochte der. Schweizer Bauer sich einem dem
Klima besser angepassten und daher lohnendern Zweig der
Landwirtschaft zuzuwenden — der Viehzucht und damit der
Wiesenkultur. Es ging bei uns genau so wie in England, in
Holland, in Schleswig-Holstein, in Westpreussen. Dieser Uebergang
äussert sich scharf in der Landschaft. Während im
mussten sie damals Getreide für den eigenen Bedarf bauen,
da die schlechten Kommunikationsverhältnisse einen Import
von Getreide nicht gestatteten. Als die Bevökerung wuchs
und die eigene Produktion doch nicht mehr reichte, da
entschloss man sich zu einer Verbesserung der Wege und
begann, Getreide aus Gegenden einzuführen, in denen es besser
und billiger gewonnen werden konnte, d. h. zunächst aus dem
Mittelland. Ein analoger Prozess hat sich in unsern Jahren
auch im Mittelland vollzogen. Noch in der Mitte der 50er Jahre
deckte hier die eigene Produktion den Getreidebedarf zu einem
guten Teil. Die Einfuhr war des Transportes wegen teuer
und das eingeführte Getreide konnte daher dem einheimischen
keine grosse Konkurrenz machen. Da aber kamen die Eisenbahnbauten,
die in kurzer Zeit die beiden Riesen unter den
Getreideproduzenten der Welt der Schweiz in nächste Nähe
rückten — Russland und die Vereinigten Staaten. So wurde
dem schweizerischen Ackerbau ein schwerer Schlag versetzt,
doch nicht zum Schaden des Landes. Denn Klima und Boden
sind dem Getreidebau auch im Mittelland wenig günstig. Das
Klima ist zu feucht, und Misswachs infolge der feuchten
Witterung sehr häufig; nur die seltenen trockenen Jahre
liefern gute Ernten, gerade umgekehrt wie in Russland und
in den Vereinigten Staaten, wo die Ernte besonders unter Dürre
leidet. Dagegen ist das Klima des Mittellandes der Wiesenkultur
sehr zuträglich. So lange der Bedarf an Getreide nicht
anders gedeckt werden konnte, musste man dem Klima trotzen
und die Missernten mit in Kauf nehmen. Das hörte mit der
Entwicklung des Verkehrs auf: mit ihm kam der Getreideimport.
Nun vermochte der. Schweizer Bauer sich einem dem
Klima besser angepassten und daher lohnendern Zweig der
Landwirtschaft zuzuwenden — der Viehzucht und damit der
Wiesenkultur. Es ging bei uns genau so wie in England, in
Holland, in Schleswig-Holstein, in Westpreussen. Dieser Uebergang
äussert sich scharf in der Landschaft. Während im
 Deutschen Reich sich das Ackerland zur Wiesenfläche verhält
wie 100 : 45, in Frankreich gar wie 100 : 28, ist das Verhältnis
in der Schweiz 100 : 220, ähnlich wie in England. Die Schweiz
hat also relativ, d. h. auf das Ackerareal bezogen, fünfmal mehr
Wiesen wie Deutschland und achtmal. so viel wie Frankreich.
Dass dieses Verhältnis erst in der letzten Zeit erreicht worden
ist, lehren die Zahlen für den Kanton Zürich. 1775 hatte
Zürich 2 1/2 mal so viel, 1845 noch 1,1 mal so viel Aecker als
Wiesen; 1884 aber doppelt und 1891 schon 2 1/2 mal so viel
Wiesen wie Aecker. 1 Noch schärfer zeigt sich das, wenn wir
die unter Kunstfutter stehenden, also gleichfalls der Viehzucht
dienenden Flächen zu den Wiesen schlagen. Dieser Prozess
des Rückganges des Ackerbaues ist noch nicht zu Ende; noch
vollzieht er sich weiter, und immer mehr und mehr treten die
Aecker in der schweizerischen Landschaft zurück.
Deutschen Reich sich das Ackerland zur Wiesenfläche verhält
wie 100 : 45, in Frankreich gar wie 100 : 28, ist das Verhältnis
in der Schweiz 100 : 220, ähnlich wie in England. Die Schweiz
hat also relativ, d. h. auf das Ackerareal bezogen, fünfmal mehr
Wiesen wie Deutschland und achtmal. so viel wie Frankreich.
Dass dieses Verhältnis erst in der letzten Zeit erreicht worden
ist, lehren die Zahlen für den Kanton Zürich. 1775 hatte
Zürich 2 1/2 mal so viel, 1845 noch 1,1 mal so viel Aecker als
Wiesen; 1884 aber doppelt und 1891 schon 2 1/2 mal so viel
Wiesen wie Aecker. 1 Noch schärfer zeigt sich das, wenn wir
die unter Kunstfutter stehenden, also gleichfalls der Viehzucht
dienenden Flächen zu den Wiesen schlagen. Dieser Prozess
des Rückganges des Ackerbaues ist noch nicht zu Ende; noch
vollzieht er sich weiter, und immer mehr und mehr treten die
Aecker in der schweizerischen Landschaft zurück.
Doch eilen wir zum Schluss.
Schier unvergänglich stehen unsere Bergriesen da. Zwar nagt an ihnen die Abtragung, aber verschwindend sind ihre Wirkungen in der kurzen Zeit, über die die Geschichte des Menschen sich erstreckt. So bleiben die grossen Züge der Landschaft unverändert; die kleinen aber, die das Einzelkolorit bestimmen, zeigen mannigfachen Wandel. Seen sind geschwunden, .Flüsse abgelenkt, Wälder gefällt, Aecker an ihre Stelle getreten, die dann selbst wieder Wiesen weichen mussten. Nicht Naturkräfte sind es, die hier blind walten, sondern der Geist des Menschen, der seinen Wohnsitz umgestaltet. Es gilt das Land kulturfähige zu machen und dabei die Kultur möglichst der Natur anzupassen, sie zugleich zu schützen. Es ist der Kampf ums Dasein, der diese Veränderungen verursacht. Gerade im Schweizerland ist dieser Kampf
 besonders schwer; denn rauh ist das Klima, unwirtlich und
gefährdet der Boden auf weiten Strecken. Nur bei höchster
Anspannung aller. Kräfte gibt er Ertrag. Aber gerade das
ist ein Impuls zu einigem Zusammenhalten, zu immer erneuter
Kraftäusserung, zu Zähigkeit und Ausdauer, zu Energie.
Wer rastet, der rostet. Zum Rasten aber ist das Schweizerland
nicht geschaffen; seinem Lande verdankt der Schweizer
ein gut Teil seiner besten Eigenschaften.
besonders schwer; denn rauh ist das Klima, unwirtlich und
gefährdet der Boden auf weiten Strecken. Nur bei höchster
Anspannung aller. Kräfte gibt er Ertrag. Aber gerade das
ist ein Impuls zu einigem Zusammenhalten, zu immer erneuter
Kraftäusserung, zu Zähigkeit und Ausdauer, zu Energie.
Wer rastet, der rostet. Zum Rasten aber ist das Schweizerland
nicht geschaffen; seinem Lande verdankt der Schweizer
ein gut Teil seiner besten Eigenschaften.