Universität und Musikwissenschaft
REDE
ZUR FEIERLICHEN ERÖFFNUNG DES STUDIENJAHRES VON
REKTOR DER UNIVERSITÄT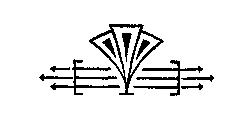
FREIBURG (SCHWEIZ) ST. PAULUS-DRUCKEREI 1921
Universität und Musikwissenschaft.
Es ist wohl das erste Mal in der neueren Universitätsgeschichte, daß ein Professor der Musikwissenschaft eine Rektoratsrede zu halten hat. Obschon eines der jüngsten Lehrfächer in der heutigen Universitas literarum, besitzt sie ein Heim an vielen Hochschulen nicht nur des deutschen Sprachgebietes. Auch Frankreich hat neuerdings musikwissenschaftliche Vorlesungen in den Lehrplan seiner Universität aufgenommen und dabei das ästhetische wie das geschichtliche Fach in gleicher Weise berücksichtigt. Auf dem letzten Kongresse der internationalen Musikgesellschaft zu Paris im Juni 1914 stellte der Sprecher des Unterrichtsministeriums weitere Förderung dieser Bestrebungen in Aussicht. Am Pariser Institut Catholique hielt vor dem Kriege ein dem Laienstande angehöriger Gelehrter Vorlesungen und Übungen über Kirchenmusik; In England hat die Musik ihren angestammten Platz in der Facultas artium liberalium niemals ganz verloren. Schon im 15. Jahrhundert, seit 1463, lassen sich daselbst Graduierte in der Musik nachweisen als Baccalaurei und Doctores 1; allerdings hat es damals ein Studium von vielen Jahren gebraucht, um zum Doctor der Musik zu gelangen. So gibt es Professoren der Musik seit alter Zeit in Oxford 2 und Cambridge; neuerer Einrichtung sind die Professuren in London, Leeds, Dublin 1
 und Edinburgh. Die englischen Universitäten kennen als
Krönung des akademischen Musikstudiums den Grad und
Titel des Doctor of Music noch heute, während auf
dem Kontinente dafür der Dr. phil. vorgesehen ist. Eine
Professur, die vorzugsweise den kirchenmusikalisch-praktischen
Bedarf decken soll, wurde vor einigen Jahren auch
an der irischen katholischen Universität eingerichtet; ihr
erster Inhaber war ein Deutscher. Selbst amerikanische
Universitäten haben neuerdings Professoren für Musikwissenschaft.
1 So hat sich. diese an einer stattlichen Anzahl
von Hochschulen eingebürgert und erfreut sich der Sympathien
ihrer älteren Schwestern. Nicht bestimmter könnte
diese Anerkennung ausgesprochen werden, als durch die
Berufung ihres Vertreters zum höchsten Ehrenamte, das
die Universität zu vergeben hat. Daß es so gekommen ist,
wird als nachdrückliche Bestätigung ihrer Daseinsberechtigung
im Kreise der akademischen Lehrfächer weithin vermerkt
werden, und dafür sei den verehrten Herren Kollegen,
deren Vertrauen mich zu diesem Amte berief, und der hohen
Regierung, welche die Wahl guthieß, Dank gesagt.
und Edinburgh. Die englischen Universitäten kennen als
Krönung des akademischen Musikstudiums den Grad und
Titel des Doctor of Music noch heute, während auf
dem Kontinente dafür der Dr. phil. vorgesehen ist. Eine
Professur, die vorzugsweise den kirchenmusikalisch-praktischen
Bedarf decken soll, wurde vor einigen Jahren auch
an der irischen katholischen Universität eingerichtet; ihr
erster Inhaber war ein Deutscher. Selbst amerikanische
Universitäten haben neuerdings Professoren für Musikwissenschaft.
1 So hat sich. diese an einer stattlichen Anzahl
von Hochschulen eingebürgert und erfreut sich der Sympathien
ihrer älteren Schwestern. Nicht bestimmter könnte
diese Anerkennung ausgesprochen werden, als durch die
Berufung ihres Vertreters zum höchsten Ehrenamte, das
die Universität zu vergeben hat. Daß es so gekommen ist,
wird als nachdrückliche Bestätigung ihrer Daseinsberechtigung
im Kreise der akademischen Lehrfächer weithin vermerkt
werden, und dafür sei den verehrten Herren Kollegen,
deren Vertrauen mich zu diesem Amte berief, und der hohen
Regierung, welche die Wahl guthieß, Dank gesagt.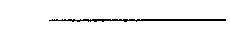
Schwierigkeiten sind der neuem Musikwissenschaft auf ihrem emporstrebenden Wege nicht erspart geblieben. Ich will nicht davon reden, daß schon der Begriff der Musikwissenschaft manchen nur ausübenden Musikern etwas Unfaßbares ist, und daß der Wirksamkeit ihrer Jünger nicht selten die Gleichgiltigkeit und die Abneigung solcher entgegenstehen, die der Fühlung mit ihr am meisten bedürften. Solche Verhältnisse zu ändern, liegt nicht in unserer Macht; wir müssen sie ertragen. Die Musikwissenschaft hatte auch Hindernisse zu überwinden, die in ihr selbst lagen. Eine Zeit lang war sie über ihr Arbeitsverfahren unschlüssig. In ihren ersten Jahren hielt sie sich für einen Nebenzweig der Sprach- und Altertumswissenschaften. Damals stand zumal die Musik des klassischen Altertums und des Mittelalters in der ersten Reihe der gelehrten Arbeit; ihre Quellen aber sind vornehmlich theoretische Schriften in griechischer und lateinischer Sprache, und das macht die Neigung zur philologischen Methode verständlich, wie sie sich seit der Renaissance herausgebildet hatte. Später begab sie sich in die Gefolgschaft der Historie und ihres Untersuchungsverfahrens. Darauf führte von selbst die Bezugnahme der musikgeschichtlichen Forschung auf die allgemeine Welt- und Kulturgeschichte seit ihrer Hinwendung zur neuem Musik. 1 Erst in unseren Tagen hat die Wissenschaft von der Musik eine ihr eigentümliche Art des Vorgehens gefunden, die, wenn schon auf der philologischen und historischen
I.
Arbeitsweise fussend, ihrem besonderen Stoffe angemessener erscheint. So lassen sich Fragen des formalen Baues und des Stiles der Kunstwerke, sowie der stilistischen Abhängigkeit eines Künstlers von andern nur mit eigenen Mitteln lösen, die sich nach. dem Untersuchungsgegenstand zu richten haben. Die Wandlung der Form der Missa um 1500, der Sonate um 1750, der Oper um 1850, können nur durch technische Analysen von musikalischer Eigenart erfaßt und zur Darstellung gebracht werden. Daher rückt die Musikforschung der Gegenwart stilgeschichtliche Fragen in den Vordergrund. 1 Auch wendet sie sich den wichtigen entwicklungsgeschichtlichen Tatsachen zu, die das Studium der außereuropäischen Musikkulturen enthüllt.
Wenn so die heutige Musikforschung vornehmlich nach der Seite der Geschichte gerichtet ist, so läßt sich das schon aus der Natur der Musik und ihrer Gewalt über das innere Leben des Menschen rechtfertigen. Keine der geistigen Betätigungen nimmt unsere Phantasie und unser Gemüt so leicht gefangen, wie die Musik. Das Übermaß ihrer Pflege vermag das Gleichgewicht der seelischen Fähigkeiten zu stören und führt dann gern zu unruhigem, unausgeglichenem Wesen, zu unklarer Schwärmerei, jedenfalls zum Vorrang des nur Gefühls- vor dem Verstandesmäßigen im Denken, Urteilen, vor allem aber im künstlerischen Genießen. Den sich daraus leicht ergebenden Gefahren wird begegnet durch Aneignung einer allgemeinen Bildung, die sich von den andern Fragen des geistigen Lebens nicht absondert, durch starken Einsatz der Verstandestätigkeit, und diese knüpft am einfachsten an feste, unverrückbare, der Einwirkung des subjektiven Geschmackes oder psychischer Besonderheiten entzogene Tatsachen an. Solche aber bietet die Geschichte der musikalischen Kunst, und die Beschäftigung mit ihr wird damit zu einer heilsamen 1
Selbstzucht, zu einem Stahlbad, und öffnet den Weg zu gesunden, sachlichen Erkenntnissen und Schätzungen. 1
Dazu kommt ein anderes: Viele Fragen der gegenwärtigen Kunst sind in ihrer Vergangenheit verankert, dort bereits aufgeworfen, und haben von den Voraussetzungen der damaligen Übung aus auch eine Lösung gefunden. Nun ist es die Aufgabe der Musikhistorie, die Kunstpflege jeder Zeit aus ihren Voraussetzungen zu begreifen. Sie schafft damit eine feste Grundlage für eine wissenschaftliche, freie Durchdringung und Wertung auch der gegenwärtigen Zustände. Wir spielen uns zu Hause eine Sonate oder nur ein Rondo, hören im Konzert eine Sinfonie, ein Quartett oder Trio, im Theater eine Oper, reden von Dur und Moll, von piano und forte, und werden damit vor die Tatsache gestellt, daß fast alle musikalischen Fachausdrücke der italienischen Sprache entstammen; sie hat ihren Grund in der musikalischen Weltherrschaft der Italiener im 17. und 18. Jahrhundert. In der Kunst der Gegenwart wirken zahllose Kräfte und Ideen aus vergangener Zeit weiter, und auch für die Musik gilt, daß, wer die Gegenwart erfassen will, ihre Zusammenhänge mit der Vergangenheit nicht übersehen darf. So ist es klar, daß die geschichtliche Betrachtung in zahlreichen Fragen der Kunst mehr als jede andere 2 zu einem reifen Urteil befähigt. Nur wer der Musikwissenschaft ferne steht, kann in der Beschäftigung mit der Geschichte der Kunst lediglich einen archäologischen Kram erblicken. Wir betonen. es zudem immer wieder und erhärten es in Vorlesungen und seminaristischen Übungen, daß geschichtliche
Studien in der Musik der gegenwärtigen Kunst zugute kommen, indem sie deren Wurzeln bloßlegen, ihr Wachstum erklären, aber auch in ihren Inhalt und Wert einführen; sie dienen der musikalischen Bildung im allgemeinen, vertiefen und erweitern den künstlerischen Gesichtskreis und helfen der Musik diejenige Schätzung wiedergewinnen, die sie ehemals besaß, als ein allgemein anerkannter, von allen Gebildeten gewürdigter Bestandteil der Kultur. In Sachen der bildenden Künste steht die Bedeutung geschichtlichen Wissens längst außer Zweifel. Niemand wird da ein entscheidendes Urteil ohne die Ausrüstung wagen, welche der Verkehr mit den Meisterwerken ihrer Vergangenheit vermittelt.
Gerade so wie die. Fragen des Geisteslebens und der Weltanschauung eine gründliche, am Denken der Vorzeit genährte philosophische Durchbildung erheischen, so ziehen es ernste Freunde der Musik vor, die Probleme ihrer Kunst an den Erfahrungen der Vergangenheit zu messen und zu klären, wenigstens die neueren Errungenschaften zu ihnen in Beziehung zu setzen. Man darf den Vergleich trotz aller Verschiedenheit der beiderseitigen Verhältnisse weiterführen: Wie der besonnene und erfahrene Denker sich nicht gleich einem jeden neuen Gedankensysteme unterwirft, sondern es nach seiner philosophischen und religiösen, sittlichen und sozialen Tragweite ausfragt, und wie es ein Vorzug der christlichen Philosophie ist, daß ihre Leitsätze in mehrhundertjähriger gedanklicher Zergliederung und Fortspinnung die Prüfung bis in ihre letzten logischen Folgerungen bestanden haben, so ergibt das Studium der musikgeschichtlichen Tatsachen eine Summe von Einsichten und Erkenntnissen, deren Wert. weit über die Zeit hinaus reicht, die sie geprägt haben, und die auch in einer Periode künstlerischer Umwälzungen oder Neubildungen, wie wir sie heute erleben, willkommen sein muß. Die geschichtliche Einstellung musikalischer Betrachtung trägt so die Gewähr für eine ruhige und unvoreingenommene Beurteilung wichtiger Angelegenheiten auch der Gegenwart. Die Geltendmachung und Verfolgung
solcher Ziele war es auch vornehmlich, die der Musikwissenschaft den Zugang zur akademischen Lehrkanzel neuerdings erleichtert hat.
Im Übrigen brauche ich den Nutzen eines akademischen Musikunterrichtes vor dieser Versammlung wohl nicht darzulegen. Für die Theologen insbesondere hat die Kirche immer eine ausreichende gesangliche Ausbildung gefordert; noch Pius X. hochseligen Andenkens betonte die Notwendigkeit ihrer Unterweisung auch in den Grundsätzen der kirchlichen Tonkunst mehrmals, am nachdrücklichsten in § 26 seines Motu proprio vom 22. November 1903, wo er den Wunsch ausspricht, daß auch in den Vorlesungen über Liturgie, Moral und Kirchenrecht für die Theologiestudierenden die Prinzipien und wichtigsten Gesetze der Kirchenmusik zur Sprache kommen sollten, damit die Kleriker auch in diesen für die geistliche Bildung notwendigen Dingen einigermaßen Bescheid wüßten. 1 Erleuchtete Hirten traten in die
Fußstapfen des Papstes. So hat das gegenwärtige Oberhaupt
der Diözese St. Gallen bereits vor Jahren seinen Theologen
den Besuch der kirchengesanglichen Übungen an unserer
Alma Mater zur Pflicht gemacht. Daß aber das musikalische
Lehramt an der Universität am zweckmäßigsten von einer
eigenen Lehrkanzel aus versehen wird, ist zweifellos, sobald
die Möglichkeit auch eines wissenschaftlichen Betriebes des
Faches vorliegt, eines solchen, der über das rein Technische
und Praktische hinausgeht. Jedenfalls kann hier in Freiburg,
wo die Theologen wohl immer die Großzahl der Studierenden
bilden werden, ein Lehrstuhl, der zu einem guten Teile der
Kirchenmusik gewidmet ist, sich auf die Forderung Pius' X.
berufen. Solche Erwägungen haben auch die hohe Regierung
des Kantons Freiburg veranlaßt, dem musikwissenschaftlichen
Unterricht an der Universität von Anfang an wirksame
und verständnisvolle Förderung zukommen zu lassen.
Freiburg errichtete ein Ordinariat für Musikwissenschaft zu
einer Zeit, als ein solches nur an wenigen Hochschulen, wie
Berlin, Wien und München etatsmäßig vorhanden war.
Darum sei warmer Dank auch von dieser Stelle aus dem
Manne dargebracht, in dem die Universität ihren Gründer
und das Freiburger Volk die Verkörperung des Wahlspruches
verehrt: «Patriae inserviendo consumor», Herrn
Staatsrat Dr. Python.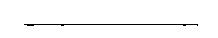

II.
Wie ich andeutete, kann die Musikwissenschaft ein geschichtliches Recht auf einen Platz in der Universität geltend machen. Die Professuren der Musikwissenschaft an der Universität sind so alt wie die Universität selbst.
Nach den großen Denkern des Griechentums gehört die Musik als Lehrgegenstand in das Gebäude eines wohlgeordneten Staatswesens. Der Staat hat die Aufgabe, die Ausübung dieser Kunst zu überwachen, auch gegen ihre Auswüchse einzuschreiten. Das hat namentlich Plato mehrmals und scharf betont. 1 Der lateinische Philosoph Boethius vermittelte diese Auffassung der spätem Zeit (de Institutione musica I, I). Aus ihr heraus erklärt sich die Aufnahme der Musik in den Kreis des gelehrten Unterrichtes bereits seit Marcus Terentius Varro 2, dem Freunde Ciceros, im 1. Jahrhundert vor Christus. Lange vor der Gründung der ersten Universitas magistrorum et scholarium in Paris am Ende des 12. Jahrhunderts war die Musik als eine der sieben Artes liberales pflichtmäßiges Fach des wissenschaftlichen Studiums. Mit der Arithmetik, Geometrie und Astronomie gehörte sie zum Quadrivium, bildete also einen Teil der mathematischen Wissenschaften 3, und es gab wenige 1
Gebildete, die nicht der Musik obgelegen hätten. Diese Zeiten sind nun längst vorüber, und bei den weitausgreifenden Umgestaltungen, die der höhere Lehrbetrieb seither erfuhr, werden sie sich auch nicht wieder erneuern. Es ist aber gut sich gelegentlich vorzuhalten, was die Musik in der geistigen Arbeit der alten Zeit bedeutet hat. Die Verbreitung tieferer Erkenntnis in musikalischen Dingen war eine der Aufgaben des gelehrten Unterrichts im ganzen Mittelalter.
Als Facultas artium lebten die freien Künste in der Universität weiter und bildeten die Grundlage aller fachmännischen Unterweisung in der Theologie, Jurisprudenz und Medizin. Darum wird die Facultas artium oder wie sie später hieß, die philosophische Fakultät, in den Urkunden der alten Universitäten «Pia caeterarum facultatum nutrix» genannt oder sogar «Alma totius Universitatis mater» 1. In ihr war die Scientia musices überall, in Paris, Oxford, in Salamanca, Neapel, Bologna, Pavia, wie auch in Deutschland durch hervorragende Männer vertreten. Dabei spiegelt sich von Anfang an in der Musikgelehrsamkeit die Wellenbewegung des geistigen Lebens wieder; so wird es verständlich, daß z. B. der Dominikaner Hieronymus von
Mähren, ein Zeitgenosse des hl. Thomas von Aquin, im Pariser Kloster des hl. Jacobus, in sein großes kompilatorisches Werk de Musica ein ganzes Kapitel aus einer Schrift des arabischen Philosophen Alfarabi übernahm, 1 ebenso Vincent von Beauvais (U 1264) in sein Speculum doctrinale, lib. 17, die Definition der Musik (cap. 1) und ihre Einteilung in Musica activa und speculativa secundum Alfarabium (cap. 6). Ein angesehener Lehrer der Musik an der Universität Paris um dieselbe Zeit war der Engländer Johannes de Garlandia, der eine Zeitlang auch an der neuen Universität Toulouse lehrte. Auch an der Universität Oxford stand die Musik in Ansehen. Der Franziskaner Robert Grosseteste 2, der dort dozierte, hat sie in seiner Schrift De artibus liberalibus behandelt. Sein und des Johannes de Garlandia Schüler, der Franziskaner Roger Bacon, der große Naturforscher, widmete der Musik längere Darlegungen in seinem Opus majus und im Opus tertium 3. Für ihn ist sie
ein wichtiger Bestandteil des theologischen Studiums. In diese Reihe gehört auch sein Ordensbruder, Julian von Speier, der am Pariser Studium generale der Minoriten die Musik lehrte, nachdem er als hochangesehener Praefectus der Hofkapelle daselbst gewirkt hatte. 1.
Als der erste große akademische Musikprofessor muß jedoch Johannes de Muris gelten, der in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts an der Sorbonne gelehrt hat. Sein Hauptwerk, das Speculum musices in sieben Büchern, von denen bisher nur die beiden letzten veröffentlicht sind, legt in einer durch logische Schärfe und Klarheit, wie durch stete Rücksichtnahme auf die Lehren und Auffassungen der antiken und mittelalterlichen Musikschriftsteller hervorragenden Darstellung das ganze Wissen seiner Zeit vor, eine leibhaftige Musikenzyklopädie des 14. Jahrhunderts, und mehr als das, das bedeutendste und umfangreichste musikliterarische Denkmal des gesamten Mittelalters, würdig seiner Zeitgenossen, der großen philosophischen und theologischen Summen. 2 Auch eine Summa musicae stammt aus seiner Feder. Ihr letztes (25) Kapitel (Integumentum musicae) liefert einen anschaulichen Beleg dafür, bis zu welchem Grade theologische Gedanken damals den ganzen Umfang des menschlichen Wissens erfüllt haben. Hier daraus einige Sätze: «Teste philosophe (gemeint ist natürlich Aristoteles) simile congaudet suo simili et aspernatur contrarium.... Musica etenim, ut tropologice loquamur, Ecclesiae similis esse videtur.... Musica scientia est una, quamvis in diversis
partibus sit fundata; sicut et cum Ecclesiae multa sint membra, Ecclesia tarnen una est, in unitate fidei catholicae radicata .... In musica binarius (sc. numerus) reperitur, in quantum dividitur in mundanam et humanam; sicut et in Ecclesia binarius esse probatur, in quantum possidet duo testamenta .... Item alius binarius est in musica in quantum dividitur in naturalem et instrumentalem; sicut et in Ecclesia reperitur et alius binarius, in quantum vita contemplativa utitur et activa.» Beide Arten der Musik werden mit den biblischen Schwestern Maria und Martha verglichen. «Et sicut vita Marthae, quae activam significat, periculosior est quam Mariae, quia majori periculo subjacere videtur, sic et illi, qui cantum nesciunt absque libris, velociori subjacent detrimento in eo, quod libris vel non praesentibus vel in promptis obmutescere videantur, et quasi nihil scire de cantu. Sed quia non cuivis hominum contingit adire Corinthum, consulo ut qui Maria non potest esse in cantu, saltem et affectum ipsius Marthae sibi studeat obtinere.» Weiterhin werden als Parallelen aus der Kirchenlehre und ihren Riten herangezogen für die drei Teile des Tonsystems die Dreifaltigkeit, für die vier Haupttonarten die vier Haupttugenden, für die sieben Stufen der Tonleiter die sieben Gebetszeiten, die sieben Sakramente und die Gaben des hl. Geistes, für die acht Tonarten die acht Seligkeiten, für die neun Intervalle die neun Chöre der Engel, für die zehn möglichen Notenlinien der Dekalog usw. «Curn igitur, schließt das Kapitel, musica in talibus, in tot et tantis habeat similitudinem cum Ecclesia, nil nirum, si usus musicae et solemnis ejus memoratio in Ecclesia observatur 1. » Dem heutigen Menschen dünken solche Gedankenreihen absonderlich; das Mittelalter setzte alle Tätigkeit des Geistes in Beziehung auf die ewigen Ziele des Menschen, auf die Religion, da, wie Roger Bacon sagt: «humana nihil valent nisi applicantur ad divina 2 ». In einer andern dem Johannes de 1
Muris zugeschriebenen 1 Schrift sind mehrmals die folgenden vier aristotelisch-scholastischen Leitsätze (petitiones oder theoremata) eingeschaltet, welche die geistige Umgebung dieser Musikliteratur in helles Licht rücken: 1. «Omnem doctrinam et clisciplinam ex praeexistente cognitione fieri. 2. Ante cognitionem sensitivam non aliam inveniri. 3. Experientia multiplici ut in termino status adquiescere. 4. Experientiam circa res sensibiles artem facere» 2. Auch ihr Verfasser betont übrigens, «quanta debet esse cura viris politicis de bene moderata musica conservanda 3 ». Des Johannes de Muris Vorlesungen wurden nachgeschrieben, ausgezogen, kommentiert, bearbeitet, aber, wie es scheint, auch mit den Fortschritten der späteren Praxis und Kunstlehre in Übereinstimmung gebracht. Sie bildeten das Handbuch für den akademischen Unterricht in fast allen Universitäten des Nordens. Den Statuten der Facultas artium der 1348 nach dem Muster der Pariser gegründeten Prager Universität entnehmen wir, daß die Promovendi ad gradum. magisterii Vorlesungen über die folgenden Gegenstände zu hören hatten: «omnes libros majoris physicae, logicam
Aristotelis, ethicorum, politicorum, oeconomicorum, sex libros Euclidis, sphaeram theoreticam, aliquid in Musica et in Arithmetica.» 1 Diese Bestimmung würde am 7. Dezember 1367 in plena Congregatione Facultatis philosophicae dahin ergänzt, daß die den Vorlesungen zugrunde gelegten Bücher vollständig durchgenommen werden müßten, darunter «omnes libri Aristotelis, unacum geometricalibus, astronomicalibus et musicalibus». 2 Als die deutschen Professoren und Studenten an der Universität Prag im Jahre 1409 vor der Vergewaltigung durch die Böhmen und Huß Prag verließen und in Leipzig eine neue Hochschule einrichteten, übernahmen sie die Ordnung des Prager Studium generale. In den Statuten der Leipziger philosophischen Fakultät, die wir in mehreren Fassungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert besitzen, wird regelmäßig unter den Libri, welche die Kandidaten zum Gradus magisterii durchgehen müßten, die Musica Muris genannt. 3 Um 1500 dozierte daselbst der Magister Conradus Noricus, der 1503 eine der Schriften des Johannes de Muris neu bearbeitete. 4 Auch in Wien wurde von den Kandidaten eine Vorlesung über die Musik 1
(«aliquem librum de Musica») verlangt. 1 In den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts lehrten hier die Musik die Magistri Nikolaus von Neustadt und Georg von Horb. 2 Nach einem Verzeichnis der Magistri der Facultas artium vom 1. September 1431 las damals der Magister Paulus Troppauer über die Musica Muris. Auch der Magister Johannes de Gmunden, der 1443 starb, muß solche Vorlesungen gehalten haben; wenigstens hinterließ er einen Liber in pergameno continens Musicam Boethii. 3 Die Statuten der Universität Löwen aus dem Jahre 1427 bestimmen: «Statuimus et ordinamus, quod in mathematicalibus legantur tractatus de sphaera, primus liber Euclidis, aliquis tractatus de arithmetica et Johannes de Muris musica.» 4 Die Statuten des Collegium Dionysianum in Heidelberg aus dem Jahre 1452 sehen Vorlesungen über Musik vor; es scheint aber, daß sie hier mehr als fakultativ oder weniger wichtig galten, da sie als Teil des Lehrstoffes für den sogenannten Parvus ordinarius angeführt werden. 5 Hier hielt auch der als Universitätsprediger angesehene Conrad von Zabern um 1430 vielbesuchte Vorlesungen über Musik, zumal gregorianischen Gesang. 6 Aus den Statuten der philosophischen Fakultät zu Basel um 1460 muß man zwar schließen, daß über Arithmetik und Musik nicht regelmäßig gelesen wurde 7; dennoch 1
ist die Musica in den Statuten des Jahres 1492 wieder als Examensfach pro magisterio verzeichnet. 1
Im Studium Francfordianum legte um dieselbe Zeit der Magister Ambrosius Lacher die Musica des de Muris seinen Vorlesungen zugrunde und veranstaltete eine Neuausgabe derselben 1508. 2 Ebenso sind an der polnischen Universität Krakau Vorlesungen über Musik bezeugt. Als Magistri, welche solche .anzeigten und zwar in Verbindung mit der Arithmetica, werden genannt Martinus Schamotuli; Stanislaus Oboleci und andere, sämtlich in den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts. Auch hier müssen die Lehren des Johannes de Muris den Stoff für den Unterricht abgegeben haben, denn die Universitätsbibliothek Krakau bewahrt noch heute mehrere Exemplare seiner Schriften aus damaliger Zeit. Nicht immer aber wurden die Vorlesungen auch gehalten, oft waren sie nur angezeigt. 3 Professoren der Musik werden weiter genannt in Tübingen, Greifswalde, Altorf und Königsberg. 4 Von dem Ingolstadter Magister Erasmus Heritius hat sich ein Kollegheft über die Musica speculativa in der Münchener Staatsbibliothek erhalten 5, ebenso das Kollegheft eines Wittenberger 1
Studenten, Georg Donat, um 1543, das aber direkt in die praktische Musik einführt. 1
Wir treffen Professoren der Musik im Süden Europas auch außerhalb der Universitäten an. In Padua lehrte um 1400 der Kanonikus Johannes de Ciconia aus Lüttich, dessen Zugehörigkeit zur dortigen Universität nicht feststeht; ebenso in Neapel um 1480 die beiden Flamen Johannes Tinctoris und Bernhard Hykaert. Alle drei Namen beleuchten die damals unbestrittene Führerschaft der Flamen in musikalischen Dingen. Um 1500 wirkte in Mailand als berühmter Musicae professor publicus Franchinus Gafurius aus Lodi, in Bologna war Professor um 1480 der Spanier Bartholomaeus Ramis de Pereja und später sein Schüler Giovanni Spataro. Zu gleicher Zeit waren in Parma tätig Nicolaus Burci («Burtius Parmensis Musices professor»),. in Lucca der Engländer und Karmelit Johannes Hothby, zusammen eine stattliche Zahl Gelehrter von fortschrittlichen Neigungen, die sich nicht ausschließlich an die Lehren des Johannes de Muris hielten. Unter den spanischen Musikprofessoren ist mit Auszeichnung zu nennen Franz Salinas, der um 1577 in Salamanka wirkte, «in Academia Salmanticensi Musicae professor», wie er sich auf dem Titel seiner sieben Bücher über Musik nennt.
Die Geschichte dieses akademischen Musikunterrichtes hat bisher nur wenige Forscher beschäftigt. Die Untersuchungen zur älteren Universitätsgeschichte hefteten sich mehr an allgemeine Fragen oder solche zur Philosophie und Theologie. Dennoch bietet gerade eine Durchforschung der alten Universitätsurkunden nach musikgeschichtlichen Angaben des Interessanten vieles. Musikalische Notizen, die hie und da in den Quellen zerstreut sind, beleben das Bild der mittelalterlichen Universität mit allerlei freundlichen
Strichen. So lesen wir, daß die hl. Katharina von Alexandrien als Schutzpatronin der philosophischen Fakultät verehrt wurde; sie galt überhaupt als Beschützerin der Wissenschaft, und ihr Fest wurde von der ganzen Universität gefeiert. Zu ihrer gesungenen Vorvesper und zum Hochamt mußte der Dekan der philosophischen Fakultät in Heidelberg alle Magistri und Baccalaureati einladen, und ihr Fernbleiben gab Anlaß zu Strafen. .1 In Leipzig war es seit 1426 Vorschrift, daß im Collegium maius die Magistri der Reihe nach bei den gemeinschaftlichen Mahlzeiten «ad mensam prandii vel coenae» die Lesung halten sollten: «sicut meliori modo potest, cum vel sine accentu (d. h. mit oder ohne die melodischen Modulationen, wie sie bei der kirchlichen Lesung üblich waren, und die Accentus hießen),. vel si non potest, disponat alium magistrum pro se legentem.» 2
Die Interessengemeinschaft der Musiktheorie mit der Mathematik hat nicht die Wirkung ausgeübt, daß sich die Musiklehre an der Universität der lebendigen Kunstübung verschlossen hätte. An der Universität Köln dozierte um 1500 der bekannte spätere Gegner Luthers, Johannes Cochläus, als Magister artium die Musik. Seine zuerst anonym veröffentlichte, mehrmals aufgelegte Musica, die seit 1511 in einer Umarbeitung als Tetrachordum Musices erschien, behandelt die Choral- und Figuralmusik damaliger Zeit, wahrt also den Zusammenhang mit der praktischen Kunstpflege und den Bedürfnissen der Studierenden. Tübingen besaß um 1516 den Magister Andreas Ornihoparchus, Verfasser 1
eines Musicae activae Micrologus. In Krakau wurden auch Vorlesungen über die Musica choralis angezeigt. Dasselbe bezeugen für die Universität Basel die beiden Lehrbücher, nach denen dort vor und nach 1500 die Musik vorgetragen wurde, das Lilium Musicae planae des Michael Kleinspeck 1496 und die Clarissima planae atque choralis Musicae interpretatio des Balthasar Praspergius 1501. 1 Des Praspergius Schrift gibt seine Vorträge an der Universität wieder, «in alma Universitate Basileorum exercitata», wie es auf dem Titel heißt. Wie die Schrift des Kleinspeck, wurde auch sie mehrmals aufgelegt. Wenn alle diese Schriften sich besonders
mit dem gregorianischen Gesange beschäftigten, mit der Musica plana, wie sie genannt wurde, so liegt das daran, daß damals der Choral noch Grundlage aller Kunstmusik war, auch des mehrstimmigen Gesanges und der Orgelkomposition.
In den Streitigkeiten um die Erneuerung des akademischen Studiums, die sich gegen Ende des 15. Jahrhunderts im Gefolge des Humanismus 1 einstellten, wurde auch die Musik als Bestandteil des alten Quadriviums und der Artistenfakultät in Mitleidenschaft gezogen. Einen Einblick in diese Erörterungen gewinnen wir aus den Lucubratiunculae bonarum septem artium liberalium, die Dietrich Gresemund in Mainz 1494 herausgab. Gresemund, eine der sympathischsten Gestalten des humanistischen Kreises seiner Zeit, bietet eine Erörterung des Nutzens und Wertes der Musik, ohne auf technische Dinge einzutreten. Die Schrift ist in Dialogform abgefaßt: Aristobolus vertritt die fortschrittliche Richtung und verwirft die sieben freien Künste samt und sonders; sein Widersacher Chiron, den Gresemund seine eigenen Gedanken aussprechen läßt, verteidigt sie. Chiron schließt mit dem Satze, daß die schlimmen Wirkungen der Musik nur aus ihrem übermäßigen Betriebe folgen. «Ideoque», so läßt Gresemund dann den alten Weisen sagen, «musicam amabo, quoad vivam, et ideo magis, quod per hanc in tempus Deus optimus maximus laudatur.» 2
Der größte Musikgelehrte des 16. Jahrhunderts in den Ländern deutscher Zunge war ein Schüler des Johannes Cochlaeus in Köln, der Schweizer Henricus Loris aus
dem Kanton Glarus, der als Henricus Glareanus. in der Geschichte des Humanismus und der Musik einen ehrenvollen Namen trägt. Schauplatz seiner akademischen Tätigkeit waren zumal Basel und Freiburg in Baden. Er stand aber auch in Beziehungen zu unserm Freiburg im Üchtlande; seine Isagoge in Musicam ad studiosorum utilitatem multo labore. elaborata hat er 1516 von Basel aus dem Schultheiß Peter Falk in unserer Stadt gewidmet. Weiter verfaßte er eine Ausgabe der Arithmetica und der Musica des Boethius. 1547 erschien sein Hauptwerk, das Dodekachordon, dessen Namen an des Cochläus Tetrachordon erinnert. Das hochbedeutsame Werk erweitert zum ersten Male die mittelalterliche Tonartenlehre durch die Errungenschaften des. 15. und 16. Jahrhunderts. Eine Epitome daraus erschien 1557 und 1559, ebenfalls eine solche in deutscher Sprache. Glareans Dodekachordon ist das wichtigste musikliterarische Denkmal des 16. Jahrhunderts aus dem Norden, und sein Verfasser der letzte große Vertreter der Musikwissenschaft an der deutschen Universität der älteren Zeit. 1
Vom Ende des 16. Jahrhunderts an sind die Musikprofessoren von den meisten Universitäten des Kontinentes verschwunden. Wir können den Wandel der Dinge z. B, an der Händ der Statuten der Universität Leipzig feststellen, die spätestens vom Jahre 1588 an unter den Lehrfächern die Musik nicht mehr aufweisen. Vielleicht fehlte, diese bereits in den nicht mehr vollständig auf uns gekommenen Statuten aus dem Jahre 1543. In dieser Zeit war der Universität
durch Herzog Heinrich I. die Glaubensneuerung auferlegt worden. Der Umschwung des Unterrichtswesens erhellt auch aus der Vorschrift, die aristotelische Philosophie sei nach den Schriften des Philipp Melanchthon vorzutragen. Ebenso sind Vorlesungen angezeigt über Quintilian, Cicero, Vergil, Horaz, Terenz u. a., d. h. auch der Humanismus war in Leipzig zum Siege gelangt, die alte scholastische Ordnung ebenso verschwunden, wie die Musica des Muris, als Lehrfach. 1 Ähnlich vollzog sich die Entwicklung in Wien. Noch im ganz humanistisch gefärbten Reformgesetz Ferdinand I. für die Universität vom 15. September 1537 wird in der philosophischen Fakultät der primus Mathematicus damit beauftragt, Musicam Ptolemaei (!), oder wenn sie nicht vorhanden sei, Musicam Boethii aut Joanns (sic!) Muris zu lesen. Bei der neuen Reform aber 1554 werden unter den Professoren der Fakultät und ihren Lehrgebieten die Musikvorlesungen nicht erwähnt, es müßte denn in der tota Matheseos absoluta perfectio, die der tertius Mathematicus zu lesen hatte, auch die Musik eingeschlossen gewesen sein. 2 In Basel war Oekolampad, der Reformator, der Musik nicht ungünstig gesinnt; er hält in seinem «Judicium de Schola» an der Musik als Lehrfach fest und zwar als einer mathematischen Wissenschaft, also im Sinne des alten Quadrivium.
Daß die Musikwissenschaft ihren Einfluß an der Universität verlor, wird dadurch erklärlich, daß sie vielfach auf abgetretenen Geleisen sich bewegte, von denen kein Weg mehr zur lebendigen Kunstübung führte. Was nutzte einem Musikbeflissenen des 16. Jahrhunderts die Theorie des Boethius oder gar des Ptolemaeus! Lehrer für den praktischen Bedarf der Universitäten gab es wohl auch weiterhin, man nannte sie meist «akademische Musikdirektoren». Ihre Verdienste um die musikalische Bildung des deutschen Volkes sind nicht zu unterschätzen. An den protestantischen Universitäten
im Norden Deutschlands holten sich viele Kantoren und Organisten. des 17. und 18. Jahrhunderts sogar ihre musiktechnische Ausrüstung, und es galt als eine wirksame Empfehlung, wenn man bei einem Universitätsmusikdirektor: von Ruf in die Lehre gegangen war. Diese aber zählten nicht in einer Reihe mit den Vertretern der wissenschaftlichen. Disziplinen, was sich schon in ihren Gehaltbezügen kundgab, welche die der eigentlichen Professoren nicht erreichten. 1
Jedenfalls gelangte die Musik vorderhand nicht mehr. zur wissenschaftlichen Behandlung von der Universitätskanzel aus; sie mußte während zweier Jahrhunderte der akademischen Krönung entbehren. Freilich fehlte es auch in dieser Zeit nicht an Männern, welche die Musikgelehrsamkeit durch hervorragende Leistungen gefördert haben. Daß aber ihre Beziehungen zur Mathematik nicht erloschen waren, bezeugt der Philosoph Descartes, der durch seine mathematischen Arbeiten veranlaßt wurde, auch ein Compendium Musicae zu schreiben, 1618. 2
Diese Lücke in der Geschichte der Musik als Universitätswissenschaft fülle ich mit einigen Angaben über die Musik der Studenten aus. Bei diesen wenigstens stand die Musik auch weiterhin in hohen Ehren. Die deutschen Studenten zumal erfreuten sich und ihre Zeitgenossen durch Sang und Spiel. So war es bereits in frühen Jahren, und die Akten der Universitäten der alten Zeit wissen darüber allerlei zu berichten. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß sie weniger regelmäßige, allgemein übliche und gebilligte Gewohnheiten vermerken, als vielmehr ausnahmsweise, ordnungswidrige Verhältnisse, Auswüchse, die man sich hüten muß zu verallgemeinern. Ich denke da auch nicht an die
Lieder der fahrenden Scholaren, der Vaganten und Goliarden der älteren Zeit, sondern nur an das Musiktreiben aus der Zeit der Universitäten. Ein paar Beispiele: In Wien war es den Studenten untersagt, sich als Sänger oder Lautenspieler («more amatorum», wie es heißt) auf der Straße hören zu lassen. Die Statuten aus dem Jahre 1385 bestimmen 1 : «Statuimus, quod scolares brigosi, luxuriosi, ebriosi, disculi, noctivagi cum instrumentis musicis vel alias ociosi lenocinantes .... sint a privilegiis et ab intitulationibus honorum exclusi.» Die Statuten der artistischen Fakultät aus dem Jahre 1389 2 wiederholen die Mahnung: «Item scolares non sint noctivagi cum instrumentis musicis et cantibus in plateis, et praecipue illi, qui in nostra facultate voluerint .ad aliquem gradum promoveri.» Ähnlich die Statuten vom Jahre 1413 für die Bursisten der philosophischen Fakultät 3: «Nullus bursalium instrumentis musicis indecenter canat in commodo suo vel alias in bursa, nec clamores ac strepitus indecenter .... exerceat.» Die im Auftrage des Herzogs Albrecht V. abgefaßten neuen Disciplinarstatuten für die Angehörigen der Universität vom 31. Juli 1414 legen sogar dem Gubernator bursarum oder dem Hospes studentium die Verpflichtung auf 4" während der Nacht «suos incolas includere» und acht zu haben «si quis eorum forte desit aut exeat cum armis hostiliter aut instrumentis musicis.... et sine lumine ambulet in plateis.» Wenn derartige Mahnungen in den amtlichen Erlassen immer wieder auftreten, so müssen die Verhältnisse, denen sie entgegentreten sollten, bei den Wiener Studenten tief eingewurzelt gewesen sein. Ähnliches enthalten die Urkunden der Universität Heidelberg: am 27. Juni 1456 sah sich der Rektor Radulphus de Zelandia veranlaßt, den Studierenden in Erinnerung zu rufen, daß sie des Abends nicht ohne Lichter auszugehen 1
hätten, auch wenn sie, wie er sagt, «de nocte aut potius circa aut ultra medium quandoque noctis hovisare 1 dicuntur aliis masculint ac venus feminei sexus hominibus cum lutinis aliisve organis et musicis instrumentis.» 2 Die ältesten. Statuten der philosophischen Fakultät der Universität Basel um 1460 schreiben in der Rubrica III de Magistris u. a. vor 3: «Item rectores bursarum tociens in septimana quociens eis videbitur opportunum, cubilia suorum bursalium. visitent et ad modum vivendi diligenter attendant, ac si arma offensiva vel alia instrumenta levitatem provocantia repererint, auferant atque in sui custodiam ponant.» Von. den Studenten wird in der Rubrica V. de Simplici Studencium statu 4 verlangt: «Item nullus studencium ludum inhonestum vel inconsultum aut offensivum suorum sociorum vel vicinorum vel ad illicita provocativum in domo vel plateis utatur vel habeat, sub pena quam facultas duxerit. infligendam, et ideo prohibeat facultas fistulas, lutinas ceteraque instrumenta clamorosa levitatem inducentia. 5 » Sehr musikeifrig waren die Leipziger Studenten; zuweilen müssen freilich auch sie des Guten zu viel getan haben. Noch aus der katholischen Zeit stammen die Statuten des Collegium minus von den Jahren 1497-1537 6: «Nullus ante vel post disputationem serotinam in stuba communitatis clamores, horribiles ant pulsus insolitos faciat .... neque arma seu
lutinas vel quaecumque alia musicalia instrumenta .... exercere praesumat sub poena decem grossorum irremissibiliter persolvendorum.»
Allgemein wär es Brauch, Promotionen mit musikalischem Aufwand zu begehen. In Wien wurden die Promovendi in feierlichem Zuge nach St. Stephan geleitet, und die Glocken der Kirche läuteten ob reverentiam doctorandi; Trompeten- und Paukenschall empfing sie in der Kirche. Auffälligerweise fand seit 1430 die Feier für die Angehörigen der artistischen Fakultät in der Aula statt, weil die Doktoren der andern Fakultäten in der Kirche höhere Plätze beanspruchten, die Artisten aber diesen Anspruch nicht gelten ließen. 1 Auch in Ingolstadt wurden die Stadtpfeifer (tibicines) im 16. Jahrhundert bei Promotionen in Anspruch genommen; sie erhielten dafür 3 bis 4 Taler. 2 Ebenso 1
traten in Basel Trompeter und Pfeifer bei Promotionen in Tätigkeit; sie geleiteten den Kandidaten zur Feier, nachher zum Bankett. 1
In den studentischen theologischen Konvikten gehörte gemeinschaftlicher Gesang zur täglichen Arbeit. Die Konstitutionen des Jesuitenordens schlossen zwar Chor, Hochämter und andere feierliche Gottesdienste aus, wie auch jede Art von Gesang (cantus figuratus vel firmus) 2 bei den sonntäglichen Vespern; ebenso war es verboten, Musikinstrumente im Hause zu halten, und manche Obern ließen den Gesang auch in den Studienhäusern nicht zu. Hier wirkte die Reaktion gegen die damals größtenteils verweltlichte Kirchenmusik nach. 3 Dennoch gelangte unter dem Drucke der Verhältnisse bald eine mildere und kunstfreundlichere Richtung zum Siege, und die Väter der Gesellschaft Jesu haben für ihre literar- und theatergeschichtlich so wichtigen Schuldramen die Hilfe der Musik nicht verschmäht. Bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurde im Jesuitenseminar zu Fulda den päpstlichen Stipendiaten auferlegt, u. a. den gregorianischen Gesang eifrig zu erlernen. Zweimal im Jahr hatten sie sich durch eine Prüfung darüber auszuweisen, und den Nachlässigen wurde ein Teil des Stipendiums entzogen. An der Universität Dillingen, die auch von Angehörigen anderer Orden besucht wurde, fanden diese gute Gelegenheit, sich in Gesang und Musik auszubilden. Mittags und abends konnten sie eine Stunde lang singen und an Festtagen beim Offizium und in der Vesper 1
ihre Fertigkeit in Gesang und Spiel erproben. Die Schulkomödien der Jesuiten pflegten die Musik namentlich für die Chöre. Schon 1601 sind für eine Münchener Aufführung auch Tympanistae und Tibicines vorgesehen. Das Wiener Jesuitenkolleg besaß in seinem Theaterraum einen großen Chor für die Musikanten. Bei der ersten Aufführung des Oratoriums Philothea, einem gesungenen allegorischen Drama, in München 1643 wirkten 17 Sänger und 15 Spieler. mit, und die Musik machte, wie Zeitgenossen berichten, einen gewaltigen Eindruck. Zu einem solchen Jesuitendrama, Apollo und Hyacinthus, das 1767 von Studenten der Universität Salzburg aufgeführt wurde, hat kein geringerer als Mozart im Alter von 11 Jahren die Musik geschrieben.
Auch die Studenten der protestantischen Konvikte waren der Musik sehr ergeben. 1 Aus dem Stundenplan des Heidelberger Konviktes 1685 wissen wir, daß jeder Tag früh um 5 Uhr mit einem Gesang eröffnet und des Abends um 8 Uhr mit einem solchen beschlossen wurde. Gesungen wurde auch vor und nach jeder Mahlzeit. Die Statuten des Leipziger Collegium maius aus dem Jahre 1565 schreiben vor: «Musici cantus tam vocis quam organorum usurpabuntur temporibus opportunis absque studiorum detrimento et aliorum offensione.» Ähnlich die Statuten des dortigen Frauenkollegs (Collegium beatae Mariae virginis) vom Jahre 1628: «Musicos cantus qualescumque nemini interdicimus, dummodo musici illi sint, i. e. studio bonarum artium et humanitatis digni, suumque et modum et tempus habeant, si scilicet extra studiorum et nocturnae quietis horas citra suum et aliorum impedimentum fiant. 2 » An der «hohen Schule» in Bern beteiligten sich die Studenten am Psalmgesang, wie er damals in den reformierten Kirchen der deutschen Schweiz üblich war; mehrmals in der Woche versammelten sie sich zur gemeinschaftlichen Probe. 3 1
Im 17. Jahrhundert war zum Chorgesang das vom Instrumente begleitete Lied hinzugetreten. Diese Formen haben dann bei den Studenten der deutschen Universitäten begeisterte Pflege gefunden, ebenso aber die studentische Instrumentalmusik in der Form von Suiten. Dabei ist es nicht geblieben. In Leipzig ergaben sich die Studenten in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts mit großem Eifer auch der Oper. 1 Die Kantoren der St. Thomasschule führten bittere Klage, daß die Studenten, die bei ihnen singen gelernt hatten, wenn sie zur Universität kamen, nichts mehr mit ernster Kirchenmusik zu tun haben wollten 2, sondern es vorzogen, unter die «Operisten» zu gehen oder dort mitzusingen, wo eine opernhafte, fröhliche Kirchenmusik gemacht wurde. Die Neigung der Leipziger Studenten zur Oper ist auch aus späterer Zeit bezeugt. Als in den
60-er Jahren des 18. Jahrhunderts die Koch'sche Truppe in Leipzig die ersten deutschen Singspiele aufführte, klagten die Professoren, daß die Studenten mehr ins Theater als in die Vorlesungen liefen, und setzten es durch, daß Koch nur zweimal in der Woche spielen durfte. Dazu kam das instrumentale Zusammenspiel in den Collegia musica, als deren eifrige Förderer sich gerade die Studenten erwiesen haben. In Bern bestand ein solches studentisches Collegium musicum bereits um 1675; es erfreute sich der Unterstützung der Behörden 1; in Basel wurde es 1695 geradezu von der Universität ins Leben gerufen, fand aber, wie es scheint, nur wenig Gegenliebe bei den Studenten. 2 In Leipzig z. B. gab es zur Zeit, als Joh. Seb. Bach Thomaskantor und Universitätsmusikdirektor war und bereits vorher, zwei solcher Collegia, die sich befehdeten und einander die Studenten abspenstig zu machen suchten. Neben dem amtlichen Universitätsmusikdirektor machte sich in der Person eines Leipziger Organisten ein Nebenbuhler zu schaffen, dessen Konkurrenz selbst Bach nicht zu brechen vermochte. 3 Um die Wende des 18. Jahrhunderts verstummte die Studentenmusik mit verschwindenden Ausnahmen. Erst ein Menschenalter später trat eine Besserung ein, als sich die akademischen Gesangchöre auftaten, die Liedertafeln, und mit ihnen eine neue musikalische Literatur, der Männerchorgesang, den das 17. und 18. Jahrhundert so gut wie. nicht gekannt hatten. Die Bedrängnisse der napoleonischen Zeit brachten den lange zurückgehaltenen Idealismus der deutschen studentischen Jugend zu urgewaltigen Äußerungen in Lied und Gesang. Es sei da nur an die von Karl Maria von Weber vertonten Lieder Körners «Leyer und Schwert» erinnert. Die deutsche Schweiz hat ihren Anteil an dieser Blüte
studentischer Kunst infolge der Bemühungen des Zürcher Nägeli und anderer um die Hebung des Männergesanges.
Unterdessen war die Erinnerung an das akademische Lehrfach der Musik nicht ausgelöscht. Der bayrische Schulrektor Joh. Mich. Schmid, der während seiner Studien auf der Universität Leipzig an der Musik nicht achtlos vorübergegangen war, — er hatte sich noch an dem Künstlertum Bachs erbauen können — behandelt in seiner «Musico-Theologia oder Erbauliche Anwendung musikalischer Wahrheiten» 1754 auch (in § 114) die. Frage, ob die Musik auf den Universitäten wieder einzuführen sei. Wir erfahren. dort, daß manche Gebildete die Ausscheidung der Musik aus dem Verbande der philosophischen Wissenschaften beklagten. Schmid ist gegen die Musikprofessuren. Seine Einwände treffen das Pflichtfach, was sie in alter Zeit war. Auch betont er, daß der Mensch auf dieser Welt nicht alles lernen müsse; man brauche auch nicht für alle wissenschaftlichen Disziplinen eigene Professoren anzustellen, wichtiger sei es, sich um Gott und den Nächsten zu bemühen und ein christliches Tugendleben zu führen. Dennoch wäre Schmid mit dem Musikprofessor an der Universität vielleicht einverstanden, wenn er «die Natur mit Feuer und Eisen anzugreifen und durch allerlei Versuche hinter ihre Geheimnisse zu kommen wüßte», d. h. er verlangt von ihm eine wissenschaftlich gerichtete, exakte Forscherarbeit. Was Schmid hier wünscht, hat die neuere Musikwissenschaft in Angriff genommen, und sie ist bereits zu tüchtigen Leistungen. fortgeschritten; auch schließen sich die Musikwissenschaft und ein christliches Leben nicht aus.
Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es Gegner des Universitätsfaches der Musik. Die Männer der Zunft waren es, die sich dagegen sträubten. Schmid hatte sie trotz aller Vorbehalte nicht ganz abgewiesen, ihr vielmehr ein Ziel gesteckt, das sie zu einer wirklichen Wissenschaft erhebt. Anders drückte sich der Direktor der Berliner Singakademie, Zelter, aus in einem Briefe, den er aus Neuwied am 14. November 1823 an Goethe schrieb. Damals hatte
sich an der Universität Bonn der akademische Musikdirektor Heinrich Karl Breidenstein, der von den Rechts- und den Sprachwissenschaften zur Musik übergegangen war, habilitiert und begann seine Tätigkeit. Zelter berichtet: «Der junge Musikdirektor hielt eben seine erste Vorlesung an die Studenten und zwar über Generalbaß. Wir haben ihm eine Perrücke von Berlin aus versprochen und angeraten, erst etwas zu tun und dann zu reden .... Die Unverschämtheit solches jungen Gezüchtes läßt sich nicht mit Worten sagen. Sie predigen von den Lehrstühlen herab, die alten Lehren gälten nichts mehr .... Ich habe ihm zu verstehen gegeben, ich werde ihm den Hals brechen, wenn er mir die guten alten Regeln angreift .... Wir kennen den musikalischen Doktormantel schon von Forkel her ....» Für den Schulmann Schmid ist der Musikprofessor ein Mann der wissenschaftlichen Arbeit und seine Pflicht, die Forschung zu pflegen; für den Musiker Zelter ist es die Hauptsache, daß er «die guten alten Regeln» nicht angreift. Nichts beleuchtet mehr die Unklarheit in den Aufgaben und Zielen der Musik an der Universität, als dieser Gegensatz der Auffassungen. Breidenstein wurde trotz des Geschimpfes seines Gegners einige Jahre darauf zum Professor ernannt und hat seiner Kunst Ehre eingetragen. Noch heute erinnert an ihn das Beethovendenkmal in Bonn, zu dem er die Anregung gegeben hat. Auch als Komponist ist er hervorgetreten. Den groben Spott Zelters, der auch noch später an Breidenstein sein Mütchen gekühlt hat (Brief an Goethe vom 28. Januar 1828), hatte er so wenig verdient, wie Forkel 1, der als Geschichtsforscher bis heute im gesegneten Andenken der Wissenschaft weiterlebt, und dessen
zweibändige, allerdings unvollständige Musikgeschichte Vielen Dienste erwiesen hat, die ihr Weg niemals mit Zelter zusammenführte.
Breidenstein war der erste Musikprofessor der neuem Universitätsgeschichte Deutschlands. Den nächsten erhielt die Universität Berlin in Adolf Bernhard Marx, der wieder von der Jurisprudenz hergekommen war, dann auch bei Zelter gearbeitet hatte, im Jahre 1830, nachdem ein anderer Schüler Zelters, Mendelssohn, die ihm angebotene Professur ausgeschlagen hatte. Seither ist die Universität Berlin eine der wichtigsten Pflegestätten der Musikwissenschaft. Es folgte 1861 Wien mit Hanslick, und dann allmählich die andern Universitäten. 1 Sogar technische Hochschulen, wie
z. B. Darmstadt, Dresden und Hannover, haben neuerdings ihre Hörsäle der Musikwissenschaft geöffnet; ohne Zweifel ist damit die hervorragende Eignung der Musik zur geistigen Ergänzung des rein technischen Betriebes ausgesprochen.
Die Entwicklung der Dinge hat dem trefflichen Schmid Recht gegeben; heute sind die Professoren der Musik an der. Universität in erster Linie Lehrer wissenschaftlicher Arbeit, nicht aber Überlieferer und Verfechter praktischer Regeln. Eine wertvolle. Ergänzung der wissenschaftlichen Unterweisung wird aber durch die Collegia musica gebildet, die neuerdings wieder an zahlreichen Universitäten eingerichtet worden sind.
Waren zuerst Frankreich und England in der Musikwissenschaft normgebend, so ist es heute Deutschland. Wie die neuere Musikwissenschaft überhaupt, so sind auch die neueren Lehrstühle für das Fach ein Werk des deutschen Idealismus, man kann auch sagen, der deutschen Romantik, und Deutschland besitzt trotz achtbarer Leistungen anderer Völker darin bis zur Gegenwart den Vorrang. Das bezeugen auch die schweizerischen Universitäten,. von denen die deutschsprachigen Basel 1, Bern und Zürich, Professoren
oder Privatdozenten für Musikwissenschaft in ihren Lehrkörper aufgenommen haben, die durch die deutsche Schule gegangen sind. Auch in Lausanne, Neuenburg und Genf sind neuerdings gelegentlich von Privatdozenten Vorlesungen über Musik angezeigt worden. Freiburg aber hat als die erste schweizerische Universität durch Errichtung einer ordentlichen Professur für Musikwissenschaft auch darin den Anschluß an die Überlieferungen der alten Universitäten erreicht.
Daß die Musikwissenschaft auch in Frankreich wieder an der Universität zu Ehren gelangte, dazu hat wohl ein Aufsatz beigetragen, den der Professor am Pariser Konservatorium, Maurice Emmanuel, in der Revue de Paris vom 1. Juni 1898, S. 649-672 über «La Musique dans les Universités allemandes» veröffentlichte, und der von ihrer Pflege ein mit warmer Teilnahme gezeichnetes Bild aufrollt. M. Emmanuel beschließt seine Darlegungen mit einem Appel an seine Heimat: «Notre pays restera-t-il indifférent à la science de la Musique fondée par les Allemands depuis trente années, et dont ils ont fait une auxiliaire de l'Art? Il est possible, en s'appuyant sur l'expérience qu'ils ont réalisée et qu'ils étendent chaque jour, de définir brièvement les objets essentiels d'un enseignement supérieur de la Musique à l'Université.» Er nennt als Lehrfächer experimentale Akustik, Harmonielehre, Kontrapunkt, Formenlehre, musikalische Philologie und allgemeine Geschichte der Musik. «Telle est la science que l'Allemagne a fondée. Elle est complète; elle est logique; et l'on n'en supprimerait rien sans l'amoindrir.» Heute, nach 22 Jahren, wäre freilich darüber ungleich mehr zu sagen. An deutschen Universitäten haben auch Gelehrte von Ruf wie Combarieu und
 Ecorcheville musikwissenschaftlichen Studien obgelegen. Nur
in Italien hat die frisch aufblühende Musikforschung ein
Heim an der Universität noch nicht gefunden; auch sie
aber, Gelehrte wie Torchi, Cesari u. a. beweisen es, hat
mannigfache mittelbare und unmittelbare Anregung von den
deutschen Universitäten gewonnen.
Ecorcheville musikwissenschaftlichen Studien obgelegen. Nur
in Italien hat die frisch aufblühende Musikforschung ein
Heim an der Universität noch nicht gefunden; auch sie
aber, Gelehrte wie Torchi, Cesari u. a. beweisen es, hat
mannigfache mittelbare und unmittelbare Anregung von den
deutschen Universitäten gewonnen.
Hand in Hand mit dem Wachstum der Musikwissenschaft auf den Universitäten ging naturgemäß die Forscherarbeit und ihre schriftstellerische Verwertung. Nach Unternehmungen ohne längern Bestand gelang es Adler, Chrysander und Spitta 1885 in der «Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft» einen Sammelpunkt für die deutsche Musikforschung zu schaffen. Allerlei ungünstige Verhältnisse bereiteten ihr nach zehnjährigem Erscheinen ein frühes Ende. Ohne sich entmutigen zu lassen, trat bald darauf Oskar Fleischer mit einem Plane vor die Öffentlichkeit, wie er nur im Kopfe eines deutschen Idealisten reifen konnte: er gründete eine internationale Musikgesellschaft zur Einigung aller wissenschaftlich gerichteten Musikfreunde. Bis zum Weltkriege bot sie in ihren beiden Organen, der «Zeitschrift» und den «Sammelbänden der IMG» jedem ehrlichen Arbeiter ohne Unterschied der Volksangehörigkeit eine Betätigungsmöglichkeit. Hier gesellten sich Abhandlungen größeren und geringeren Umfanges in französischer, englischer und italienischer Sprache zu deutschen, die allerdings an Zahl und Bedeutung der Beiträge den Löwenanteil stellten. Das Verzeichnis der Mitglieder der IMG umfaßte Namen aus allen Erdteilen. Der Weltkrieg hat die internationale Musikgesellschaft, die noch im Juni 1914 ihren letzten Kongreß in Paris gehalten hatte, aufgelöst, nicht aber die Arbeitslust der Musikforscher verringert. Noch vor seinem Ende erschien die neugegründete «Zeitschrift für Musikwissenschaft» der 1917 ins Leben gerufenen «Deutschen Musikgesellschaft» auf dem Plan, die mit frischem Wagemut die zerstreuten Kräfte wieder zu sammeln und durch Zufuhr junger Mitarbeiter zu vermehren verstand. Und kurz vor dem Augenblick, wo die Staatsumwälzung alle Herrscherthrone in Deutschland
umwarf, vollzog ein hochsinniger Fürst, Adolf zu Schaumburg-Lippe, 1917, eine einzig in ihrer Art dastehende Stiftung und schuf das «Fürstliche Institut für musikwissenschaftliche Forschung zu Bückeburg 1 », das trotz aller widrigen Zeitumstände mit fürstlicher Freigebigkeit ausgestattet wurde. Es soll der Forschungsarbeit auf allen Gebieten der Musikwissenschaft dienen, und ist nach dem Muster der deutschen Akademien der Wissenschaften eingerichtet, kann auch als eine «Akademie der Musikwissenschaft» bezeichnet werden. Als ordentliche Mitglieder des Institutes wurden vornehmlich die Vertreter der Musikwissenschaft auf den deutschen Universitäten dem Institut angegliedert, als außerordentliche solche in Österreich, der Schweiz, Holland, Dänemark, Finnland, Schweden, Spanien und Böhmen. Im «Archiv für Musikwissenschaft» besitzt sie ihr regelmäßiges Organ. Dazu kommen Quellenveröffentlichungen mannigfacher Art.
In Paris hat sich jüngst eine neue «Société française de musicologie» aufgetan, welche die berufensten Vertreter des Faches vereinigt; die «Rivista musicale italiana» legt nach wie vor die Arbeiten italienischer Musikforscher vor.
So wird die Musikwissenschaft auch in Zukunft ihre Aufgabe erfüllen und, wenn nicht alles trügt, ihre Leistungsfähigkeit mit noch größerem Eifer betätigen. Ihre Hauptstätten aber bleiben die Universitäten, von denen die deutschen in der allerletzten Zeit noch weitere Extraordinariate in Ordinariate umgewandelt haben, Bonn, Heidelberg, Göttingen, Breslau, so daß die Musikwissenschaft heute auf fast allen deutschen Universitäten den ältern akademischen Disziplinen als gleichberechtigt zur Seite steht. An den größten Universitäten hat sich die Zahl der akademischen Lehrer in den letzten Jahren stark vermehrt.
Wenn hier in Freiburg der Betrieb der Vorlesungen und Übungen der kirchlichen Musik eine bevorzugte Stellung einnimmt, so will ich das nicht mit dem Hinweise auf das mittelalterliche Vorbild rechtfertigen. Wichtiger erscheint, daß die Eigenart unserer Alma Mater wie auch dringende wissenschaftliche Aufgaben der Gegenwart diese Einrichtung wünschbar machen. Dem Verhalten der irischen katholischen Hochschule und des Pariser Institut Catholique können wir entnehmen, daß selbst an solchen Universitäten ähnlichen Charakters, die über geringere Mittel verfügen, die Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit eines Lehrstuhles wenigstens für kirchliche Musik nicht in Frage steht. Die Universität Freiburg aber besitzt in dieser Beziehung vor ihren Schwestern den Vorzug, daß sie, ohne die praktischen Aufgaben zu vernachlässigen, wissenschaftlichen Zielen nachstrebt, und auch bereits eine stattliche Anzahl jüngerer Kräfte zur musikwissenschaftlichen Arbeit, vor allem zur Erforschung der musikalischen Vergangenheit herangebildet hat; dieses ist aber, sei es wegen nicht genügender wissenschaftlicher oder methodischer Ausrüstung der Lehrer oder aus andern Gründen, an keiner andern katholischen Hochschule erreicht, auch nicht einmal versucht worden. Dankbar ist hier der Förderung zu gedenken, die dem Musikforscher aus den andern Fächern der philosophischen und theologischen Fakultät erwächst. Es wäre indessen nicht zweckmäßig, die Lehrtätigkeit auf die kirchliche Musik zu beschränken. Wie diese im Laufe einer fast zweitausendjährigen Entwicklung immer wieder aus den Errungenschaften der weltlichen Kunst für ihr eigenes Wachstum und ihren Fortschritt Nutzen gezogen hat, und daher eine gründliche Erkenntnis ihrer Vergangenheit ohne stetige Ausblicke auf die gleichzeitige
III.
weltliche Übung unmöglich ist, so müßte die grundsätzliche Vernachlässigung der nichtkirchlichen Musik leicht zur Einseitigkeit führen, zu gefährlichen geschichtlichen Konstruktionen, wie zu haltlosen aprioristischen Auffassungen. Ich ziehe daraus den Schluß, daß der Lehrstuhl für Musikwissenschaft, selbst wenn auf eine gründliche Beschäftigung mit der Kirchenmusik gesehen wird, wie hier in Freiburg, am besten der philosophischen Fakultät eingegliedert ist. Auch in Basel, um noch eine schweizerische Universität zu nennen, hält der zur philosophischen Fakultät gehörige Professor der Musikwissenschaft die Vorlesungen für die Studierenden der theologischen Fakultät. Schließlich darf auch hier wieder daran erinnert werden, daß die Musik von Anfang an eine der sieben Artes liberales war, und die heutige philosophische Fakultät die Nachfolgerin der alten Facultas artium ist.
Der Musikfreund mit geschichtlichen Neigungen wird sich naturgemäß zuerst und vor allem der neueren Musik zuwenden. Von diesem Boden aus ein wissenschaftliches Verständnis der älteren Kunst zu gewinnen, ist selbstverständlich möglich, aber nicht immer leicht. In der günstigsten Lage befinden sich da solche, die durch Aufführungen in der Kirche mühelos und von Jugend auf zu den künstlerischen Leistungen der früheren Zeit bis ins Mittelalter zurück in ein näheres und unmittelbares Verhältnis gebracht werden: Schon der Singknabe auf unsern Kirchenchören, 'den die sonn- und festtägliche Arbeit mit dem frühmittelalterlichen Choral und der mehrstimmigen klassischen Kirchenmusik des 16. und 17. Jahrhunderts vertraut macht, bringt zur älteren Musikforschung eine Ausrüstung mit,, die auf anderm Wege und später in demselben Umfange und derselben Zuverlässigkeit nur mit 'Mühe zu erreichen ist. So ist unsere Kirchenmusik eine vortreffliche Vorschule der Musikgeschichte und damit der Musikwissenschaft überhaupt. Der ihr Fernstehende genießt diesen Vorzug nicht und fällt leicht Irrtümern zum Opfer ohne es zu wissen; selbst dem vorurteilslosesten Forscher lauern allerlei Gefahren
auf, wenn er sich die ältere Musik zum Vorwurf nimmt. Zahllos sind die Fäden, die von dem kirchlichen Leben, von der Liturgie, aber auch von den philosophischen und theologischen Grundlagen der alten Zeit in die lebendige Kunst, in die Kunstlehre, wie in die künstlerische Spekulation hineinreichen. Insbesondere läßt sich die stilistische Eigenart der zahlreichen und geschichtlich bedeutsamen Äußerungen der kirchlichen Musik nur verstehen, wenn man ihre liturgische Umwelt, ihren Zweck und ihre Bestimmung in Betracht zieht, die meist ein überraschendes Licht auf Eigenheiten der musikalischen Formung werfen. Das vermag aber nur derjenige, dem der liturgische Aufbau der Messe und des Stundengebetes geläufig ist. Daher die seltsam schiefen Urteile und Entgleisungen sonst bedeutender und verdienter Männer, sobald sie sich auf das trotz allen Fleißes und Forschereifers doch abseits liegende Gebiet begeben. Auch große und kleine Handbücher über Musikgeschichte, solche von illustren Verfassern und aus jüngster Zeit nicht ausgenommen, weisen derartige Verstöße, Rückständigkeiten und Nichtbeachtung neuerer Forschungen auf, nicht zu reden von Schriften und Aufsätzen geringem Umfanges. 1 Hat doch ein Gelehrter vor nicht langer Zeit in allem Ernste die Behauptung aufgestellt, bis ins 8. Jahrhundert hinein habe man in der Liturgie immer und alles nur in simplem Rezitativ, ja sogar in einem Psalmtone gesungen, der unserer
 Weise der Lamentationen ähnlich war. Auf diesem Hauptsatze
wurde dann eine neue Entwicklungsgeschichte der
mittelalterlichen Kunst aufgebaut, die sich. von der Wirklichkeit
weitab in ganz absonderliche Gefilde begibt. Bis
in die letzten Veröffentlichungen spucken solche Konstruktionen
hinein. Ein nur geringes Wissen um die liturgische
Geschichte, die spätestens bereits für das 8. Jahrhundert
die vielgestaltige heutige Ordnung des Kirchengesanges
kannte, würde solche Irrtümer verhindert haben. Die liturgischen
Quellen weisen melodisch reichere («konzentische»)
Elemente bereits für die ersten christlichen Jahrhunderte
nach. Weiter kann man lesen, daß der Psalmengesang in.
Rom erst im 5. Jahrhundert eingeführt worden sei; ein
Satz, gegen den sogar die christlichen Grabsteine Roms
aus dem 4. Jahrhundert Einsprache erheben. Jeder, der
einmal eine Vesper aus dem Choralbuche mitgesungen hat,
weiß, was die Vokale «euouae» zu bedeuten haben,
die in den Büchern hinter den Antiphonen geschrieben
oder gedruckt stehen; sie geben die Vokale von «saeculorum
amen» wieder, mit denen jeder gesungene Psalm schließt,
sind aber für ein Überbleibsel des Heidentums in der mittelalterlichen
Kirche, als eine «voix bacchique et profane»
erklärt worden, da ja auch der Bacchuskult Rufe wie «evoe»
gekannt habe. 1 In diese Gattung gehören die Behauptungen,
daß die mittelalterlichen Neumen auch unter (!) den Silben
geschrieben wurden, daß die Einführung der Wechselchöre
durch Ambrosius nicht nachweisbar sei, daß Paulus (!)
(statt Johannes) diaconus das Leben Gregors des Großen
geschrieben habe, oder wenn Mabillons «Acta SS. ordinis
S. Benedicti» als «Acta Sanctissimi (!) ordinis Benedictorum
(!)» angeführt werden usw. usw. Noch vor kurzem
wurde der Satz in einem Dekrete des Papstes Gelasius,
«feminas sacris altaribus ministrare» übersetzt mit «daß
1
Weise der Lamentationen ähnlich war. Auf diesem Hauptsatze
wurde dann eine neue Entwicklungsgeschichte der
mittelalterlichen Kunst aufgebaut, die sich. von der Wirklichkeit
weitab in ganz absonderliche Gefilde begibt. Bis
in die letzten Veröffentlichungen spucken solche Konstruktionen
hinein. Ein nur geringes Wissen um die liturgische
Geschichte, die spätestens bereits für das 8. Jahrhundert
die vielgestaltige heutige Ordnung des Kirchengesanges
kannte, würde solche Irrtümer verhindert haben. Die liturgischen
Quellen weisen melodisch reichere («konzentische»)
Elemente bereits für die ersten christlichen Jahrhunderte
nach. Weiter kann man lesen, daß der Psalmengesang in.
Rom erst im 5. Jahrhundert eingeführt worden sei; ein
Satz, gegen den sogar die christlichen Grabsteine Roms
aus dem 4. Jahrhundert Einsprache erheben. Jeder, der
einmal eine Vesper aus dem Choralbuche mitgesungen hat,
weiß, was die Vokale «euouae» zu bedeuten haben,
die in den Büchern hinter den Antiphonen geschrieben
oder gedruckt stehen; sie geben die Vokale von «saeculorum
amen» wieder, mit denen jeder gesungene Psalm schließt,
sind aber für ein Überbleibsel des Heidentums in der mittelalterlichen
Kirche, als eine «voix bacchique et profane»
erklärt worden, da ja auch der Bacchuskult Rufe wie «evoe»
gekannt habe. 1 In diese Gattung gehören die Behauptungen,
daß die mittelalterlichen Neumen auch unter (!) den Silben
geschrieben wurden, daß die Einführung der Wechselchöre
durch Ambrosius nicht nachweisbar sei, daß Paulus (!)
(statt Johannes) diaconus das Leben Gregors des Großen
geschrieben habe, oder wenn Mabillons «Acta SS. ordinis
S. Benedicti» als «Acta Sanctissimi (!) ordinis Benedictorum
(!)» angeführt werden usw. usw. Noch vor kurzem
wurde der Satz in einem Dekrete des Papstes Gelasius,
«feminas sacris altaribus ministrare» übersetzt mit «daß
1
Frauen Messe lesen», und behauptet, den Nonnen sei im Mittelalter jede Meßzelebration (!) untersagt gewesen. Eine, wie es scheint, unsterbliche Fabel ist diejenige von der Nonne Nantildis, die König Dagobert wegen ihrer schönen Stimme aus dem Kloster heraus zu seiner Frau gemacht habe. Sie verdankt ihre Entstehung einer falschen Lesart von «monasterium» statt «ministerium» in der Chronik des Fredegar. 1 Nun, man möchte hoffen, solche Dinge in Zukunft nicht mehr lesen zu müssen. Um zu verhüten, daß sie Gemeingut der Literatur werden, ist es unerläßlich, daß das immer noch und selbst von verdienten Forschern gegen die mittelalterliche Musik gehegte Vorurteil einer sachlichen Würdigung der alten Zeit Platz macht; diese stellt dem Musikforscher lohnende und dankbare Aufgaben in Menge. Zu begrüßen wäre eine stärkere Beteiligung von Katholiken an der musikgeschichtlichen Arbeit; sie haben alles Interesse daran, daß über ihre künstlerische Vergangenheit nur gerechte und sachkundige Urteile verbreitet werden. Es ist eine wichtige Gegenwartsforderung, daß wir in der an Ansehen und Ausdehnung wachsenden Musikforschung nicht zu kurz kommen, sondern den Anteil gewinnen, der den Leistungen unserer Vorfahren entspricht. Erfahrungsgemäß (es ist mir eine aufrichtige Freude, das zu betonen) sind die besten unter den nichtkatholischen Forschern recht dankbar, wenn wir auf Irrtümer der bisherigen
Literatur aufmerksam machen und die Wege weisen, wie sie zu vermeiden sind.
Nun möge aus diesen kritischen Auslassungen über die
neuere Literatur zur mittelalterlichen Musik nicht der Schluß
gezogen werden, daß die musikwissenschaftliche Lehrkanzel
unserer Hochschule an der neuem Musikentwicklung
teilnahmslos vorübergehe. Dieser Gedanke wurde bereits
zurückgewiesen. So haben wir es auch nie gemeint; schon
das Verzeichnis der Vorlesungen bezeugt es, sie erstrecken
sich auf das Gesamtgebiet der Musikgeschichte. Indessen
legen die hiesigen Verhältnisse Beschränkungen in den
Arbeitsgebieten auf.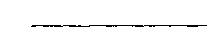
IV.
Ich deutete an, daß die Musikforschung der Gegenwart gerne im Zeichen des Entwicklungsgedankens arbeitet und auch aus der Beschäftigung mit der außereuropäischen Musik fruchtbare Anregungen geschöpft hat. Ganz leicht ist freilich dieses letztere Studium nicht. Unsere heutige Musik mit ihren bis aufs Feinste ausgebildeten Ausdrucksmitteln vermag die ganze Stufenleiter des menschlichen Empfindungs- und Gefühlslebens in Schwingung zu versetzen. Ihre seelischen Wirkungen sind unendlich mannigfaltig und so stark, wie in keinem Abschnitt der Musikgeschichte. Ob dieser namentlich durch das Übermaß der Pflege der Instrumentalmusik im 19. Jahrhundert geschaffene Zustand der Menschheit zum Nutzen gereicht oder nicht, ist eine Frage für sich. Sicher braucht es, um aus diesem Kreise von Eindrücken herauszutreten, ernstes, wissenschaftliches Streben, aber zuweilen auch musikalische Entsagung. Denn z. B. zwischen der nichteuropäischen und unserer Kunst klafft ein Abgrund von unermeßlicher Tiefe und Weite. Der Hinweis auf die kulturelle Rückständigkeit fremder und unentwickelter Völker würde der Sachlage nicht ganz gerecht werden. In Ostasien und Ägypten blühten viele Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung in ihrer Art hochentwickelte Kulturen, die an der Kunst nicht achtlos vorübergingen. Auch solche Tätigkeit des Menschengeistes hat Anrecht auf Beachtung, und man möge darüber nicht vorschnell und überlegen urteilen. Selbstverständlich aber liegt mir der Gedanke fern, daß der Musikforscher sich der bewunderungswürdigen Errungenschaften unserer Zeit zu entäußern habe oder auch nur ihnen gegenüber gleichgiltig werden müsse.
Auch wenn solches überhaupt möglich wäre, müßten wir es ablehnen. Mehr wie der nur ausübende Musiker ist der geschichtlich gerichtete Musikgelehrte von den Großtaten des Genius der musikalischen Kunst überzeugt und erfüllt, und erkennt dankbarst die gewaltigen Fortschritte an, zu denen die europäische Kultur auch in der Musik geführt bat. Aber er fügt dem Genusse die durchdringende Erkenntnis hinzu.
Wissenschaftliche Neigungen waren es freilich nicht, denen wir die erste Bekanntschaft mit der nichteuropäischen Musik verdanken. Es war mehr die menschliche Neugier, die Freude am Seltsamen und Merkwürdigen, welche die. Missionäre, Kaufleute und Reisenden erfüllte, die uns die erste Kunde vom Musiktreiben entlegener Völker vermittelt haben. Die Aufzeichnungen, die sie mitbrachten, übertrugen die exotischen Melodien in unser Dur und Moll, in unseren 3/4 und 4/4 Takt; in unsere Tonleiter, trotz der Stufen, die in 'unserm Tonsystem überhaupt nicht vorhanden sind, und fügten sogar eine akkordische Begleitung hinzu, die dem Orientalen unbekannt und ungenießbar ist. Kritische Selbstbesinnung und Zergliederung des eigenen musikalischen Empfindens hält heute von solchen Zerrbildern ab. Zunächst war man aber zu einer solchen Sachlichkeit des Urteiles nicht vorgedrungen. Man ahnte nicht, wie Vieles in unserer heutigen Musik bedingt ist, und daß man mit ihrem Maßstabe nicht eine auf anderer Grundlage sich erhebende Kunst messen dürfe. Heute geht die exotische Musikforschung anders vor. Phonogramm-Aufnahmen verbürgen eine originalgetreue Übermittlung und erlauben ihre sorgfältige und genaue Untersuchung nach Tonstufen, Rythmus, Tonarten usw. Wichtige Ergebnisse sind auf diesem Wege zuerst von Stumpf und Hornbostel zu Tage gefördert worden. Sogar während des Weltkrieges hat diese Forschung nicht geruht; im Auftrage der Wiener Akademie der Wissenschaften unterzog Rob. Lach und auf deutscher Seite Georg Schünemann die Gesänge russischer Kriegsgefangener einer wissenschaftlichen Untersuchung, die bedeutsame
Ergebnisse zur Entwicklungsgeschichte der Tonsprache gezeitigt hat. 1
In einem gewissen Sinne wiederholt die musikalische Bildung des Kindes ein Großteil der Stufen der Musikentwicklung. In musikalischem Betracht ist die Seele des Neugeborenen, abgesehen von der Fähigkeit, der Anlage zur Musik, ein unbeschriebenes Blatt. Angeborene Vorstellungen und Erkenntnisse gibt es in der Musik nicht. Hier bewahrheiten sich vielmehr die Sätze: «ante cognitionem sensitivam non aliam inveniri» und «experientiam circa res sensibiles artem facere». Man kann es ganz allgemein aussprechen: die wissenschaftliche Erkenntnis der Tatsachen der Musikgeschichte liefert die beste Bestätigung der Grundprinzipien der aristotelischen Erkenntnistheorie; sie lassen sich vielleicht nur von dieser aus erklären. Das Kind würde mit demselben Vergnügen oder Mißbehagen eine Beethoven'sche Sonate und ein Instrumentalstück einer Kapelle aus Java, das Wiegenlied von Brahms und ein Kinderlied aus dem alten Athen entgegennehmen. Mit den ersten Klängen, die seinem Ohre zuströmen, setzt die allmähliche und langsame Bildung oder besser Beeinflussung des musikalischen Aufnahmevermögens des Kindes ein, das weisse, unbeschriebene Blatt beginnt sich mit Eindrücken, mit Erfahrungen zu füllen. Sie häufen sich mit der Zeit, verdichten sich und schaffen eine bestimmte Auffassungs- und Urteilsgrundlage für alles Spätere. Der Mensch, der in unsere europäische Kunst hineinwächst, nimmt ihre Voraussetzungen in sich auf, ohne sich dessen bewußt zu werden. Jeder weitere musikalische Eindruck wird auf Grund der frühern beurteilt, befestigt und verstärkt diese, und so bildet sich allmählich eine musikalische Luftschicht, in der wir atmen und uns bewegen, unser heutiges künstlerisches Denken und Empfinden. Absolut aber und naturnotwendig ist nicht Alles und Jedes darin; Vieles
 könnte anders, sein, ist es auch bereits früher gewesen und
wird infolge des unaufhörlichen Weiterbildungsprozesses der
Musik in einer nahen oder fernen Zukunft auch anders sein.
Wenn Guido von Arezzo, der Reformator des Musikunterrichtes
im 11. Jahrhundert, heute unter uns träte und Gelegenheit.
hätte, eine Beethoven'sche Sinfonie oder ein
Mozart'sches Klavierkonzert zu hören, würde er ihnen vollkommen
ratlos gegenüberstehen. Die gewaltige Summe von,
Einzeleindrücken und -Erfahrungen, die sich in unserer
Musik zusammenfinden, hat eine frühere Zeit nicht besessen;
Guido würde jeder Maßstab dafür fehlen, von dem aus er
die Wirkung eines solchen Werkes auf sich beurteilen könnte.
Umgekehrt aber, wenn wir in den Quellen des 10.-11. Jahrhunderts
lesen, daß man sich an einer Musik ergötzt habe,
die wir heute als häßlich, als abstoßend empfinden, so
hat es keinen Zweck, solches für unmöglich zu erklären
und die Quellen Lügen strafen zu wollen, wie das früher
geschehen ist; einem geschichtlich geschulten Musiker werden
derlei Berichte keinerlei unüberwindliche Schwierigkeit
vorhalten. Es ist überhaupt eine durch vielfältige Beobachtung
gestützte Tatsache, daß der Eindruck von Tonwerken
der Vergangenheit' je nach der Eigenart der zeitgenössischen
Musik zum Teil starken Veränderungen unterliegt.
So z. B. fallen Schöpfungen Palestrinas, aber auch
Haydns und Mozarts in unserer unruhigen, zerissenen, an
stärkste auch künstlerische Reizmittel und Gegensätze gewohnten
Zeit auf eine anders geartete Urteilsfläche als
ehedem. Daß sich daraus wichtige Gesichtspunkte für die
wissenschaftliche Beurteilung älterer Musik ergeben, sei hier
nur angedeutet. .
könnte anders, sein, ist es auch bereits früher gewesen und
wird infolge des unaufhörlichen Weiterbildungsprozesses der
Musik in einer nahen oder fernen Zukunft auch anders sein.
Wenn Guido von Arezzo, der Reformator des Musikunterrichtes
im 11. Jahrhundert, heute unter uns träte und Gelegenheit.
hätte, eine Beethoven'sche Sinfonie oder ein
Mozart'sches Klavierkonzert zu hören, würde er ihnen vollkommen
ratlos gegenüberstehen. Die gewaltige Summe von,
Einzeleindrücken und -Erfahrungen, die sich in unserer
Musik zusammenfinden, hat eine frühere Zeit nicht besessen;
Guido würde jeder Maßstab dafür fehlen, von dem aus er
die Wirkung eines solchen Werkes auf sich beurteilen könnte.
Umgekehrt aber, wenn wir in den Quellen des 10.-11. Jahrhunderts
lesen, daß man sich an einer Musik ergötzt habe,
die wir heute als häßlich, als abstoßend empfinden, so
hat es keinen Zweck, solches für unmöglich zu erklären
und die Quellen Lügen strafen zu wollen, wie das früher
geschehen ist; einem geschichtlich geschulten Musiker werden
derlei Berichte keinerlei unüberwindliche Schwierigkeit
vorhalten. Es ist überhaupt eine durch vielfältige Beobachtung
gestützte Tatsache, daß der Eindruck von Tonwerken
der Vergangenheit' je nach der Eigenart der zeitgenössischen
Musik zum Teil starken Veränderungen unterliegt.
So z. B. fallen Schöpfungen Palestrinas, aber auch
Haydns und Mozarts in unserer unruhigen, zerissenen, an
stärkste auch künstlerische Reizmittel und Gegensätze gewohnten
Zeit auf eine anders geartete Urteilsfläche als
ehedem. Daß sich daraus wichtige Gesichtspunkte für die
wissenschaftliche Beurteilung älterer Musik ergeben, sei hier
nur angedeutet. .
V.
Wie dem auch sei, für uns ist die Musikgeschichte die Summe der Arbeit des Menschen an der Ausbildung des Gottesgeschenkes der musikalischen Kunst. An ihrer Spitze steht der Wille und die Tat dessen, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott hauchte dem Menschen mit der Seele die Musik ein, aber nicht als fertige Kunst, sondern als Begabung, als Anlage. Diese Fähigkeit hat der Schöpfer selbst in Bewegung gesetzt, d. h. dem Menschen den Trieb eingepflanzt, die Kunst zu betätigen, zu pflegen, zur Reife zu bringen. Von da an befindet sich die Musik im Zustande unaufhörlicher Veränderung, einer solchen jedoch, die gewaltige Errungenschaften, sieghaften Aufstieg, aber auch Rückschritte, Zeiten des Niederganges, der Ermüdung und epigonenhafter Tätigkeit, zuweilen auch bewußte 1 oder unbewußte 2 Rückkehr zu Kunstzuständen oder Ausdrucksformen vergangener Zeit aneinanderreiht, und diese Entwicklung wird erst mit dem letzten Menschen ihr Ende erreichen. Bis dahin ist die Musik dem Menschengeschlechte geschenkt zur Freude, zur Erhebung und. Verschönerung
des Daseins; in ihren edelsten Äußerungen aber kehrt sie zu ihrem Ausgangspunkte zurück und bringt Gott dem Herrn ihren Tribut dar. 1
So erblicken wir in der Musik weit mehr als ein Spiel der Finger und der Kehle; wir achten sie als eine bedeutsame Äußerung .des menschlichen Geistes, als eine Künderin von Dingen, für die es ein anderes Organ überhaupt nicht gibt, von den leisesten Regungen des Herzens bis zu den gewaltigen Stürmen ganzer Völker und des Menschentums. In ihren Denkmälern besitzen wir vollgiltige Zeugen der geistigen Bestrebungen eines Zeitalters, in dessen Kulturbild sie oft Züge von besonderer Feinheit und Wichtigkeit einträgt.
Einen Blick in die Ordnung und die Normen hineinzutun, die der Schöpfer der musikalischen Kunst auferlegt hat, das ist eine der schönsten Aufgaben der Musikwissenschaft. Die Musikwissenschaft, wie wir sie verstehen und handhaben, fügt sich in das große Bild der natürlichen und geistigen Welt, in die christliche Weltanschauung ein, aus der heraus die internationale Universität Freiburg ist gegründet worden. Auf die Musikwissenschaft darf ich endlich auch das schöne Wort anwenden, mit dem Papst Pius II. die Gründungsbulle der Universität Basel 1459 eröffnete,
 wenn er von der Scientia sagt: «Peritum ab imperito sua
pretiositate longe facit excellere .... Praeterea illum (sc.
mortalem hominem) Deo similem reddit et ad mundi archana
cognoscenda dilucide introducit, suffragatur indoctis et in
infimo loco natos evehit ad sublimes.» 1
1
wenn er von der Scientia sagt: «Peritum ab imperito sua
pretiositate longe facit excellere .... Praeterea illum (sc.
mortalem hominem) Deo similem reddit et ad mundi archana
cognoscenda dilucide introducit, suffragatur indoctis et in
infimo loco natos evehit ad sublimes.» 1
1






