Von der Mannigfaltigkeit des Erbgutes zur Einheit des Individuums
Rektoratsrede von
Bericht über das Universitätsjahr 1937/38 erstattet vom abtretenden Rektor Prof. P. Feller Ehrungen und Preisverleihungen. Neue Preisaufgaben
PAUL HAUPT BERN Akademische Buchhandlung vormals Max Drechsel 1938
Von der Mannigfaltigkeit des Erbgutes zur Einheit des Individuums
Rektoratsrede von Prof. Dr. F. Baltzer
Hochansehnliche Versammlung.In unserem Lande haben sich kleinere und grössere Gemeinwesen verschiedenster Art zusammengefunden, reine Länderorte und aufstrebende Städte, am mächtigsten Bern. Sie sind in einer vielfältigen inneren Entwicklung zusammengewachsen, die wir heute bewusster und deutlicher spüren als noch vor wenigen Jahren. Denn heute hat die aufgewühlte Gegenwart uns den Sinn für politische Entwicklung geschärft. Wir sehen beharrende und vorwärtstreibende Kräfte durcheinander greifen. Wir gewahren in unserem eidgenössischen Vaterlande ein erstaunliches Nebeneinander und daneben seinen geschichtlichen Weg zur Einheit. Wir erfahren, wie Einheit sich an Mannigfaltigkeit stösst, wie Verschiedenheit an Gleichgewicht grenzt. Wir fühlen, dass es seltener Härte, öfters Verständnis und Verständigung zum Ausgleich braucht.
Solche Gegensätze: Mosaik und Organisation, Einheit und Sonderung, Ausgleich und Kampf sind allgemeine Züge des Lebens. So mag der Biologe den Anlass nehmen, Ihnen gerade über das Grundproblem zu sprechen, das alle diese Erscheinungen kaleidoskopisch in sich schliesst: die Entwicklung vom Nebeneinander, von der Mannigfaltigkeit des Eies zum organisierten und gestalteten Individuum.
Das Tier entwickelt sich aus dem befruchteten Ei, dieses entsteht aus der Vereinigung zweier Fortpflanzungszellen, der
Ei- und der Samenzelle. Es hat gerade durch diese Verschmelzung den Anstoss zur Weiterentwicklung erhalten. In ewigem Reigen bilden Eizelle und Samenzelle die Brücken in der Generationsreihe. Sie legen zwei Fragen vor uns; eine erste: welche Besonderheiten befähigen gerade diese beiden Zellen dazu, eine Generation in die nächste überzuführen; und eine zweite: wie wird aus ihnen, das heisst: wie wird aus dem befruchteten Ei der neue komplizierte Organismus?
Wenn Sie ein gekochtes Hühnerei durchschneiden, so sehen Sie als Eizelle eine scheinbar einfach gebaute gelbe Kugel vor sich. Von einem Hühnchen oder einem Hühnchenembryo keine Spur; trotzdem steckt das Huhn irgendwie vorgebildet in dieser gelben Kugel drinnen. Schon das ist erstaunlich genug. Aber wenn Sie die Dotterkugel eines frischen, rohen Eies betrachten, ist die Merkwürdigkeit noch viel grösser. Sie ist geradezu ein Widerspruch in sich selbst: ein weicher, kaum die Form haltender, bei der kleinsten Verletzung der Hülle zerfliessender Ball, eine klebrige, breiige Masse besitzt trotz aller Haltlosigkeit eine bestimmte Architektur, und es bestehen in ihr bestimmte Bezirke, die irgendwie den späteren Körperbereichen entsprechen; so der Bezirk der Chorda (Vorläufer der Wirbelsäule), die Bezirke der späteren Körpermuskulatur, der Nieren, des Hirns und Rückenmarks usw. — Haltloser, formloser Eizustand und trotzdem vorhandene Eiarchitektur, dieser Gegensatz enthüllt sich freilich nur demjenigen ganz, der mit feinsten Instrumentchen an solchen Eikugeln wie ein Bildhauer am weichen Ton modelliert, sie zerschneidet, Wunden von halber Eigrosse aufreisst und in wenigen Minuten wieder zuheilen sieht, der beobachtet, wie Keimbruchstücke, Halbkeime sich zusammenballen, verschmelzen und sich weiter entwickeln, als wäre nichts gewesen. Er braucht dabei nicht gerade Hühnereier zu nehmen, Frosch- oder Molcheier sind leichter zu handhaben, sind billiger, für die Forschung zugänglicher. Die Gesetze, die an ihnen gefunden wurden, gelten gerade so gut für das Hühner- wie für das Säugetier- und Menschenei.
Zu der verborgenen Architektur, zum Muster der verborgenen
Organanlagen kommt etwas Zweites: lassen wir
irgend ein Ei zerfliessen, so wird ein helles, festeres, durchsichtiges
Bläschen sichtbar, der Eikern. Man sieht ihm schon im Leben und erst recht nach komplizierten Färbungen an, dass er ein Gebilde eigener Art ist. Er ist nicht Organbezirk, nicht Bauplatz; vielmehr ist er in kondensiertester Form vielfältiger Regulator der Entwicklung.
Damit enthüllt sich die grundlegende Doppelnatur jeden Eies: in dem Eiplasma mit sichtbaren oder unsichtbaren organbildenden Bezirken befindet sich ein deutlich abgegrenzter, in die Entwicklung immer wieder eingreifender und in sich selbst sehr verwickelt gebauter Eikern.
Auf dieser Doppelnatur bauen sich viele grundlegende Züge der ganzen Entwicklung bis zum erwachsenen Zustand auf. Die mannigfaltige Reihe verschiedener Tiereier ist in diesem Prinzip gleich. Auch die Pflanzen ordnen sich ihm unter. Für die Forschung aber ergab sich aus dieser Doppelnatur eine doppelte Aufgabe, oft auch ein verwirrendes Doppelspiel. Die Frage, wie viel an Erbanlagen und Entwicklungsfaktoren dem Kern oder dem Plasma oder der Zusammenarbeit beider Partner zugewiesen werden muss, beherrscht eine Forschungsperiode von rund 70 Jahren und ist auch heute noch nicht klar gelöst.
Für die weitere Betrachtung diene uns das Ei des Wassermolches oder Frosches als Beispiel, als günstiges Modell für viele andere.
In einem Tag teilt sich diese etwa stecknadelkopfgrosse Eikugel
in einige hundert kleine Einzelzellen auf; sie furcht sich.
Gleichzeitig bilden sich aus dem einen Anfangskern einige hundert
Tochterkerne. Die beiden Partner der Entwicklung sind also
gleichmässig der Teilung, diesem ersten Grundzug der Weiterbildung
unterworfen. Aber in anderer Hinsicht sind sie fundamentaler
Gegensatz. Das Plasma teilt sich auf, vermehrt aber
nicht seine Substanz. Der Kern teilt und vermehrt sich
auf ein Hundertfaches. Dies möchte ich Ihnen durch einen Vergleich
nahe bringen. Sie können sich das Ei als geographischen
Globus denken. Auch er hat verschiedene Bezirke, Kontinente
und Meere. Sie mögen den organbildenden Plasmabereichen der
Eikugel verglichen werden. Als Kernbläschen liege in der Globusmitte
eine Rosine. Diese teilt sich in zwei identische Tochterrosinen;
jede begibt sich in eine Globushälfte. Wieder teilen sich die Rosinen, und es viertelt sich der Globus, so dass jedes Viertel wiederum seine Rosine besitzt — usf.
Schliesslich ist der Globus aufgeteilt, wie wenn das Messer in allen Längen- und Breitenkreisen eingeschnitten hätte, aber noch immer besitzt er seine ursprüngliche Form und seine geographischen Bezirke. Er ist auch nicht grösser geworden, obschon er jetzt aus einigen hundert Abschnitten besteht. Jeder Abschnitt aber hat seine Rosine. Nun vom Bild zurück zum Objekt: Hervorgehend aus der Plasmakugel mit verschiedenen Bezirken sind die Zellen in ihrem Plasma vielfach verschieden; in den Kernen aber sind sie alle gleich. So verkörpern verkörpern die Kerne ein Erbgut nach dem Prinzip der vollkommenen Wiederholung. Die Plasmabereiche aber verkörpern das Prinzip der Verschiedenheit. Auch sie sind Erbmaterial, aber als Mannigfaltigkeit, als Mosaik des zukünftigen Körpers.
Weiter: es wurden Ei- und Samenzelle als Substanzbrücken
bezeichnet, die Generation mit Generation verbinden. Sie sind
trotz allem Kommen und Gehen das Symbol einer ungeheuren
Kontinuität. Denn trotzdem die Entwicklung des Individuums
eine ununterbrochene Veränderung ist, trotzdem die Keimform
eines gegenwärtigen Augenblicks in den nächsten Stunden schön
wieder umgestaltet und durch eine neue Form ersetzt wird, das
Endresultat ist Kontinuität. Aus dem Molchei entsteht immer
ein Molch, aus dem Froschei ein Frosch, aus dem Hühnerei
das Huhn. Das ist uns zwar geläufig, trotzdem aber kaum
begreiflich. Fragen wir dann weiter, wie viel von dieser Entwicklung
durch die Fortpflanzungszellen bestimmt werde, so lässt
sich ohne weiteres antworten: alles wird von ihnen bestimmt.
Einerseits sind es die besonderen Charaktere der Art,
wie etwa des Homo sapiens, seine Rassen, seine Sippen bis zur
einzelnen Familie. Andererseits aber sind es die Anlagen für die
grundlegende Gestaltung, die die Entwicklung des Individuums
zu einer allgemeinen allgemeinen Form führen, vom Frühkeim zum
Embryo, zum Körper als Gesamtheit und Ganzheit; Faktoren,
die die Grundformen bedingen: des Wirbeltiers, des Säugetiers,
des Insekts, der Blütenpflanze, des Mooses usw.
Dieser doppelte Werdegang des Allgemeinen und Besonderen ist in jedem Individuum gleichzeitig verwirklicht; beides muss schon in der befruchteten Eizelle enthalten sein. Aus einem Menschenei, aus einem Hühnerei wird ja nicht nur ein Mensch oder ein Huhn schlechtweg, sondern überdies immer ein besonderer Mensch, ein Huhn bestimmter Rasse, bestimmten Geschlechts. Da nun die Eizelle Plasma und Kern enthält, so stellt sich sofort auch die Frage, welchen Anteil an dem doppelten Werdegang diese beiden Zellpartner haben. Und weil das befruchtete Ei aus der Verschmelzung der Eizelle mit dem Samen hervorgeht, stellt sich als weiteres Problem: in welchem Grad sind Vater und Mutter an diesem Werdegang beteiligt?
An der Analyse dieser vielen Fragen haben im Lauf der letzten
70 Jahre Männer dreier Wissenschaften zusammengewirkt: Botaniker,
Zoologen und Mediziner, speziell Anatomen und Histologen.
Einen gewichtigen Einfluss haben neben den realen Untersuchungen
auch bestimmte theoretische Vorstellungen ausgeübt;
für das Vererbungsproblem diejenigen Weismanns, für
das Entwicklungsproblem diejenigen Roux' und Drieschs. Endlich
ist geradezu ausschlaggebend das Material selbst gewesen.
Wie die Gestalten der Dichtung gegenüber dem Dichter selbst
vielfach ihr Eigenleben gewinnen und ihr weiteres Schicksal
in sich selbst tragen, so entschieden gewisse Versuchspflanzen
und Versuchstiere über den Gang der Forschung. Sie zwangen
als Modelle ihre bahnbrechenden Meister auf bestimmte
Wege, indem sie ihnen klare Arbeitsbedingungen darboten.
Die Erbse wurde durch ihre Rassenbildung und ihre Züchtbarkeit
in den Händen Mendels im Klostergarten zu Brünn
die erste klassische Vererbungspflanze; die Fruchtfliege Drosophila
mit den mehreren Hunderten verschiedener Rassen
und mit einer Entwicklungsgeschwindigkeit von nur zehn
Tagen pro Generation wurde bei Morgan und seinen Mitarbeitern
in New York das klassische Vererbungstier; der Amphibienkeim,
ein ideales Objekt für Chirurgie auf kleinstem
Raum, wurde in den Händen Roux', Spemanns und Harrisons
zum Modell für experimentelle Entwicklungsgeschichte.
Das Spulwurmei, das Seeigelei wurden durch Boveri und andere zu entscheidenden Objekten für die Erforschung des Zellkerns.
Es ist bemerkenswert, wie sich auch der allgemeine Charakter der pflanzlichen und tierischen Organisation in der Vererbungs- und Entwicklungsforschung ausgewirkt hat. Die Theorie .der ausschliesslichen Vererbung durch den Kern ist vor allem auf zoologischer Seite erwachsen, die Einbeziehung des Plasmas als eines besonderen Erbträgers (des Plasmons, der Plastiden) kommt von botanischer Seite. Es muss in der Tat die Beteiligung der beiden Eltern am Erbgang bei Tieren und Pflanzen etwas verschieden gewertet werden: der tierische Samen ist in bezug auf Vererbung fast nur Kern, dagegen besitzt der männliche Pollenschlauch der Blütenpflanze neben dem Kern auch wesentliche plasmatische Erbträger, die bei der Bildung des Blattgrüns eine entscheidende Rolle spielen.
Viele dieser verschiedenen Forschungsgebiete haben sich zuerst gesondert, ja mit gründlichem gegenseitigem Misstrauen entwickelt. Es ist höchst eindrucksvoll zu sehen, wie sich immer wieder, zwangsläufig und manchmal innert weniger Jahre, der Zusammenschluss grosser, vorher getrennter Gebiete vollzieht. Haben sich im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts die Zellenlehre und die Vererbungsanalyse verbunden, so schwenken jetzt diese beiden Gebiete mit der experimentellen Entwicklungsgeschichte auf gemeinsame Probleme ein. Und heute tritt zu den drei alten Richtungen der Biochemiker und Biophysiker hinzu, und es werden die grossen Institute für den Zusammenschluss aller der verschiedenen Arbeitsmethoden eingerichtet. Glücklich diejenigen Länder, die solche kombinierte Forschungsstätten besitzen.
Um unser Problem weiter zu verfolgen, müssen wir von der
Erbanalyse durch Tier- und Pflanzenzucht ausgehen. Allen voran
steht in einsamer Grösse der Botaniker und Augustinermönch
Gregor Mendel. Was er im Jahre 1865 als kleine Abhandlung
veröffentlichte, war die Auflösung des bisher einheitlich
betrachteten Vererbungsvorganges in einzelne selbständige -
Erbgänge. Er bewies durch Kreuzung verschiedener Rassen, dass seine Erbsen mit roten Blüten, gelbem und rundem Samen und noch andern Merkmalen besondere Erbanlagen haben für die Blütenfarbe, für die Blütenform, für die Samenform, die Samenfarbe usw. Er begründete also eine atomistische Struktur des Erbguts, er zerlegte es in eine Summe von zahlreichen Einzelanlagen oder Genen. Zugleich zeigte er, dass die Gene austauschbar sind und auf die mannigfaltigste Weise durcheinander gewürfelt werden können. Die rote Blütenfarbe kann ebenso gut mit grüner Samenfarbe wie mit gelber kombiniert werden, und die Samen ihrerseits können ebenso gut eckig oder rundlich sein. Auf dieser Würfelspielnatur der Genkombinationen beruht ein grosser Teil der Mannigfaltigkeit der Rassen und der Lebewesen überhaupt.
Die Leistung Mendels auf biologischem Gebiet lässt sich vergleichen der Leistung des Chemikers Dalton 60 Jahre vorher auf anorganischem Gebiet. Er entdeckte, dass die zahllosen verschiedenen chemischen Körper aus Einzelbausteinen einer relativ kleinen Anzahl von Elementen gebildet werden, und dass die ungeheure Mannigfaltigkeit chemischer Körper auf einer verschiedenen Kombination von Elementen und auf verschiedener Zahl und Anordnung der Bausteine beruht.
Die atomistische Grundlage der Erbmasse ist von Morgan und
seinen Mitarbeitern an der Fruchtfliege in erstaunlichem Mass
weiter entwickelt worden. Man kennt heute bei dieser Fliege
viele hundert verschiedene Gene, deren Existenz durch die
Verschiedenheit ebenso vieler Rassen bewiesen wird. Hier ist,
da so viele Gene vorhanden sind, eine unabsehbare Mannigfaltigkeit
von Kombinationen möglich. Aber so gross diese
Formenfülle ist, noch eindrucksvoller und wissenschaftlich bezaubernder
ist die strenge und mathematische Formulierbarkeit ihres
Zustandekommens. Bei der Fruchtfliege lässt sich nicht nur berechnen,
wie viele Prozent Nachkommen bei einer Kreuzung
dem einen oder andern Typus entsprechen werden, sondern
es lassen sich nach dem Willen des Forschers aus den schon
vorhandenen Rassen die Eigenschaften bestimmter neuer Fruchtfliegentypen
errechnen und aus schon vorhandenen Rassen synthetisch
aufbauen.
Was diese Ergebnisse für die Medizin bedeuten, ergibt sich schon daraus, dass der Arzt voraus sagen kann, wie gross die Wahrscheinlichkeit bestimmter Erbleiden bei Kindern von belasteten Eltern ist und wie gross die Wahrscheinlichkeit der Weitergabe an die nächsten Generationen sein wird.
Ich will nur ein Beispiel anführen, über das kürzlich von Dr. Fonio 1) in der Bernischen Naturforschenden Gesellschaft vorgetragen wurde. Wir haben auch im Kanton Bern die Bluterkrankheit. Dieses Leiden besteht in der Unfähigkeit des Blutes, zu gerinnen. Infolge dessen bedeutet jede kleine Verletzung, deren Bluten nicht aufhört, eine schwere Gefährdung. Und mehr noch: auch wenn äussere Verletzungen vermieden werden, kommt es doch sehr häufig zu inneren Blutungen, vorab in den Gelenken, und es entstehen schwere Gelenkerkrankungen.
Die Krankheit ist erblich und absolut sicher erkennbar. Ihr Erbgang ist genau bekannt. Sie befällt nur männliche Personen, wird aber durch weibliche Personen, ohne dass diese selbst Bluter sind, übertragen. Dies ist in den Bluterfamilien der Fall bei einem Teil der Schwestern von erkrankten Brüdern. In der nächsten Generation werden wieder die Hälfte der gesunden Mädchen Ueberträger: von den Knaben aber sind durchschnittlich wieder die Hälfte bluterkrank. Auch sie übertragen natürlich, wenn sie Nachkommen haben, die Krankheit.
Ueber diese reinen Tatsachen hinaus bestehen hier schwerwiegende
Zusammenhänge zwischen Erbkrankheit, Nachkommenfrage,
ärztlicher Kunst, Gesetzgebung und Volkswohlfahrt.
Heute ist die Bluterkrankheit selten, weil die meisten Bluter
in jungen Jahren sterben. Aber jetzt kann man die äusseren
Blutungen bei Blutern durch Behandlung der Wunde mit Frauenmilch
stillen. Während die Bluter bis heute schon in der
Jugend an gelegentlichen Verletzungen verbluteten, können sie
jetzt gerettet werden. Sie werden in Zukunft weit häufiger ins
heiratsfähige Alter kommen. Also wird sich die Krankheit stärker
in unserer gesunden Bevölkerung ausbreiten als bisher,
zumal ja recht leicht bei den Enkeln schon vergessen ist, wie es um den Grossvater stand. So selbstverständlich die Hilfe des Arztes ist, so dringend ist hier eine aufklärende Eheberatung, und so schwerwiegend ist überdies die Frage des Eheverbotes, die dem Gesetzgeber gestellt bleibt, und die bei diesem, wie bei andern Erbleiden um so vernehmlicher zum Aufhorchen zwingt, je grösser die ärztliche Kunst wird. Dabei ist klar, dass sich hier die menschliche Gesetzgebung nach den biologischen biologischen Gesetzen richten muss. Denn jene kann sich anpassen, diese aber sind ehern und ewig.
Kehren wir nun von der Praxis zum reinen wissenschaftlichen Gedanken zurück. Sind durch die Erbanalyse Mendels und vieler anderer die Erbfaktoren als theoretische Notwendigkeit bewiesen, so stellt sich sofort die weitere Frage: Wo in den Zellen liegt dieses Erbgut? Die Erforschung dieser Frage ging während 30 Jahren einen von der Mendelschen Richtung ganz unabhängigen Weg, denjenigen der Mikroskopie. Sie ging überdies aus von der allgemeinen Erkenntnis, dass beide Eltern am Erbgang der Rasse durchschnittlich gleich beteiligt sind.
Das erste mikroskopische Ergebnis war, dass die beiden Geschlechtszellen (die Eizelle und die Samenzelle) verschieden im Plasma, jedoch im Kern und zwar in seinen Chromosomen vollkommen oder fast vollkommen identisch sind. Diese auffälligen Kerngebilde, Schleifen oder Stäbchen oder Kugeln, werden bei jeder Zellteilung wiedergesehen und werden mit einer erstaunlichen, fast formal mathematischen Exaktheit von einer Zelle auf die Tochterzellen weitergegeben.
Der zweite grosse Schritt war, dass diese Chromosomen
Träger verschiedener verschiedener Gen- oder Erbfaktorengruppen sind
(Boveri). Damit wurde die Situation für einen Zusammenschluss
der mikroskopischen und der Vererbungsforschung reif.
Morgan und seine Schule haben in 20 jähriger Arbeit
bei einigen hundert Fruchtfliegenrassen ebenso viele verschiedene
Erbanlagen nachgewiesen und haben gezeigt, dass diese
Gene in einer ganz bestimmten Reihenanordnung in den vier
verschiedenen Chromosomen jeder Fruchtfliegenzelle liegen müssen.
Sie haben hypothetische Genkarten entworfen;
für das kleinste Chromosom eine kleine mit wenigen Genen, für die langen Schleifen entsprechend genreichere.
Aber immer hatte noch niemand die Gene gesehen. Vielmehr war ihre Anwesenheit und ihre besondere Lage in den Chromosomen nur indirekt erschlossen worden. Sie waren zu klein um sichtbar zu sein. Denn die Chromosomen der Fruchtfliege, für die man die Genkarten ausgearbeitet hatte, sind in den meisten Zellen und auch in den Eizellen selbst höchtens 3-4 Tausendstel eines Millimeters lang. Wenn auf dieser Strecke einige hundert körperliche Gene liegen sollen, so kann auch das beste Mikroskop und Auge sie nicht als gesonderte Teilchen unterscheiden.
Der entscheidende weitere Fortschritt ist erst fünf Jahre alt. Die Fruchtfliege hat in ihren Speicheidrüsenzellen besonders grosse Chromosomenschleifen. Diese sind etwa 150 mal so gross wie die Chromosomen der übrigen Zellen. Sie haben uns in eine hundertfach vergrösserte Chromosomenwelt versetzt.
Diese Speicheldrüsenchromosomen haben eine charakteristische Querstruktur, die etwa — ins Grosse übertragen — einer unregelmässigen Millimeterteilung auf einem Meterstab gleicht. In diese Masstabstruktur haben Painter und Bridges in den letzten drei Jahren die Genkarten eingesetzt und wahrscheinlich gemacht, dass die einzelnen Querscheiben die Erbfaktoren die Gene selbst sind. Wie kann man, werden Sie fragen, einen solchen Nachweis führen? Er wird möglich durch Untersuchung der Chromosomen bestimmter defekter Fliegenrassen. Dann entspricht dem Eigenschaftsdefekt der werdenden oder fertigen Fliege ein bestimmter Strukturdefekt im Chromosom. Er liegt dort, wo er nach der Genkarte zu erwarten ist. Gewisse Querscheiben oder Scheibengruppen fehlen. Feinste mikroskopische Arbeitsweise und subtiles Zuchtexperiment haben sich zur Einheit verbunden.
Es verlohnt sich, diese entscheidende Phase im Nachweis der
materiellen Erbfaktoren noch etwas genauer zu betrachten. Die
Schwierigkeit des sicheren Nachweises liegt auch hier trotz der
,,Riesenchromosomen" in der Kleinheit und der grossen Zahl der
Einzelelemente. Die Querscheibenzahl beträgt nach Bridges für
alle vier Chromosomen der Fruchtfliege zusammen rund 5000.
In der bestuntersuchten Schleife liegen mikroskopisch ungefähr 1024 Querscheiben, deren Dicke innerhalb einiger Zehntausendstel eines Millimeters schwankt. Für das gleiche Chromosom ist auch der Besitz an Erbanlagen ziemlich gut bekannt: es muss auf Grund der Zuchtanalyse rund 970 Gene enthalten. Die beiden Zahlen, die sich genau decken sollten, stimmen ziemlich gut zusammen. Aber naturgemäss ist der entscheidende Nachweis, dass in einem bestimmten Defektfall wirklich nur gerade eine bestimmte Querscheibe von den 1024 fehlt, schwer zu führen.
So hat die Zellgenetik ihr Ziel erst zum Teil erreicht. Sie ist nahe daran, die einzelnen materiellen Erbfaktoren nachzuweisen. Ihr Ziel ist, für die Erbmasse das zu erreichen, was der Physiker Laue vor zweieinhalb Jahrzehnten für den Aufbau der Kristalle erreichte, als er mit Röntgenstrahlen-Photographie die Anwesenheit bestimmter Atome und Atomgruppierungen bei Kristallen nachwies. Für den neuaufbau der Chromosomen dienen freilich die Röntgenstrahlen dem Genetiker direkt nicht. Wohl aber leisten sie ihm heute indirekt einen unschätzbaren Dienst. Sie haben ihm die Erbanalyse ungemein erleichtert, denn durch Röntgenbestrahlung wird bei der Fruchtfliege die Bildung neuer Rassen in vielfachem Mass gesteigert.
Es ist wahrscheinlich, dass die Grösse der einzelnen Gene innerhalb einiger Millimeter-Zehntausendstel liegt. Man kommt mit dieser Grössenordnung in die Dimensionen der organischen Moleküle und die nächste Frage lautet: welcher Art sind diese Genmoleküle oder Molekülgruppen, die trotz ihrer gegenüber der Eimasse verschwindenden Kleinheit in gewissem Grade die ganze Entwicklung steuern und beherrschen? Diese Frage gehört der Zukunft.
Bridges nennt die Gene "die Regierung unseres Körpers, unseres
Zellenstaates", und er hat nicht unrecht. Unsere Regierung
besteht also aus einigen 1000 Mitgliedern, ein erstaunlich
grosser Regierungsrat. Merkwürdiger aber und geradezu ein
Widerspruch ist, dass die vielen Millionen Zellen unseres Körpers
alle den gleichen Genbestand, also die gleiche 5000 köpfige
Regierung haben und sich trotz dieser vollendeten Gleichschaltung sehr verschieden entwickeln: die einen werden Hautzellen, die andern Muskelzellen, die dritten Nervenzellen, die vierten Knorpelzellen usw., alles dies mit oder trotz der gleichen Genregierung.
Damit schwingt unsere Betrachtung wieder an den Ausgangspunkt zurück. Es wurde im Anfang des Vortrages von der fundamentalen Doppelheit jeder Zelle gesprochen, vom Plasma und vom Kern. Wenn die Chromosomen des Kerns mit Bridges die Regierung enthalten, ist dann das Plasma das Volk, die formbare, homogene Masse? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir wieder von der Tatsache der Eiarchitektur ausgehen. Im Zellplasma sind von Anfang an bestimmte verschiedene Bereiche vorhanden. Im Froschei befindet sich, um ein Einzelbeispiel zu nennen, im Aequator ein halbmondförmiger grauer Bereich, er bildet später die primitive Wirbelsäule, sowie rechts und links davon die grosse Muskulatur und noch andere Organe. Ein dicht davor liegender Bezirk liefert Hirn und Rückenmark.
Es sei deutlich gesagt: diese Organe sind im Ei oder in den ersten Stadien, zu denen sich die Eikugel aufteilt, noch nicht als solche da. Sie sind auch noch nicht in einem Vorzustand da, der dem späteren irgendwie gleicht; aber dennoch sind sie in unsichtbaren und verschwommenen Grenzen örtlich vorbezeichnet.
Bis die beim Ei und kurz nachher noch einfachen Bezirke wirklich Organform bekommen, gehen die merkwürdigsten Umgestaltungen vor sich, und mit ihnen geht der Keim gleichzeitig vom mosaikartigen Ruhezustand, den ich bisher beschrieben habe, in die eigentliche Dynamik der Entwicklung über. Man kann diese Umformungen mit einem Kunstgriff nach der Methode von W. Vogt leicht sichtbar machen, indem man einzelne begrenzte Stellen des Eies oder der jungen Keimkugel mit unschädlicher Farbe tränkt. Die Zellen nehmen manche solche
Farben, die in Agar-Plättchen dargeboten werden, begierig auf und halten sie (zum Beispiel Nilblausulfat oder Neutralrot) lange Zeit fest, ohne aber den Nachbarzellen Farbe mitzuteilen.
Färben wir in dieser Weise einen bestimmten Bereich auf der
Oberseite der Eikugel, so sehen wir, wie dieser Bezirk sich
am zweiten Entwicklungstag in die Länge streckt und dann eine breite Platte mit seitlichen Wülsten bildet. Kurz darauf rücken diese Wülste zusammen, strecken sich weiter, schliessen sich zum Rohr und verschwinden längslang unter der Rückenhaut. Es ist aus dem ,,präsumptiven" Neuralbereich des Eies zuerst die Neuralplatte und jetzt das Hirn und Rückenmark entstanden. Man sieht beide, wenn der ursprüngliche Eibereich blau markiert wurde, unter der Haut weiter als bläuliches Rohr.
Wird dagegen der schon genannte graue Halbmond an verschiedenen Stellen mit Farbe markiert, so sieht man im Lauf des zweiten Tages diese farbig markierten Stellen auf einem Punkt zusammenlaufen und dort, wie von zielstrebigen Kräften getrieben, ins Keiminnere verschwinden. Sie bilden einen ins Innere vordringenden Schlauch, den Urdarm. — Diese Wandlungen, diese schrittweise Gestaltung der Embryonalform gehört zu den stärksten embryologischen Eindrücken. Und dabei wird dem Betrachtenden bewusst, dass die Mittel der Formwandlung immer sich ähnlich bleiben: Taschenbildungen, Einstülpungen, Leisten- und Platten-, Wülste-, Rinnen- und Rohrbildungen sind solche Entwicklungsrezepte.
Ich habe schon oben hervorgehoben, dass beim Amphibienkeim
der äquatoriale graue Halbmond eine besondere Rolle spielt.
Seine Leistung fällt in eine besonders wichtige Entwicklungsphase,
die Gastrulation. Aus dem Ei entsteht durch die Furchung
die vielzellige Hohlkugel, die Blastula, die wir mit einem Globus
verglichen haben. Dann wandert, wenn wir das Bild fortführen,
die südliche Halbkugel samt dem äquatorialen Halbmond
in die nördliche Halbkugel ein: die Blastula gastruliert.
Durch diese grundlegende, in ihrer Mechanik noch immer unverstandene
Gestaltungsbewegung wird aus der einschichtigen
Hohlkugel der zweischichtige Keim mit einer äusseren Wand
und einem inneren hohlen Schlauch, dem Urdarm. Dieser embryonale
Darm hat einen dicken, passiven, mit Dotter beladenen
Boden und ein aktives Urdarmdach, das sofort zu neuen Gestaltungen
übergeht. Es ist vor allen andern Keimbereichen
ausgezeichnet. Seine eigene Entwicklungsleistung ist in hohem
Grade schon im Ei und ebenso in der vielzelligen Blastula
vorbestimmt: es gehen aus ihm die Chorda (eine Vorstufe der
Wirbelsäule), die Längsmuskulatur der Rückenregion und andere innere Organe hervor. Ausserdem aber hat es eine andere grundlegende, von Spemann entdeckte Fähigkeit, die nur ihm zukommt: es bestimmt auch die Entwicklung der übrigen Keimgebiete, es gestaltet, um Worte des Entdeckers zu gebrauchen, "mit organisatorischer Kraft das Ganze." (H. Spemann, Exp. Beiträge zu einer Theorie der Entwicklung, Springer, Berlin, 1936.)
Die übrigen Bereiche, die die "nördliche" Halbkugel des ursprünglichen Keimes umfassen, sind während der ersten Entwicklung in ihrem Werdegang noch nicht fest bestimmt. Sie werden erst durch Stoffe des Urdarmdachs zu ihren besonderen Leistungen "induziert": der dicht aufliegende Bereich wird zu Nervensystem, die weiter abliegenden Bezirke werden zu Haut. Bestimmte Bereiche der Kopfregion werden zu Augen- und andere zu Ohranlagen.
Fehlt das Urdarmdach, so kann sich kein Gebild gestalten, es kann kein Ganzes werden. Wird es früh anormal gespalten, so entwickelt sich eine doppelköpfige Missgeburt oder andere typische Missbildungen, wie sie auch vom Menschen bekannt sind und wie sie lebend bei Kälbern auf der Messe gezeigt werden. Zerfällt endlich das Ei oder der Keim im Hohlkugelstadium aus irgend welchen Gründen in zwei gleiche, völlig getrennte Hälften, jede mit einem halben Urdarmdach begabt, so vermag sich jede Dachhälfte zu einem ganzen Dach zu vervollständigen und es kann aus jedem Halbkeim ein vollständiges Individuum entstehen. Auf diesem Wege entstehen beim Menschen die eineiigen Zwillinge, die ihre Herkunft aus einem Keim durch ihre besonders grosse körperliche und geistige Aehnlichkeit bezeugen.
Es sind von Spemann und seinen Mitarbeitern eine grosse
Zahl von Experimenten zur weitern Analyse der organisatorischen
Leistungen des Urdarmdaches ausgeführt worden. Einer
dieser Versuche ist besonders fesselnd und aufschlussreich und
soll hier als Beispiel dienen. Ich will ihn das Molchzahn-Hornkieferexperiment
nennen. Molchlarven haben ein breites Maul
mit richtigen Zähnchen. Das Maul der Froschlarven aber ist
schmal; es hat keine Zähne, statt dessen hat es Hornkiefer. Die
beiden Bildungen sind von grundsätzlich verschiedener Bauart. Die Zähne sind unseren Zähnen, die Hornkiefer aber wären am ehesten unseren Fingernägeln vergleichbar. Es wurde nun in eine junge Molchgastrula lange vor der Zahn- und Mundbildung ein Stück aus der Rumpfwand eines jungen Froschkeimes eingepflanzt, aber nicht in den Rumpf, sondern in den spätem Mundbereich. Am alten Ort wäre das Rumpfgewebe einfach zu Rumpfhaut geworden. Aber jetzt, im Molchmundfeld, bildet die Froschrumpfhaut ein Froschmaul und besetzt es mit Frosch-Hornkiefern.
Sie gestatten einen Vergleich: nehmen wir an, es könnte von einem Fuchsembryo im jüngsten Keimstadium ein Stück spätere Schwanzhaut entnommen und einem Menschenembryo in die zukünftige Ohrgegend gesetzt werden. Dann entstünde aus diesem verpflanzten Stück nicht Schwanzhaut, sondern, weil es sich im Ohrbereich befindet, eine Ohrmuschel. Aber es entstünde kein Menschen-, sondern ein Fuchsohr, weil das Material zwar in ein menschliches Ohrgebiet geraten ist, selbst aber vom Fuchse stammt.
Das gleiche Zellenmaterial arbeitet also ohrgemäss, wenn
es sich im zukünftigen Ohrbereich befindet; es arbeitet maulgemäss,
wenn es sich in der späteren Maulregion befindet,
kurzum, es arbeitet situationsgemäss, verschiedenes
leistend je nach seiner Lage im Keimganzen. Dies
entspricht, jetzt in strenger Konsequenz experimentell bewiesen
und inhaltlich weitergeführt, einer schon 30 Jahre früher
von Driesch formulierten Konzeption. — Das Resultat ist in seiner
allgemeinen Bedeutung ebenso interessant wie in seiner
Begrenztheit. Wir sehen, dass Froschhaut im Molchmundfeld
Mundkiefer vom Froschtypus liefert und dass umgekehrt
die Molchhaut im FroschmundfeId Molchzähne
hervorbringt. Das Froschgewebe passt also seine Entwicklung
dem allgemeinen Organisationsschema des jungen Molchkeimes
an, das Molchgewebe unterstellt sich umgekehrt der Froschorganisation.
In einem Vergleich ausgedrückt: Frosch- und
Molchgewebe verstehen sich gegenseitig. Es gibt während dieser
embryonalen Entwicklung für die allgemeine Organisation
eine allgemeine Amphibien"sprache", die für die beiden recht
verschiedenen Tiertypen in gleicher Weise gilt. Ja, vielleicht gäbe es sogar nur eine allgemeine Wirbeltiersprache.
Zugleich aber hat diese Schicksalsbestimmung ihre Grenze: wenn das Froschgewebe seiner Lage nach im Molchkeim Mundorgane liefern soll, so tut es dies nach Froschart; das Molchgewebe seinerseits tut es im Froschbereich nach Molchart. Hier spricht, um das eben gebrauchte Bild weiter zu führen, jedes Gewebe seinen eigenen angeborenen, artbegrenzten Dialekt.
Es gehen also hier zwei wichtige Dinge durcheinander. Einerseits das Herkunftsgemässe: eine Erbbestimmung im engeren Sinn. Sie hat zur Folge, dass Froschgewebe, bildlich ausgedrückt, nur Froschantworten gibt, Molchgewebe nur Molchantworten. Vielleicht ist sie nur durch den Kern, die Gene gegeben. Zugleich aber gelten topographische topographische Faktoren: Gestaltungsbedingungen. Auch sie sind erbbestimmt, aber in anderer Art durch die Architektur im Eiplasma. Mit andern Worten: es gibt zwei fundamentale Entwicklungsvorgänge; auf der einen Seite den Werdegang des Körpers als Summe zahlreicher Einzelmerkmale — hauptbeteiligt sicher der Kern —, andererseits die Entwicklung zum gestalteten Individuum durch regionale Organisation — hauptbeteiligt die Plasmabereiche. Beide Vorgänge laufen gleichzeitig ab, sich vielfach durchkreuzend, ablösend und verflechtend. Ihre Trennung ist für die Forschung eine äusserst schwierige und zum grössten Teil noch zu leistende Aufgabe. Es scheint, dass viele Varianten der Interessengemeinschaft möglich sind.
Jetzt verstehen wir etwas besser auch das sonderbare Gesetz, dass die Gesamtheit der Gene in allen Zellkernen gleich gegenwärtig ist. Die Gene des Kerns machen die Zellen zu Alleskönnern mit einem grossen Register verschiedener Fähigkeiten. Aber je nach der topographischen Situation im Keim werden aus diesem Register andere Fähigkeiten aufgerufen: Gleichartigkeit in der Befähigung, Verschiedenheit in der Auswahl ergeben den komplizierten und zugleich in allen Teilen abgestimmten Bau.
Nach zwei Richtungen hin ist dieses Bild zu einfach. Erstens:
nach der gegebenen Beschreibung wären die Gene, die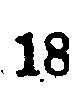
Bridges als Regierung bezeichnete, der Architektur des Eies und den verschiedenen Keimfeldern untergeordnet. Man kennt aber auch Gene, die gerade diese Architektur beeinflussen, beim Menschen vielleicht die asymmetrische Lage mancher Organe und die Links-Rechtshändigkeit. So ist es wahrscheinlich, dass auch die Ausbildung der verschiedenen Keimfelder nicht ohne die Mitwirkung von Genen zustande kommt.
Zweitens: Unter Menschen verbindet man mit dem Begriff Organisator etwas selbstherrliches, befehlendes, mit dem Begriff der zu organisierenden Masse etwas untergebenes, gehorchendes. Diese Vorstellung müssen wir beim tierischen Organisationbereich, der die benachbarten Gewebe zu bestimmten Leistungen aufruft, beiseite lassen. Bezeichnen wir, um einen kurzen Ausdruck zu haben, den organisierenden Bereich als Arbeitgeber, die zu organisierenden Bezirke als Arbeitnehmer, so müssen wir sofort hinzufügen: es besteht ein merkwürdig schaukelndes Gleichgewicht zwischen den beiden Partnern. Es ist nicht so, dass der eine nur führt und die anderen nur gehorchen. Vielmehr stellten die weiteren Experimente Spemanns und seiner Mitarbeiter den Anteil der Arbeitnehmer als immer selbständiger heraus. Vor allem: man kann den Organisator abtöten und er behält doch durch örtliche Stoffabgabe einen grossen Teil seiner Wirkung. Zusammenfassend und bildlich: wenn der Arbeitgeber normal da ist, so entscheidet er. Wenn er nur mit einem Bruchteil seiner Aktivität da ist, so leisten die Arbeitnehmer doch das Ganze. Wenn er ganz fehlt, so leisten sie wenigstens noch einen Teil, wenn auch nicht das Ganze.
Wir haben damit einen bedeutsamen Grundzug des lebenden
Geschehens vor uns, der unserer sparsamen Logik schwer fällt:
der natürliche, normale Ablauf vieler Lebensvorgänge ist von
mehreren Seiten her gesichert. Viele Partner arbeiten
zusammen. Die Einheit wird durch kombinative Leistung erreicht.
Scheidet der eine oder andere Teilhaber aus, so können
die übrigen in vielen Fällen auch ohne ihn das Ganze leisten.
Gerade die mehrfache Sicherung lässt uns verstehen, warum das
Leben trotz seiner ungeheuren Verwicklung mit so grosser
Sicherheit arbeitet.
Soeben wurde bemerkt, dass die organisierende Wirkung des Urdarmdachs durch Stoffe geschieht. Die Frage ist: welcher Art sind diese Stoffe? Dieses Problem konnte durch Einführung kleiner Plättchen von Agar (eine Art Gelatine) geprüft werden, die als Trägermasse mit verschiedenen Stoffen getränkt und in junge Keime hineingesteckt wurden. Dann wurde die Entwicklung des Hirn- und Rückenmarkbereichs als Kriterium genommen; sie ist eine Hauptleistung des organisierenden Urdarmdaches. Entwickelte sich nun über dem Stoffplättchen ein zusätzlicher Hirn- oder Rückenmarkbereich, so war die Induktionsfähigkeit des betreffenden Stoffes erwiesen. Es war ein recht unerwartetes Ergebnis, dass sehr verschiedene chemische Stoffe induzieren können. Man kann nicht annehmen, dass alle diese verschiedenen Stoffe auch in der normalen Entwicklung wirksam sind. Vielmehr muss man den Schluss ziehen, dass die Wirkung des normalen Urdarmdachs relativ leicht imitiert werden kann und nichts Spezifisches an sich hat. Das heisst: nicht der lebende Organisator, nicht der Arbeitgeber, sondern die Arbeitnehmer mit ihren Besonderheiten bestimmen den Charakter der Induktion. Ihre Aktion wird allerdings durch den Arbeitgeber ausgelöst, aber nicht auch in ihrem Gang selbst bestimmt.
Kehren wir nun noch einmal zu der Frage nach der Bedeutung der Gene während der Entwicklung zurück. Wenn auch der grundlegende Rohbau des Embryos in hohem Grade eine besondere Leistung der Plasmaarchitektur ist, so sind doch ungeheuer viele weitere Eigenschaften ganz massgebend vom Kern und von einzelnen in ihm enthaltenen Genen beeinflusst. Dies ergibt sich ja schon daraus, dass es viele hundert verschiedene Fruchtfliegenrassen gibt, deren besondere Rasseneigentümlichkeiten auf Genen beruhen. In ähnlicher Weise gibt es zahlreiche von Genen bedingte Eigenschaften beim Menschen, unter ihnen körperliche wie geistige.
Im ersten Jahrzehnt nach der Wiederentdeckung der Mendelschen
Gesetze war die Theorie der Genwirkung noch sehr
einfach. Man könnte die damalige Vorstellung mit einem Rekruten-Scharfschiessen
vergleichen. Die Erbanlage ist die Patrone.
Der Schuss geht in die dem Rekruten zugeteilte Scheibe.
Das Schussloch wäre die der Erbanlage zugeordnete Eigenschaft. — Schon aus dem gröblichen Bilde müssen Sie herausfühlen, dass diese einfache Hypothese nicht ins Schwarze trifft. In der Tat verlaufen die Genwirkungen viel komplizierter. Es ist sicher, dass nahezu jedes einzelne Merkmal auf der kombinierten Wirkung zahlreicher Gene beruht, so wie es ja auch entwicklungsgeschichtlich das Resultat einer langen Reihe von Vorgängen ist. Diese vielfache Bedingtheit der Merkmale ist bei allen gut untersuchten Objekten, bei der Fruchtfliege ebenso wie beim Mais oder bei der Erbse oder dem Löwenmaul nachgewiesen worden. Ein so einfaches Merkmal wie die Länge der Rückenborsten der Fruchtfliege wird von über 30 verschiedenen Genen bedingt. Deshalb ist es auch nicht möglich, von einer einfachen Kausalbeziehung zu reden. — Wahrscheinlich müssen wir dabei die Wirkungen der einzelnen Gene auch in die verschiedenen Phasen des Entwicklungsverlaufs einsetzen. Diese mögen wie Glieder einer Kette aneinandergereiht oder wie Maschen eines Flechtwerks verschränkt sein, schliesslich liefern sie zusammen als Endergebnis eine bestimmte Eigenschaft, z. B. eine Borste von bestimmter Länge.
Auch beim Menschen gibt es Beispiele für diese kombinierten Genwirkungen. Es gibt erblich kurzfingerige Menschen. Die Finger ihrer Hände sind eben gegenüber der Handfläche auffallend kurz. Aber familienweise ist die Kurzfingerigkeit in Einzelheiten verschieden. In dem einen Familienkreis sind bei den Betroffenen alle Fingerglieder vorhanden, aber verkürzt. In anderen Familien fehlt ein Knochenelement ganz, oder es sind nur die Mittelglieder der Knochenreihe abnorm klein geblieben. Die Ursache für diese verschiedenen erblichen Typen ist in der Tatsache zu suchen, dass mehrere Gene in die Entwicklung des Fingerskeletts eingreifen. Zusammen führen sie zu einer normalen Gliederreihe. Dagegen lässt das Fehlen oder die Veränderung des einen oder andern Gelis verschiedene Fingermissbildungen zustandekommen.
So sind wir. zwangsläufig zur Frage gekommen; wie ordnet
sich die Wirkung der im Kern enthaltenen Gene in den ganzen
Entwicklungsprozess ein? Hierüber sind vom Berner zoologischen
Institut an Molchbastarden, von Beadle, Ephrussi und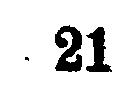
Hadorn an der schon genannten Fruchtfliege, von Kühn und seinen Mitarbeitern an der Mehlmotte umfangreiche Versuchsreihen angestellt worden.
Die Versuche an der Fruchtfliege, speziell diejenigen von Beadle und Ephrussi, beschäftigten sich mit der Ausbildung der Augenfarbe. Es gibt Rassen mit verschieden roten Augen: hellroten, zinnoberroten und hoch- oder wildroten. Diese Abstufungen hängen in ihrer letzten Bildungsphase von zwei Genen ab; nennen wir sie I und Il. Wirken beide, so wird das Auge hochrot, fällt die Wirkung (genauer: der hormonartige Wirkstoff) von II aus, so wird das Auge zinnoberrot; fällt auch der Wirkstoff I aus, so wird es hellrot. Beide Wirkungen sind in einer Richtung verkettet: II kann nur wirken bei Anwesenheit von I; dieses aber ist unabhängig von II. Das Interessante ist nicht nur, dass bestimmte Genwirkstoffe nachgewiesen werden konnten, sondern weiter, dass das gleiche Wirkstoffsystem auch für die Augenfärbung der Mehlmotte gilt. Die Wirkstoffe der Mehlmotte können diejenigen der Fruchtfliege ersetzen und umgekehrt.
Solche Versuche zeigen ein Stück einer Genwirkstoffkette. Eine ähnliche Analyse wurde, auch wieder für Augenfarben, von Kühn und seinen Mitarbeitern bei der Mehlmotte durchgeführt. Die Genhormone werden hier von verschiedenen Organen produziert (von den Geschlechtsorganen und vom Gehirn) und von diesen an die Blutflüssigkeit abgegeben. Diese verfrachtet sie an die eigentliche Wirkungsstätte: zu den Augen. Auch die ersten Ansätze zu einer biochemischen Analyse sind hier, wie bei der Fruchtfliege, vorhanden: Alkohol- und Azetonauszüge aus verschiedenen Geweben sind auch wirksam.
Es vollzieht sich in solchen Experimenten mit bemerkenswert
raschen Erfolgen eine Verbindung der Genetik mit der
Hormonforschung. Hormone sind schon lange als Wachstumsfaktoren
bekannt. Neu ist, dass ihre Bereitstellung von bestimmten
Genen abhängt. So wird bei der Fruchtfliege die normal bedingte
Verwandlung der Larve zur Puppe durch Genwirkstoff gesteuert
(Hadorn) und ähnlich hängt das Wachstum bei bestimmten
zwergwüchsigen Mäuserassen von Genen ab, die eine
unvollkommene Entwicklung der Schilddrüse und Nebenniere, zweier Wachstumsregulatoren, verursachen.
Die Versuche des Berner Instituts beziehen sich nicht auf
einzelne Genwirkungen, sondern auf die Gesamtleistungen des
Kerns und damit des ganzen Genbestandes. Sie beschäftigen
sich mit einer Reihe von Embryonalphasen und haben die
Beteiligung des Kerns bei verschiedenen Organentwicklungen
abgetastet. Untersuchungsmaterial sind Molcheier. Da die
Kenntnis der allgemeinen Entwicklungsfaktoren — ohne Rücksicht
auf Kern und Plasmabeteiligung — bei den Amphibien
durch eine 20 jährige Arbeit der Spemannschen Schule schon
gegeben war, fanden wir eine sichere Grundlage vor, um so
mehr, als der eine Arbeitspartner (F. E. Lehmann) selbst aus
dem Spemannschen Arbeitskreis kam und damit eine weitgehende
persönliche Zusammenarbeit möglich war. Die meisten
Experimente sind Molchkreuzungen, die von einer Art das
Plasma, von einer andern Molchart den Kern bezogen haben.
Ein solches merogonisches Kern-Plasma-System entwickelt sich
über eine bestimmte Entwicklungsstrecke hin normal. Die beiden
Zellpartner sind trotz ihrer verschiedenen Herkunft
zu harmonischer Zusammenarbeit fähig. Dies heisst: Die Anforderungen,
die an das ungleichartige Kern-Plasma-System gestellt
werden, können hier nur allgemeiner Art sein. Wenn
beispielsweise das Plasma vom Fadenmolch, der Kern aber
vom Kammolch stammt, so können sich trotz der Artverschiedenheit
die beiden Partner verständigen, aber nur für eine beschränkte
Entwicklungsarbeit. Von einem bestimmten Stadium
an. kommt es, oft innerhalb weniger Stunden, zu einer durch
den fremden Kern bedingten Erkrankung und der Keim zerfällt.
Die Unfähigkeit zur Weiterentwicklung zeigt an, dass die Ansprüche,
die nun gestellt werden, von dem aus verschiedenen
Arten herstammenden Kern-Plasma-System nicht mehr erfüllt
werden können. Das System ist disharmonisch geworden. Auch
hier sind, wie bei dem Spemannschen Molchzahn-Hornkieferexperiment
ebenso wesentlich die positiven Leistungen wie die
negativen Versager. In einer bestimmten von Hadorn eingehend
bearbeiteten Kombination Fadenmolch-Plasma + Kammolch-Kern
entwickeln sich Chorda und Darm völlig normal. Erstaunlicherweise
gilt dies auch für die Herzanlage. Sie wird zum normal schlagenden Herzen. Weniger gut entwickelt sich die Muskulatur. Sie bleibt unregelmässig in ihrer Anordnung, bringt es aber doch zu richtigen Muskelfasern mit Fibrillen und Querstreifung. — Aehnliche Leistungen oder noch etwas mehr bringt das System Bergmolch-Plasma + Fadenmolch-Kern zustande (de Roche).
Als besonders leistungsfähige Organanlage hat sich die Haut ausgewiesen. Hautbereiche des Faden-Kammolch-Systems können sich bis über die Metamorphose entwickeln und entwickeln dann Fadenmolchcharaktere (Hadorn). Das heisst sie zeigen den Typus des Plasmas. Aus allen diesen Feststellungen geht hervor, dass bei zahlreichen Organen Plasma und Kern verschiedener Arten zusammenpassen, wie wenn sie Partner der gleichen Art wären. Die Entwicklung verläuft in allgemeiner, der Gattung gemeinsamer Bahn.
Für andere Organe aber trifft dies nicht zu. Beim Aufbau bestimmter innerer Gewebe der Kopfregion versagt das Faden-Kammolch-System schon in einem sehr jungen, und beim Ausbau des Nervensystems versagt es in einem älteren Embryonalstadium. Infolge der ersten Versager fallen dann auch andere Kopforgane aus, deren Bildung durch Induktion ausgelöst werden sollte: die Ohrblasen, Kiemen und anderes.
Der Zeitpunkt der Erkrankung lässt uns bei den Organen mit
beschränkter Entwicklungsfähigkeit erkennen, wann hier die
Plasma-Kernarbeit disharmonisch wird. Dieser Erkrankungstermin
ist phasenspezifisch (Lehmann) und liegt je nach
der Bastardkombination in sehr verschiedener Phase: beim
Molch-Salamander-Bastard erkrankt schon die junge Keimkugel
vor der Bildung des Urbanus, und es werden alle
Keimbereiche gleichmässig betroffen. In der Faden-Kammolchkreuzung
verfallen, wie schon bemerkt wurde, bestimmte innere
Kopfgewebe (das Mesoderm) im jungen Embryo, kurz nach der
Urdarmbildung, der Degeneration. Aehnliches trifft zu für die
Kreuzung Berg-Fadenmolch, während die umgekehrte Kombination
(Faden-Bergmolch) ihre Erkrankungen erst später beginnt.
Stets ist dabei der artfremde Kern der Störenfried und die
Plasma-Kern-Systeme der Zellen sind die Entwicklungslaboratorien,
deren Anforderungen der fremde Kern nicht gewachsen ist. So lässt sich aus den verschiedenen Erkrankungsphasen eine Zeittafel für die besonderen Zellforderungen aufstellen, die während verschiedener Entwicklungsperioden erhoben werden. Insbesondere lässt sich eine Uebersicht darüber gewinnen, wann in den verschiedenen Organen die Plasma-Kern-Arbeit nur allgemeiner Art ist und wann besondere artlich beschränkte Forderungen gestellt werden.
Dazu kommt etwas Letztes. Man kann den disharmonischen Zellsystemen und Geweben Hilfe bringen, nicht dadurch, dass man in der Zelle selbst etwas verbessert, sondern dadurch, dass man diesen Geweben eine harmonische Nachbarschaft gibt. Man transplantiert sie in eine Amme, d. h. in einen normalen gleichaltrigen Molchkeim. Die Operation überstehen sie ohne weiteres. Aber nun zeigen die Gewebe ein verschiedenes Verhalten. Die einen sind autonom sie haben ihren Kern-Plasma-Haushalt nur in sich selbst. Die Nachbarschaft normaler Zellen nützt ihnen nichts, ihre Disharmonie wird, wenn sie auf einen bestimmten Zeitpunkt fällig ist, durch gesunde Nachbarzellen nicht aufgehoben.
Die Zellen anderer Gewebe oder Organbereiche mit der gleichen Kern-Plasma-Zusammensetzung sind nicht autonom, sondern beeinflussbar. Hier wird die Disharmonie der beiden Partner durch gesunde Nachbarzellen aufgehoben. Sehr wahrscheinlich ist diese Beeinflussung stofflicher Art. Das heisst die gesunden Zellen geben Stoffe ab, die den Bastardzellen zu Hilfe kommen und ihre Erkrankung verhindern. Morphologisch bilden solche beeinflussbare Zellen wie alle andern wohl abgegrenzte Bausteine. Physiologisch aber sind ihre Kern-Plasmafunktionen in die Gesamtheit Gesamtheit des Keimes einbezogen. Solche Keimbereiche sind gleichsam Betriebe auf Gegenseitigkeit, auf Zusammenwirkung. Es ist dasselbe Resultat, das für Genwirkungen bei der Fruchtfliege und bei der Mehlmotte nachgewiesen wurde.
Damit werden die Kern-Genwirkungen Schritt für Schritt
in den Gesamthaushalt der Entwicklung eingebaut. Aber erst
wenn sie für eine Reihe von Tiertypen und für zahlreiche Organe
und Entwicklungsstadien bestimmt sein werden, erst dann
werden wir ein Gesamtbild besitzen vom Zusammenwirken der beiden Hauptpartner des Eies, des Plasmas und der Genmasse.
Einer der früheren Rektoren unserer Universität, Professor Kohlschütter, hat an dieser Stelle, von der Chemie ausgehend, vom Fachgeist und Universitätsgeist gesprochen. Er hat die Notwendigkeit der vertieften Fachschulung gegen das Ideal der Universitas abgewogen. Dieses Ideal verpflichtet jeden Einzelnen. Es wäre verführerisch, Paralellen zu so mancher Lebenserscheinung, die hier geschildert wurde, auch in der heutigen menschlichen Gemeinschaft zu suchen. Aber sie würden ausserhalb jeder Beweismöglichkeit liegen, und diese sei oberstes Gesetz.
Ein kurzes Wort aber möge noch, anschliessend an Spemann,
über die Vergleichbarkeit der embryonalen Entwicklung mit
psychischen Vorgängen hinzugefügt werden. Nach dem genannten
Autor haben die embryonalen Entwicklungsprozesse,
"mögen sie sich einst in chemische und physikalische
Vorgänge auflösen lassen oder nicht, in der Art ihrer
Verknüpfung mit nichts so viel Aehnlichkeit wie
mit psychischen Vorgängen." (Exp.-Beitr. S. 278). Die Schwierigkeiten
für eine solche Parallele, wenn sie mehr als ein
poetisches Bild sein soll, scheinen dem Sprechenden ungemein
gross. Bedenken wir: Am Anfang der Eientwicklung stehen
einige grössere Keimbezirke, beim Seeigel zum Beispiel zwei,
ein animaler und ein vegetativer. Sie müssen für einen normalen
weiteren Ablauf ein bestimmtes gegenseitiges Grössenverhältnis
haben. Hierin liegt von Anfang an eine Ganzheitsbestimmung.
Stofflich und in ihren Reaktionen (z. B. im
Atmungsbedarf) sind diese Bereiche verschieden und einigermassen
definierbar. Experimentell ist der eine in der Richtung
des andern umstimmbar. Dann gehen diese Bereiche in die
nächsten stufenweise immer genauer bestimmten Keimzustände
über, die wieder ihre stofflichen Eigenschaften und eine bestimmtere
Topographie besitzen. Beides bildet die Grundlage
für die anschliessende Formbildung. So geht die Charakteristik
der Embryonalentwicklung aus von räumlichen, stofflichen
und Struktur-Kennzeichen. Psychologische Begriffe aber kommen gerade vom anderen Ende unserer Erkenntnis her. Eine Brücke, sei es auch nur für die Art der Verknüpfung, ist schwer zu schlagen.
Kehren wir zum Schluss zu unserer Alma Mater Bernensis
zurück. Vielgestaltigkeit im Einzelnen ist, wie bei den
Organismen, auch bei ihr ein Lebenselement. Es soll ihr darüber
die zweite Grundlage des organischen Lebens, die Einheit im
Ganzen, nicht verloren gehen. Sie möge sich entwickeln in der
Mannigfaltigkeit ihrer Fächer, in der Einheit ihres geistigen
Zieles, in der Zusammenarbeit von Lehrern und Jugend, in der
doppelten Aufgabe, zugleich praktische hohe Schule und freie
Forschungsstätte zu sein. Es sei ihr ein Jahr ungestörter fruchtbarer
Arbeit beschieden.






