GLAUBE UND FORSCHUNG
JAHRESBERICHT 1942/43INHALTSVERZEICHNIS Seite I. Rektoratsrede 3 II. Ständige Ehrengäste der Universität 21 III. Jahresbericht 22 a) Erziehungsdirektion 22 b) Dozentenschaft 22 c) Organisation und Unterricht 25 d) Feierlichkeiten und Konferenzen 31 e) Ehrendoktoren 32 f) Studierende 32 g))Prüfungen 34 h) Preisaufgaben 35 i) Stiftungen, Fonds, Stipendien und Darlehen. . . 36 k) Kranken- und Unfallkasse der Universität . . . . 37 l) Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren der Universität 38 m) Zürcher Hochschulverein 40 n) Stiftung für wissenschaftliche Forschung 43 o) Jubiläumsspende für die Universität 49 p) Julius Klaus-Stiftung 53 IV. Schenkungen 57 V. Nekrologe 60
I. FESTREDE DES REKTORS PROF. DR EMIL BRUNNER
gehalten an der 110. Stiftungsfeier der Universität Zürich
GLAUBE UND FORSCHUNG
Es gehört zu den Aufgaben der systematischen Theologie, die Beziehungen zwischen dem christlichen Glauben und der wissenschaftlichen Forschung vom Standort der glaubenden Gemeinde aus aufzuhellen und darzustellen. Das Bestehen einer theologischen Fakultät an der höchsten Stätte wissenschaftlicher Forschung fordert eine solche Rechenschaft geradezu heraus. Das Problem selbst aber, wie sich Glaube und wissenschaftliche Forschung zueinander verhalten, ist nicht bloss ein theologisches, sondern eine Frage, die jeden denkenden Menschen angeht, für den nicht nur die Forschung, sondern auch der Glaube eine Wirklichkeit, einen Wert oder doch eine Möglichkeit bedeutet. Es ist, wie ich hoffe in dieser Stunde zeigen zu können, eine Existenzfrage der Universität, ja der abendländischen Kultur überhaupt.
Wenn wir die beiden Grössen, Glaube und Forschung nebeneinander stellen, so werden die meisten von uns wohl zuerst der Spannung gedenken, durch die seit vierhundert Jahren die Beziehung zwischen Glaube und Forschung belastet ist und die im Bewusstsein vieler das "und"in ein "entweder-oder"wandelt. An sich besteht zwischen Glaube und Forschung ebensowenig ein Spannungs- oder gar Gegensatzverhältnis, als zwischen Kunst und Forschung, und es gab darum Zeiten und wird sie wieder geben, für die das synthetische "und", nicht das antithetische "entweder-oder" charakteristisch ist. Nach einer viele Jahrhunderte umfassenden Zeit der Synthese brach in der Renaissancezeit mit jener elementaren Wucht, die dem geschichtlich Notwendigen eignet, der Gegensatz aus zwischen
dem mittelalterlichen kirchlichen Glaubenssystem und der neuaufstrebenden Wissenschaft. Die Forschung musste sich aus der Bindung an das kirchliche Dogma befreien, ja zu ihm in Gegensatz treten, wenn sie nicht ihrem eigenen Wahrheitsstreben Gewalt antun und sich verkümmern lassen wollte. Das Zeitalter der grossen wissenschaftlichen Entdeckungen wurde so zugleich eine Zeit heftiger Kämpfe zwischen Glaubensdogma und wissenschaftlicher Forschung, die bis ins letzte Jahrhundert hinein andauerten. Mit den Namen Kopernikus, Galilei, Darwin, Reimarus und David Friedrich Strauss dürfte diese Kampftage der letzten Jahrhunderte hinlänglich bezeichnet sein. Der Name Galileis wird uns überdies an die betrübliche Tatsache erinnern, dass die Kirche sich nicht damit begnügte, diesen Kampf mit geistigen Waffen auszufechten, sondern ihn durch den Gebrauch staatlicher Machtmittel verschärfte und vergiftete und dadurch auf Seiten der Forschung ein Ressentiment schuf, das bis heute nachwirkt. Die für die freie Forschung begeisterte Welt hat es der Kirche nicht vergessen, dass sie durch ihren Dogmatismus und durch ihren Bund mit dem Staat dem wissenschaftlichen Fortschritt während Jahrhunderten schwere Hindernisse in den Weg legte.
Diese Auseinandersetzungen zwischen Glaube und Forschung sind um so bedauerlicher, als sie keineswegs in der Sache begründet waren, sondern aus einer Reihe von Missverständnissen entsprangen, die allerdings nicht zufällig, sondern tief in der menschlichen Natur verwurzelt sind.
Das erste dieser Missverständnisse war die Verquickung des christlichen Glaubens mit dem Weltbild der Antike, das zugleich das Weltbild der Bibel ist. Es bedarf einer ebenso mutigen als geduldigen Erziehungsarbeit, bis die Masse der Gläubigen versteht, was die grossen Geister —ein Kopernikus so gut wie ein Kepler oder Newton —von Anfang an wussten, dass nämlich der christliche Glaube als solcher mit der Frage nach der Grösse des Weltraumes oder nach den räumlichen Beziehungen von Sonne und Erde, nach dem Alter der Welt und des Menschengeschlechts oder nach den Einzelheiten der biblischen Geschichtserzählung
überhaupt nichts zu tun hat. Jenes Missverständnis aber, durch das der Glaube mit einem bestimmten Weltbild verkoppelt wurde, entsprang seinerseits einem noch fundamentaleren, das Glauben und Dogma identifizierte. War einmal diese verhängnisvolle Verwechslung geschehen, dass Glaube das Fürwahrhalten der biblischen oder kirchlichen Lehren sei, so war damit auch das biblische Weltbild, das kosmologische so gut wie das historische, sakrosankt, und musste der Konflikt mit der freien Forschung notwendig früher oder später ausbrechen. Es ist schwerlich ein Zufall, dass die Zeit der grossen wissenschaftlichen Entdeckungen dieselbe war wie die, da Martin Luther und Huldrych Zwingli den ursprünglichen biblischen Sinn des Wortes Glaube wiederentdeckten und aus dieser Wiederentdeckung heraus die Reformation entstand. Dass die Reformatoren selbst noch nicht vermochten, die Konsequenzen ihrer Entdeckung nach der Seite der weltbereichen Freiheit hin zu ziehen und so den grossen zeitgenössischen Entdeckungen auf dem Gebiete der Wissenschaft Raum zu schaffen, müssen wir der menschlichen Begrenztheit zugute halten, der auch diese Grossen unterworfen waren.
Ist doch auch heute noch das, was sie entdeckten, vielen Gebildeten, auch vielen wissenschaftlichen Forschern unbekannt, nämlich der fundamentale Unterschied zwischen dem Glauben an ein Dogma und dem, was das Neue Testament selbst Glaube heisst. Nach urchristlicher Anschauung ist Glaube niemals das Fürwahrhalten einer bestimmten, mit Autorität irgendwelcher Art aufgestellten Lehre, also niemals autoritärer Dogmenglaube, sondern das Ergriffenwerden des Menschen von der Wirklichkeit Gottes, die Begegnung der endlichen, kreatürlichen Person mit der unendlichen, absoluten Schöpferperson. Glaube ist also nicht, wie jahrhundertelang gelehrt wurde, das Annehmen einer übernatürlichen, von uns auf Autorität hin anzunehmenden Tatsachen- oder Lehrmitteilung, also niemals blinde Unterwerfung unter irgendeine Lehrautorität, sei diese nun die Bibel oder die Kirche. Glaube ist, recht verstanden, nie blind, sondern eigenes geistiges Schauen, Überzeugung auf Grund eigener
Wahrheitsnötigung, die Aufgeschlossenheit, vielmehr das Aufgeschlossenwerden und sich Aufschliessenlassen für die Wirklichkeit Gottes. Wäre der Glaube die Unterwerfung unter ein Dogma, so wäre er eine geistige Haltung, die mit der des freien Forschers von vornherein, ganz abgesehen von allen Inhalten, schwer vereinbar wäre. Dieses Missverständnis ist leider auch heute noch, bei Anhängern und Gegnern, weit verbreitet, ebenso wie das andere, ihm nahe verwandte, dass Glaube eine Art Hypothese über unwissbare Dinge sei. Wird aber der Glaube, wie dies in den massgebenden Zeugnissen der Bibel geschieht, als Erfahrung von der sich offenbarenden Gotteswirklichkeit verstanden, so besteht ein solcher Gegensatz zwischen dieser und der Haltung des Forschers nicht. Der Glaube ist vielmehr etwas, das trotz aller Verschiedenheit der echten Forschung, jedenfalls dem tiefsten Pathos aller grossen Forschung eher verwandt als gegensätzlich ist.
Anderseits muss nun freilich ebenso klar und bestimmt der Unterschied zwischen Glaube und Forschung hervorgehoben werden. Wissenschaftliche Forschung hat es immer mit der vordergründlichen Wirklichkeit als solcher zu tun. Als Forschende bemächtigen wir uns eines Gegenstandes, als Glaubende geben wir uns der Macht hin, die sich unser bemächtigt. Als Forscher wollen wir hinter das Rätsel kommen, das uns dieses oder jenes Stück der Wirklichkeit bietet, als Glaubende beugen wir uns vor der geheimnisvollen Wirklichkeit, deren man nur gewahr wird, wenn man in Ehrfurcht vor ihr stillsteht. Als Forschende wollen wir uns ein erforschtes Objekt durch Erkenntnis zu eigen machen, als Glaubende werden wir Eigentum dessen, der nie Objekt werden kann, weil er das absolute Subjekt, der schaffende Geist selbst ist. Die Wirklichkeit, die wir erforschen, ist der Inbegriff der Objekte, die wir kurzweg Welt heissen. Gott aber, den wir in ehrfürchtigem Glauben anbeten, und den wir darum nicht erforschen können und nicht erforschen sollen, ist nicht Welt, ebenso wenig als er Objekt ist.
Darum, weil der Glaube im Unterschied zur Objekterkenntnis der Wissenschaft Begegnung mit dem absoluten
Subjekt ist, ist er so eng verbunden und verwandt mit dem Sittlichen.
Einem Menschen recht, d.h. sittlich gut begegnen heisst ihn nicht zum Objekt machen, sondern in ihm die nie zum Objekt zu machende Person, das Subjekt anerkennen. Der Mensch ist nicht, wie die Dinge, einfach ein Stück Welt, sondern, sofern er als sittliches Wesen in Betracht kommt, etwas ganz anderes als Welt, eben die für uns unantastbare geheimnisvolle Wirklichkeit, die Person heisst. Wir dürfen darum nicht über ihn verfügen, wie wir über Objekte, über Weltstücke verfügen dürfen; gerade dieses Nichtverfügendürfen ist das Sittliche und das dem Glauben Verwandte. Einen Menschen zum Gegenstand der Forschung machen — sei es nun der naturwissenschaftlichen oder der psychologischen —ist etwas Grundanderes, als ihm sittlich als einer Person begegnen. Die Anerkennung der endlichen Person als Person, die Achtung vor dem Mitmenschen ist das Sittliche, die Anerkennung der unendlichen, absoluten Person, die Ehrfurcht vor dem Schöpfer ist der Glaube.
Der primitive Mensch, der noch nicht Personwelt und Objektwelt zu unterscheiden vermag, begegnet den Objekten nicht forschend und bemächtigend, wie er sollte, sondern er begegnet ihnen, als wären sie Personen. Er scheitert darum notwendig im Umgang mit ihnen, er muss erst durch Erfahrung lernen, dass die Dinge keine Personen sind. Umgekehrt muss der nur-wissenschaftliche Mensch, d. h. derjenige, der sich allem gegenüber überhaupt ausschliesslich wissenschaftlich verhalten wollte, in der Personwirklichkeit ebenso scheitern, wie der unwissenschaftliche Mensch in der Welt der Dinge; denn er würde auch die Subjekte als Objekte behandeln, er würde weder die menschlichen Personen sittlich achten, noch würde er die unendlich absolute Person in ehrfurchtsvollem Glauben anerkennen.
Die Nichtanerkennung dieser, dem forschenden Verhalten zu
ziehenden Grenze ist nun das zweite fundamentale Missverständnis,
das zum Kampf zwischen Glaube und Forschung führte.
Es ist viel jüngeren Datums als das erste, kirchliche. Es ist vor
allem wirksam in der unkritischen Annahme, der Glaube sei
durch eine angebliche wissenschaftliche Weltanschauung zu ersetzen. Solange der Forscher kritisch ist, weiss er, dass er mit seinem Forschen im Bereich der Phänomene bleibt, dass er als Forschender niemals in jene tiefsten Gründe der Wirklichkeit eindringt, wo über Sinn, Wert, Norm, Ursprung und Ziel der menschlichen Existenz entschieden wird. Diese Fragen gehören nicht in den Bereich der Forschung; sondern in den Personbereich, da sie es alle nicht mit den Phänomenen als solchen, als Stück Welt, sondern mit dem Menschen als Person und im Personzusammenhang zu tun haben. Der kritische Forscher mag sich, solange er forscht, der Stellungnahme zu jenen letzten, zu jenen Glaubensfragen enthalten; aber in dem Moment, wo er behauptet, die Wissenschaft erspare ihm den Glauben, sie gebe ihm das, was anderen der Glaube gebe, oder die Wissenschaft verbiete ihm die letzte Stellungnahme — in diesem Moment überschreitet er unkritisch die dem Forscher gesetzte Grenze und begeht einen Akt doktrinärer Wissenschaftsvergötzung, indem er die Relativität aller wissenschaftlichen Erkenntnis vergisst und Wissenschaft, bzw. Welt zu etwas Absolutem macht.
Wie die mittelalterliche Menschheit darin fehlte, dass sie den Glauben fälschlich übergreifen liess in das Gebiet der objektiven Welterkenntnis, wo die Forschung allein zuständig ist, so fehlt der moderne positivistische Mensch darin, dass er das forschende Verhalten auch auf jenen Bereich ausdehnen will, der nicht der der Objekte, der Welt, sondern der der Subjekte, der Personen ist, und wo darum nicht das forschende, sondern das sittlichgläubige Verhalten angemessen ist.
Damit aber kommen wir an eine Problematik heran, die
von ganz anderem Gewicht ist als die gesamten Kämpfe zwischen
Glaube und Wissen des ausgehenden Mittelalters. Damals ging
es darum, in einer vom Glauben bestimmten Kultur für die
wissenschaftliche Forschung Raum zu schaffen. Heute geht es
darum, in einer von der wissenschaftlichen Forschung beherrschten
Zivilisation für den Glauben und damit für die
Grundlagen aller humanen Existenz Raum zu schaffen. Die
Frage der letzten Jahrhunderte lautete: Kann man als Forschender glauben? Heute muss sie heissen: Kann Forschung ohne Glauben bestehen? Die Katastrophe der abendländischen Kultur und Menschlichkeit, deren Zeugen wir heute sind, zwingt uns, nach den Gründen dieses Zusammenbruchs und das heisst, nach den tiefsten Voraussetzungen unserer Kultur zu fragen.
Bis zum Jahre 1914 konnte sich die Menschheit der Illusion hingeben, der Bestand der Humanität und Kultur und mit ihr der wissenschaftlichen Forschung sei ein gesicherter Besitz, und der Fortgang des kulturellen Lebens sei ebenso selbstverständlich wie der Wechsel der Jahreszeiten. Die furchtbaren Erschütterungen aber, die der erste Weltkrieg, nach ihm die totalitären Revolutionen und zuletzt der aus ihnen erwachsene zweite Weltkrieg über unser ganzes Kultursystem brachten, liess uns zum Bewusstsein kommen, dass keine der geistig-menschlichen Errungenschaften, deren wir uns seit Jahrhunderten erfreuten, gesichert, dass vielmehr sie alle bedroht seien, und dass diese Bedrohung das Ausmass eines Welterdbebens gewonnen hatte, bei dem das Wanken der Fundamente alles, was im Lauf der auf ihnen aufgebaut war, dem Zusammensturz nahe brachte. Aus dem Sicherheitstraum des 19. Jahrhunderts aufwachend haben wir lernen müssen, dass der Bestand der Kultur, und mit ihr auch der Wissenschaft, von gewissen geistigen Voraussetzungen abhängig ist, mit denen sie steht und fällt. Diese Voraussetzungen aber, diese Fundamente, sind alle von der Art, dass die wissenschaftliche Forschung als solche sie weder hervorbringen, noch auch nur zu ihrer Erhaltung etwas Wesentliches beitragen kann. Ja, es besteht sogar zwischen diesen letzten Voraussetzungen, diesen tiefsten Grundlagen aller Kultur und der wissenschaftlichen Forschung insofern die Möglichkeit eines Missverhältnisses, als die Wissenschaft der Kulturmenschheit immer grössere Mittel zur Verfügung stellt, ohne doch für deren sinnvollen Gebrauch entsprechende Garantien geben zu können.
Die Wissenschaft nämlich sagt uns nur, was ist, sie sagt uns
niemals, was sein soll. Sie klärt den Menschen auf über das, was
ihm zur Verfügung steht, aber sie gibt ihm keine Weisung, was er damit anfangen soll. Sie hat es nur mit dem Verstand, nicht mit dem Willen des Menschen zu tun. Die Wissenschaft vermag wohl dem Willen Mittel zu beschaffen, aber sie vermag dem Willen keine Ziele zu geben. Sie sagt, als wissenschaftliche Erkenntnis, nicht was gut und böse, was menschlich und unmenschlich, was gerecht und ungerecht, was sinnvoll und sinnlos ist. Sie vermag als Wissenschaft nichts zu tun zur Lenkung, zur Bändigung, zur sinnvollen Orientierung der menschlichen Elementargewalten. Eben darum, weil sie es immer nur mit den Objekten, aber nie mit der Person als solcher zu tun hat, vermag sie im Bereich der Personenwelt, da, wo es sich um Wert und Unwert, um gut und böse, um heilig und unheilig handelt, nicht ordnend einzugreifen.
Gerade in diesem Bereich aber hatten in den letzten Jahrhunderten Wandlungen stattgefunden, deren Charakter erst deutlich wurde, als sie anfingen, sich im Kulturerdbeben unseres Jahrhunderts zu manifestieren. Jetzt erst, namentlich in jenem Geschehen, das wir als die totalitären Revolutionen bezeichnen können, zeigte es sich, dass die heutige Menschheit in dem Masse, als die Mittel ihrer Willensverwirklichung grösser geworden waren, über die Willensziele, über das, was sein sollte, völlig in Ungewissheit geraten war. In vier Hauptpunkten zeigte sich dieses Versagen:
1. Die europäische Menschheit ist völlig unsicher geworden über das wahrhaft menschliche Willensziel, über das, was sein soll, und verfällt darum allen möglichen Ideologien, die den Willen für inferiore, um nicht zu sagen untermenschliche Ziele in Beschlag nehmen. Die Wissenschaft aber ist nicht in der Lage, an diesem Tatbestand irgend etwas zu ändern, weil sie nicht sagen kann, was sein soll, sondern nur was ist.
2. Auch wo noch aus der Tradition früherer Jahrhunderte
gewisse Willensziele festgehalten werden, wo noch Wertvorstellungen,
Maßstäbe von gut und böse intakt geblieben sind,
fehlt es ihnen an Kraft, sich gegenüber der Dynamik elementarer
Triebziele zur Geltung zu bringen — und die Wissenschaft ist
wiederum nicht in der Lage, diese Ohnmacht des sittlichen Bewusstseins im Kampf mit den triebhaften Elementargewalten irgendwie zu beheben und etwas Rettendes beizusteuern.
3. Als die wichtigste Voraussetzung der abendländischen Kultur erkennen wir je länger desto deutlicher die Anschauung von der Würde der Person als Quelle aller Freiheitsrechte, aller sittlichen Rechtsordnung und aller humanen Kultur. Diese Idee ist aber, infolge der Erschütterung der religiösen Glaubensgrundlagen innerhalb der abendländischen Völkerwelt, weithin unwirksam geworden und hat ganz anderen Auffassungen vom Menschen Platz gemacht. Die Wissenschaft aber vermag als reine Forschung diese Idee weder zu erzeugen, noch sie in Geltung und Kraft zu erhalten.
4. Hinter allem aber steht die Frage nach dem Sinn des menschlichen Daseins überhaupt, auf die die heutige Menschheit keine Antwort hat. Darum ist sie so anfällig für Ideologien, die wenigstens eine Antwort zu geben scheinen, die aber in Wirklichkeit, weil es falsche Antworten sind, die Menschheit in das Chaos stürzen. Auch die Wissenschaft lebt von der Überzeugung, dass es sinnvoll sei zu forschen, und das heisst, dass es überhaupt sinnvoll sei zu leben. Aber sie ist nicht selbst in der Lage, die Frage zu beantworten, ob und warum es einen Sinn gebe und welcher es sei.
Alle diese Fragen, die wir die Fundamentalfragen unserer Kultur heissen können, weil eine bestimmte Antwort auf sie allein ein wahrhaft menschliches Leben möglich macht, sind ausserwissenschaftlicher Art. Sie gehören nicht in den Bereich der Objektwelt, sondern der Personwelt. Der Forscher kann, als Forscher, auf sie weder positiv noch negativ antworten. Antwort aber muss sein, sonst bleibt der Wille des Menschen und mit ihm die ganze Dynamik des Menschheitslebens orientierungslos und den Elementargewalten preisgegeben, die überall da zur Macht kommen, wo der Wille nicht dem Seinsollenden unterstellt ist.
Es ist der fatale Irrtum des Positivismus, jener Ablehnung
des Glaubens aus angeblich wissenschaftlichen Gründen, dass die
Beantwortung jener Fundamentalfragen sich sozusagen von selbst ergebe. Vielmehr hat es sich gezeigt, dass die Antwort auf sie bedingt ist von einer gläubigen Gesamtschau der Wirklichkeit. Das Bewusstsein von der Würde der menschlichen Person z. B. ist nichts Selbstverständliches, sondern das Produkt eines bestimmten Glaubens. Wo dieser Glaube schwindet, da schwindet auch allmählich dieses Bewusstsein der Würde. Die Wissenschaft aber, unfähig diesen Schwund aufzuhalten, müsste letzten Endes ihm selber zum Opfer fallen. Wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, was mit der wissenschaftlichen Forschung alles geschehen kann, wenn das Bewusstsein der menschlichen Personwürde jenen Gewalten weicht, die an seine Stelle die Ideologien der Klasse oder der Rasse setzen. Es ist mit der wissenschaftlichen Forschung bald aus, wenn der Fonds des humanen Glaubens einmal aufgezehrt ist. Dieser Fonds selbst aber wird nicht durch die Wissenschaft geäufnet, sondern durch den Glauben. Ist er aber einmal aufgezehrt, so kann wissenschaftliche Forschung das Chaos nur grösser machen dadurch, dass sie der orientierungslos gewordenen Menschheit unermessliche Machtmittel zur Realisierung eines unmenschlich gewordenen Willens zur Verfügung stellt.
Die Frage, von deren Beantwortung schlechterdings unsere
ganze Zukunft abhängt, lautet: Von woher erhalten wir eine
Sinndeutung der menschlichen Existenz, durch die die elementaren
Triebgewalten dem Geist unterworfen, durch die der
egoistische Wille des einzelnen und der Völker gebändigt und
dem Dienst an der Gesamtheit eingeordnet wird, durch die
gleichzeitig die Freiheit des geistigen und sozialen Lebens in
der Würde der Person gewährleistet wird? Kein ethischer Imperativ
als solcher vermag diese Sinndeutung zu geben; denn der
sittliche Imperativ als solcher ist nur dann glaubwürdig und
machtvoll, wenn er selbst in einer Sinndeutung der Existenz
begründet ist. Nur dasjenige Sollen überzeugt uns und nimmt
uns gefangen, das in der Wahrheit begründet ist. Anders gesagt:
Nur dasjenige Ethos der menschlichen Personachtung hat
Überzeugungskraft, das aus der Ehrfurcht vor der absoluten
Personwahrheit entspringt. Die sittliche Achtung, die nicht in der religiösen Ehrfurcht gründet, ist oberflächlich und hat keine geschichtliche Widerstandskraft. Nur das Bewusstsein von der Würde der Person, das im Glauben an eine göttliche Bestimmung seinen Grund hat, vermag dem Eindruck der tatsächlichen Unwürdigkeit und dem Anspruch entwürdigender Suchte standzuhalten.
Es gibt viele Arten des religiösen Glaubens. Es gibt aber nur einen Glauben, in dem der Trieb dem Geist untergeordnet wird ohne verneint zu werden, in dem der egoistische Wille dem Gemeinschaftsdienst untergeordnet wird, ohne die Freiheit der Person zu gefährden, in dem der Sinn der menschlichen Existenz in der ewigen Gotteswahrheit gefunden wird, ohne damit den Menschen dem irdisch geschichtlichen Leben zu entfremden, nämlich jener Glaube, der als Sinn der Existenz die heilige Liebe erkennt. Was ist Liebe anderes als Gemeinschaft in Freiheit, Anerkennung der Personwürde ohne Verneinung der schöpfungsmässigen Natur? Es ist der christliche Glaube, welcher den Sinn des menschlichen Lebens als Bestimmung zu der Liebe deutet, die sich als Ursprung und Ziel alles Daseins offenbart.
Dieser Glaube ist unbeweisbar und liegt gänzlich ausserhalb
der Reichweite wissenschaftlicher Forschung. Das gehört zum
Wesen des Glaubens, ja zum Wesen alles Personhaften. Auch
das Sittliche ist unbeweisbar. Beweis gibt es nur im Bereich
des Objekthaften, nicht in der Personwelt. Hier tritt an die
Stelle des Beweises die Entscheidung des Vertrauens und der
Liebe. Göttliche Liebe kann nur in Vertrauen und Liebe erkannt
werden, sie ist unbeweisbar wie alle Fundamente unserer
Existenz. Das sollte uns nicht befremden. Ruht doch auch die
Mathematik auf unbeweisbaren Axiomen, die gewisser sind als
alles, was durch Beweis von ihnen abgeleitet wird. Es sind
unmittelbare Gewissheiten, sie stammen aus einer geistigen Schau.
Auch der christliche Glaube ist eine solche Schau, nämlich das
Innewerden der sich offenbarenden göttlichen Wirklichkeit. Aber
diese Schau unterscheidet sich vom sonstigen Schauen dadurch,
dass sie von uns einen Preis fordert, den jenes nicht fordert.
Der Glaube fordert zu seinem Vollzug die Preisgabe der menschlichen Selbstherrlichkeit.
Damit ist folgendes gemeint. Der Mensch sieht sich von
Natur als Mittelpunkt seiner Welt an, um den sich alles drehen
muss. Diese Selbstbehauptung des Ichs als Mittelpunkt ist die
stärkste Macht unseres natürlichen Lebens. Aus diesem selbstherrlichen
Willen des Menschen, der Mittelpunkt zu sein, erfolgt
der Kampf ums Dasein, der die Gemeinschaftsordnung und mit
ihr die Kultur der Menschheit bedroht. Darum heisst die Lösung
des Menschheitsproblems, abstrakt formuliert: Wie ist es möglich,
den Willen des einzelnen Ichs, der Mittelpunkt zu sein, so zu
überwinden, dass die Freiheit nicht zerstört wird? Die Antwort
muss lauten: Dadurch allein ist dies möglich, dass die einzelnen
Iche, statt selber Mittelpunkt zu sein, einen gemeinsamen
Mittelpunkt haben. Diese Anerkennung des gemeinsamen Mittelpunktes
ist der Glaube, als gehorsame Unterordnung unter die
unbedingt überlegene Wirklichkeit Gottes. Die Folge dieser
Anerkennung des gemeinsamen Mittelpunktes aber ist die Liebe,
als die Anerkennung der unbedingten Gleichwertigkeit des Du
gegenüber dem Ich. Jedoch nur da, wo der Wille Gottes als
Liebe erkannt wird, kann sich ihm der Mensch in Freiheit unterwerfen,
und nur da kann er in Ehrfurcht gegen Gott den Nächsten
achten und lieben. Dieser Glaube fordert darum vom Menschen
den Verzicht auf seine Selbstherrlichkeit und gibt dem Leben
seinen Sinn in der ewigen göttlichen Liebe, als Gemeinschaft in
Freiheit. Dieser christliche Glaube hat seinen Namen davon,
dass er die göttliche Liebe nicht postuliert, nicht spekulativ
deduziert, sondern ihr als der absolut überlegenen Wirklichkeit
begegnet in der geschichtlichen Person Jesu Christi. Dieser
Glaube findet darum soviel Widerstand, nicht etwa weil er
unserer wissenschaftlichen Erkenntnis widerspräche, sondern
weil er von uns den Verzicht auf das selber Mittelpunktsein
fordert zugunsten des allen übergeordneten Schöpferwillens und
zugunsten des gleichen, relativen Rechtes jeder anderen menschlichen
Person. Durch diesen, recht verstandenen christlichen
Glauben wird das gewährleistet, was wir als Fundament für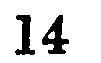
unsere Kultur gefordert haben: eine Sinndeutung der Existenz, durch die der Trieb dem Geist untergeordnet wird, ohne ihn zu vernichten; durch die der natürlich egoistische Wille in einen gemeinschaftswilligen umgewandelt wird, ohne dass die Freiheit; des einzelnen in der Gemeinschaft untergeht; durch welche die Würde der Person begründet und zugleich ihr Anspruch begrenzt wird dadurch, dass sie in der göttlichen Wahrheit ihren Grund, ihr Ziel und ihre kritische Norm erkennt.
Was ist zu diesem Glauben von Seiten der Wissenschaft zu sagen? Zunächst dieses Negative, dass er weder wissenschaftlich noch unwissenschaftlich ist. Er ist nicht wissenschaftlich, denn er liegt ausserhalb des Bereichs, in dem Wissenschaft zuständig ist. Er ist aber auch nicht unwissenschaftlich, insofern die Wissenschaft, wo sie sich kritisch ihrer eigenen Grenzen bewusst bleibt, nichts gegen ihn einzuwenden hat.
Aber mit diesem Negativen ist sicher nicht alles gesagt.
Die Wissenschaft muss ja, wie wir sahen, selber eingestehen, dass sie Fundamente der Kultur voraussetzt, die sie selbst nicht zu schaffen vermag. Die Frage ist, ob die Wissenschaft Anlass habe oder nicht, aus ihren eigenen Interessen heraus diesem Glauben gegenüber irgend einem anderen den Vorzug zu geben. Diese Frage ist aus folgenden Gründen zu bejahen:
Erstens: Wissenschaftliche Forschung kann nur gedeihen in
einer menschlich geistigen Atmosphäre, innerhalb deren der
Geist mehr gilt als der Trieb. Denn Wissenschaft selbst ist das
Produkt des Geistes, nicht des Triebes. In einer von materialistischen
oder vitalistischen Anschauungen beherrschten Welt
steht der Geist niedrig im Kurs, mit ihm aber auch alle geistige
Arbeit, die nicht unmittelbar der Triebbefriedigung dient. In
einer materialistisch oder vitalistisch orientierten Gesellschaft
mag sich die wissenschaftliche Kultur erhalten, solange noch
Antriebe aus einer früheren nicht materialistischen Epoche vorhanden
sind. Sind aber diese einmal erschöpft und ist das Geistige
einmal gründlich diskreditiert, so wird auch von höherem
wissenschaftlichem Streben nicht viel übrig bleiben. Die Dekadenz
wird zuerst die Geisteswissenschaften, sodann die Grundlagenforschung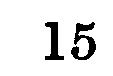
der Naturwissenschaften und der Technik und endlich diese selbst erfassen.
Zweitens: Die Wissenschaft als solche hat alles Interesse daran, dass sowohl die Rechte der Gemeinschaft als auch die der Freiheit des Individuums gewahrt werden. An sich ist wissenschaftliche Forschung ein individueller Akt, der volle Freiheit voraussetzt. In einer kollektivistischen Gesellschaft die dem einzelnen vorschreibt, was er denken soll, und. die ihn für jede Abweichung von der vorgeschriebenen Doktrin bestraft, ist freie Forschung nicht möglich. Freie Forschung aber ist mit Forschung überhaupt identisch. Jedes System, das die Freiheit des Denkens vergewaltigt, ist wissenschaftsfeindlich. Dieser Vorwurf wird ja nun freilich gerade dem Christentum gemacht, und leider nicht mit Unrecht. Aber die Unfreiheit des mittelalterlichen Christentums war nicht die Folge des christlichen Glaubens, sondern die Folge jenes verhängnisvollen Missverständnisses, jenes Pseudoglaubens, mit dem sich der immer so gern dem Gesetz des geringsten Widerstandes folgende Mensch den Anforderungen des wahren Christenglaubens zu entziehen suchte.
Wenn aber daraus gefolgert würde, es sei einer Weltanschauung der Vorzug zu geben, die nur die Freiheit und nicht zugleich die Gebundenheit des Menschen betont, so möge doch auch die Warnung nicht überhört werden, die uns aus der Geschichte dieses schrankenlosen Liberalismus im letzten Jahrhundert entgegenkommt. Wissenschaft ist freilich zuerst und zumeist Angelegenheit des einzelnen und seiner Freiheit. Aber was ist die Freiheit des einzelnen, und was kann sie für einen Gehalt haben, wenn sie nicht getragen ist von einer Gemeinschaft, die kraftvoll jeden einzelnen gegen die Einbrüche des Chaos schützt? Was ist eine Freiheit, die in Anarchie ausartet? Und wo anders ist gegen die Ausartung der Freiheit in Anarchie Gewähr geboten als da, wo die Freiheit des einzelnen in einer höheren Ordnung begründet ist? Dazu kommt, dass wissenschaftliche Forschung nicht nur ein individuelles, sondern mehr und mehr auch ein gemeinschaftliches Werk geworden ist. Von der Wissenschaft aus muss eine solche Glaubensgrundlage
der Kultur gefordert werden, die Freiheit in Gemeinschaft und Gemeinschaft in Freiheit verbürgt.
Drittens: Die Beziehung von Wissenschaft und Glaube ist aber eine noch direktere. Echte, grosse Wissenschaft bedarf eines hohen wissenschaftlichen Pathos der Ehrfurcht und eines strengen Ethos der Gewissenhaftigkeit und der Verantwortlichkeit. Gewiss, es gibt einen wissenschaftlichen Betrieb, der ohne jenes grosse, echte Pathos möglich ist, welches den wissenschaftlichen Pionier auszeichnet. Aber diese wissenschaftliche Kärrnerarbeit kommt nur dort in Gang, wo Könige bauen, und Könige im Reich der Wissenschaft sind immer Menschen, die von einer heiligen Ehrfurcht vor der Wahrheit erfüllt sind. Es dürfte wohl nicht schwer halten, nachzuweisen, dass alle grossen Leistungen in der Wissenschaft von gläubigen, nicht von ungläubigen Menschen hervorgebracht worden sind. Wo nicht die Ehrfurcht vor einer göttlichen, ewigen Wahrheit den Forschergeist in Bewegung setzt, da wird er Grösstes nie erreichen. Und zwar möchte ich diese Ehrfurcht mit Goethes Wilhelm Meister als eine doppelte ansehen: als Ehrfurcht vor dem, was über uns ist und Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist, d. h. eine Ehrfurcht, die zugleich den Stolz der menschlichen Würde und die demütige Anerkennung der menschlichen Grenze in sich trägt.
Noch offenkundiger ist aber die Notwendigkeit des wissenschaftlichen Ethos. Denn ihm untersteht auch der wissenschaftliche Kärrner, nicht nur der grosse Wissenschafter. Ohne Gewissenhaftigkeit und Hingabe, ohne Zucht und Wahrhaftigkeit, ohne Pflichttreue und Opferfähigkeit wird in der Wissenschaft überhaupt nichts geleistet, auch nicht das kleinste saubere Experiment, auch nicht die einfachste philologische Statistik. In einer am ethischen Nihilismus erkrankten Gesellschaft kann auch nicht mehr recht wissenschaftlich gearbeitet werden. Genialität ohne sittliche Zucht wird wenig, durchschnittliche wissenschaftliche Begabung ohne sittliche Zucht wird überhaupt nichts erreichen und leisten. Woher aber soll die sittliche Zucht, das Bewusstsein der Verantwortung, der Wille zum uneigennützigen Dienst kommen, wenn nicht aus dem Glauben,
der diese sittliche Forderung in einer göttlichen Wahrheit verankert? Es mag wohl einzelne ethische Nihilisten unter den bedeutenden und erfolgreichen Wissenschaftern geben. Aber sie können sieh diesen ethischen Nihlismus nur darum ohne Schaden für die Wissenschaft leisten, weil noch genug andere da sind, die keine ethische Nihilisten sind, von deren Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsgefühl auch sie zehren, ohne selbst zur Äufnung dieses Fonds ihren Beitrag zu leisten. Es gehört zu den grossen perspektivischen Fehlern unserer neuzeitlichen Anschauung von der Kultur, dass wir sie viel zu sehr vom Gesichtswinkel des Ausnahmemenschen aus ansehen statt vom Gesichtswinkel derer, die die gesamte Kulturatmosphäre und den Kulturhumus schaffen. Ohne sittliche Kultur der Forscher ist es bald aus mit der wissenschaftlichen Forschung. Die sittliche Kultur aber ihrerseits kann ohne Glaubensfundament, das ihr Sinn gibt, auf die Dauer nicht bestehen.
Endlich — was ist schliesslich Forschung selbst, wenn nicht das beständige Fragen nach der ewigen, göttlichen, über uns allen stehenden Wahrheit? Wer an solcher Wahrheit zweifelt, kann auch nicht ernstlich forschen. Vielleicht gab es grosse Forscher, die es aus irgendwelchen Gründen liebten, den Skeptiker zu spielen, etwa um in eine allzu pathetische Gesellschaft etwas frischen Luftzug zu bringen. Wer aber im Ernst Skeptiker ist, gibt es auf, sich um die Wahrheit zu mühen, die es ja doch nicht gibt. Forschung setzt darum selbst, als Akt, Glauben voraus — gewiss nicht ohne weiteres den christlichen Glauben, wohl aber den Glauben an eine letzte, über uns allen stehende Wahrheit, der wir uns zu beugen haben und die uns doch Anteil gibt an sich selbst.
Es ist darum nicht verwunderlich, dass gerade jene grossen
Bahnbrecher neuer Wissenschaft, trotzdem sie gegen die allzumenschlichen
Vorurteile einer sich selbst übel verstehenden
Kirche zu kämpfen hatten, ein Kopernikus, Kepler, Galilei,
Newton ohne Ausnahme gläubige Menschen waren, und zwar
nicht in einem pantheistisch unbestimmten Sinne, sondern
durchaus im Sinne des christlichen Gottesglaubens. Die Gesinnung,
die Kepler am Schlusse seines Werkes "Fünf Bücher von der Weltharmonie" ausspricht, das die erste Formulierung des dritten Planetenumlauf-Gesetzes enthält, ist auch die jener anderen Grossen im Reich der Wissenschaft.
"O Vater des Lichtes, der du durch das Licht der Natur in uns Verlangen weckst nach dem Licht der Gnade, um uns zum Lichte der Herrlichkeit zu führen! Ich danke dir, du mein Schöpfer und Herr, dass du mich ergötzt hast durch deine Schöpfung, da ich entzückt war über deiner Hände Werk. Siehe, nun habe ich vollendet das Werk meines Berufes, ausnützend das Mass der Kräfte, die du mir verliehen. Ich habe die Herrlichkeit deiner Werke den Menschen geoffenbart, soviel mein beschränkter Geist ihre Unendlichkeit zu fassen vermochte."
Es wäre eine Reihe ähnlicher Aussagen nicht nur von Kepler selbst, nicht nur von seinen unmittelbaren Vorgängern und Nachfolgern, von Kopernikus, Galilei und Newton, sondern auch von Huygens, Priestley, Faraday bis zu den Grossen unserer Zeit, bis zu Julius Robert Mayer, Liebig, Mendel, Pasteur und Plank anzuführen, ganz zu schweigen von jenem vielleicht einzigen Schweizer Forscher, den wir unter die Sterne erster Ordnung einreihen dürfen, dem Mathematiker Leonhard Euler, der einen grossen Teil seiner Zeit und Kraft dazu verwendete, die Wahrheit des christlichen Glaubens in besonderen Schriften gegen die Skeptiker seiner Zeit zu verteidigen. Noch viel leichter, aber vielleicht eben darum auch überflüssig wäre es, solche Zeugnisse aus dem Kreise der grossen Geisteswissenschafter, der Historiker, Philologen und Juristen beizubringen.
Lassen Sie mich zum Schlusse kommen. Es gab eine Zeit,
da musste sich die Wissenschaft ihren Raum innerhalb einer
mehr oder weniger christlich gläubigen Welt erkämpfen. Heute
aber geht es darum, in einer Welt, deren Glaubensgrundlagen
erschüttert sind, und die deshalb der Barbarei und der Unmenschlichkeit
zu verfallen droht, zu den Grundlagen aller
Kultur zurückzukehren, die kritischer Prüfung an den Massstäben,
die für eine sittliche Kultur entscheidend sind, standhalten.
Unsere Kultur, und mit ihr unsere wissenschaftliche
Forschung, kann nur gedeihen in einem Sinnganzen, das auf Gemeinschaft in Freiheit angelegt ist, d. h. aber in dem Sinnganzen, wie es uns der christliche Glaube zeigt. Die Zeiten sind vorbei, wo die Forschung ihre Freiheit einem engherzigen und machtgierigen Kirchenglauben abringen musste. Heute dankt ihr die christliche Gemeinde im Namen des rechten, wahren Glaubens für die Revision des Glaubensbegriffes, zu der die wissenschaftliche Forschung sie nötigte. Der Feind der Wissenschaft steht heute auf einer anderen Seite. Ist die Kirche als Sachwalterin des Glaubens nicht ohne Schuld an jenem unglücklichen "entweder-oder", so ist doch heute die grössere Schuld da, wo im Namen der Wissenschaft dem Glauben der Krieg erklärt wird, ohne zu bedenken, dass man damit der Wissenschaft selbst die Wurzeln abschneidet.
Es ist darum der Universität Zürich nicht unwürdig, sich
heute wieder bewusster und entschiedener als in vergangenen
Jahrzehnten ihrer Anfänge aus der zwinglisch-reformatorischen
Glaubenswelt zu erinnern. Auf nihlistischem Grunde wachsen
keine Universitäten. Der christliche Glaube ist zwar nicht
die einzige Alternative zum Nihilismus, wohl aber seine radikalste
Antithese und darum auch immer seine kraftvollste
Überwindung. Mit diesem persönlichen Bekenntnis glaube ich
als Rektor dieser Universität jener Tradition die Treue zu
wahren, die diese uns allen hochwege Stätte der Wissenschaft
schuf und bis heute erhielt.






