GESETZMÄSSIGKEITEN AUF DEM GEBIETE DER ÖFFENTLICHEN FINANZEN
JAHRESBERICHT 1944/45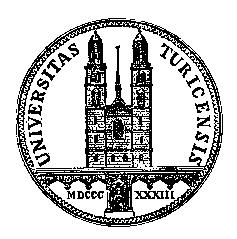
II. Ständige Ehrengäste der Universität 20
III. Jahresbericht 21
a) Hochschulkommission 21
b) Dozentenschaft 21
c) Organisation und Unterricht 25
d) Feierlichkeiten und Konferenzen 31
e) Ehrendoktoren 32
f) Studierende 33
g) Prüfungen 35
h) Preisaufgaben 36
i) Stiftungen, Fonds, Stipendien und Darlehen. . . 38
k) Kranken- und Unfallkasse der Universität. . . . 40
l) Witwen-, Waisen- und Pensionskasse der Professoren der Universität 40
m) Zürcher Hochschulverein 42
n) Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich 43
o) Jubiläumsspende für die Universität 48
p) Julius Klaus-Stiftung 51
IV. Schenkungen 55
V. Nekrologe 57
I. FESTREDE DES REKTORS PROF. Dr EUGEN GROSSMANN
gehalten an der 112. Stiftungsfeier der Universität Zürich
Gesetzmäßigkeiten auf dem Gebiete der öffentlichen Finanzen |
I.
Die Staatswissenschaft hat bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts in der Hauptsache aus blossen Beschreibungen der politischen und wirtschaftlichen Zustände einzelner Länder bestanden. Nichts lag den Verwaltungsbeamten und Inhabern von Lehrstühlen der "Statistik", wie man damals diesen Wissenszweig nannte, ferner als der Gedanke, dass im Gesellschaftsleben irgendwelche Gesetzmässigkeiten walten könnten. Ein genialer Dilettant, der englische Tuchhändler und Musiklehrer John Graunt ist der erste gewesen, der beim Studium der Bevölkerungsbewegung auf gewisse Regelmässigkeiten in der Sterblichkeit stiess und seine Beobachtungen im Jahre 1662 veröffentlichte. Die politischen Arithmetiker, wie die Statistiker in der Folge in England hiessen, setzten diese Untersuchungen fort und um die Mitte des 18. Jahrhunderts waren einige Gesetzmässigkeiten in der Bevölkerungsbewegung auch auf dem Kontinent schon so bekannt, dass der preussische Feldprediger Johann Peter Süssmilch seine bevölkerungsstatistischen Studien mit dem Titel versehen konnte: "Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechtes, aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen".
Das Bestreben der Statistiker, auf Grund zahlenmässiger Massenbeobachtungen bestimmte Gesetzmässigkeiten im sozialen Leben nachzuweisen, erreichte den Höhepunkt seiner
Entwicklung, als im Jahre 1835 der belgische Astronom Adolf Quetelet ein umfassendes Werk veröffentlichte, das den bezeichnenden Untertitel "Essai de physique sociale" führte. Der damalige Stand der Statistik erlaubte es allerdings nicht, nach dem Walten von Gesetzen ausserhalb des Bereiches der Bevölkerungsbewegung und der Kriminalität zu forschen, aber grundsätzlich wurde von Quetelet doch a]s Ziel aller zahlenmässigen Massenbeobachtung die Feststellung von Regelmässigkeiten auch auf den übrigen Gebieten des sozialen Lebens, also in der Wirtschaft, in der Politik, in den kulturellen Erscheinungen bezeichnet.
Die Ausführung dieses Programmes hat freilich erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts raschere Fortschritte gemacht. Noch im Jahre 1864, als Adolf Wagner seine scharfsinnige "Sozial-anthropologische Untersuchung der Gesetzmässigkeit in den scheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen" veröffentlichte, ja sogar noch im Jahre 1877, als Georg Mayr eine ähnliche Arbeit herausgab, standen als Anschauungsmaterial im wesentlichen nur die Ergebnisse der Bevölkerungs- und Moralstatistik zur Verfügung. Erst gegen Ende des Jahrhunderts, als infolge der Ausdehnung der Volksrechte auf das Gebiet der Gesetzgebung die Ergebnisse von Abstimmungen das Interesse auf sich gezogen hatten, ist ein Schweizer, Theodor Curti, zum Anreger und Förderer der politischen Statistik geworden und parallel damit ging in allen Ländern die Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstatistik, die dann nach dem ersten Weltkriege einen so grossen Aufschwung nahm, namentlich als die Anwendung der statistischen Methode auf das Gebiet der Konjunkturbeobachtung die hochfliegende Hoffnung hervorrief, dass man eine Art "Wirtschaftsbarometer" konstruieren könne, an dem abzulesen wäre, ob dem wirtschaftlichen Leben eine Periode des Aufschwunges oder des Niederganges bevorstehe.
Die Nationalökonomie hatte nun allerdings nicht auf diesen Moment gewartet. In ihr war die Anschauung, dass in der Volkswirtschaft Gesetzmässigkeiten bestehen, schon viel früher aufgetreten.
Nicht auf Grund umfassender statistischer oder historischer Untersuchungen, sondern durch rein logisches Denken hatten schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts die französischen Physiokraten den Grund gelegt für die Auffassung, dass die Wirtschaft von gewissen "Naturgesetzen" gelenkt werde. Der Gedanke fand den Beifall sowohl der liberalen Schule des ausgehenden 18. Jahrhunderts als auch der sozialistischen Doktrin, die sich, unter der Führung von Karl Marx und Friedrich Engels, zum "ökonomischen Determinismus" bekannte und sich die Ablösung der bürgerlichen Wirtschaftsordnung durch eine sozialistische als eine unentrinnbare, durch die Natur der Dinge gegebene Notwendigkeit vorstellte. Die Auseinandersetzungen über dieses Kernproblem der sozialen Entwicklung erfüllen noch heute die nationalökonomische Literatur, die Tageszeitungen und die Parlamentsverhandlungen und mit ihnen verwoben sind Erörterungen über teils wirkliche, teils bloss behauptete Regelmässigkeiten, die sich auf viele Teilgebiete der Volkswirtschaft beziehen. Es seien nur genannt: das "Gesetz des abnehmenden Bodenertrages", das "eherne Lohngesetz", das Brassey'sche "Gesetz über das Verhältnis von Arbeitszeit und Arbeitsleistung", das "Gesetz der Konzentration des Besitzes", das Schwabe'sche "Gesetz über die Beziehungen von Wohnungsaufwand und Höhe des Einkommens", das Malthus'sche "Bevölkerungsgesetz", die "Quantitätstheorie des Geldes", die Lehre vom "Automatismus der Goldwährung", die Lehre von der "regelmässigen Aufeinanderfolge von Hochkonjunktur und Depression" usw.
Überblickt man die Liste dieser, zum Teil selbst breitesten Kreisen bekannten Gesetze, so fällt auf, dass sich keine darunter befinden, welche sich direkt auf die Vorgänge im Staatshaushalt beziehen. Von "finanzwirtschaftlichen" Gesetzen hört man selten sprechen, und so mag sich der Versuch wohl einmal lohnen, Nachschau zu halten, ob nicht vielleicht doch auch auf diesem Gebiete mehr Ordnung und Regel herrscht, als man gewöhnlich annimmt.
II.
Auf die Frage, ob auf dem Gebiete der öffentlichen Finanzen Gesetzmässigkeiten wahrgenommen werden können, geben die allgemeinste Antwort einige Soziologen, die versucht haben, ihre Methoden und Erkenntnisse ganz besonders auf die Vorgänge im Staatshaushalt anzuwenden. Am meisten Beachtung haben unter ihnen der Italiener Roberto Murray und der Österreicher Rudolf Goldscheid gefunden. Der letztere hat von 1917 an eine Reihe von Schriften über diese Probleme herausgegeben und seiner Auffassung schliesslich in einer für das "Handbuch der Finanzwissenschaft" von Gerloff und Meise! bestimmten Abhandlung über "Wesen und Aufgabe der Finanzsoziologie" die endgültige Form gegeben.
Der Gedanke, der in dieser Arbeit dominiert, ist der, dass die Finanzwissenschaft in ihrer hergebrachten Form sich zu sehr damit begnügt habe, den Zustand der öffentlichen Finanzen rein äusserlich darzustellen und etwa noch Betrachtungen über notwendige oder wünschbare Reformen anzuschliessen. Dagegen habe sie es unterlassen, die tieferen Gründe der Entwicklung zu erforschen. Vor allem die Bedeutung des Krieges und des durch ihn geschaffenen Finanzbedarfes sei nicht genügend gewürdigt worden. "Man kann ohne Übertreibung sagen — so heisst es in jener Abhandlung dass in keiner Phase der Geschichte irgendeine neue Steuer von Bedeutung, irgendeine tiefgreifende Umgestaltung des Zollwesens oder irgendeine sonstige öffentliche Finanzmassnahme von Bedeutung ins Leben tritt, die nicht eine unmittelbare Kriegsfolge gewesen wäre oder Rüstungsausgaben ihre Entstehung verdankte".
Man wird den Kern an Wahrheit, der in diesem Satze steckt, nicht verkennen, wenn man sieht, wie sogar im Finanzsystem eines so friedlichen Staates wie der Schweiz der Krieg immer die treibende Kraft bei allen grossen Finanzreformen gewesen ist. Der Sonderbundskrieg von 1847 hat Grenzzölle, Post- und Münzregal in die Hände des Bundes gebracht, der Krieg von 1870/71 und
die von ihm angeregte Heeresreform haben die Entschädigungen, die der Bund den Kantonen bis dahin noch für die Wegnahme der Zölle zu zahlen hatte, beseitigt und die Militärpflichtersatzsteuer geschaffen, der Krieg von 1914/18 hat zum fiskalischen Ausbau des Zollsystems, zur Einführung der Stempelabgaben, zur Verschärfung der Tabak- und Alkoholbesteuerung und zu temporärer Erhebung einer Bundesvermögens- und Einkommenssteuer geführt und der Krieg von 1939/45 hat die wiederholte Anwendung der "einmaligen" Vermögensabgabe, den Sieg des Quellenprinzips bei der Einkommenssteuer und die Besteuerung des Warenumsatzes gebracht.
Aber nicht nur in der Entwicklung des Finanzsystems durch den Krieg sieht Goldscheid eine soziale Gesetzmässigkeit. Er findet — hierin schon weniger originell — auch in der inneren Politik einen regelmässig zu beobachtenden Zusammenhang zwischen Steuerdruck und umwälzenden Vorgängen. Die Bauernaufstände des 16. und 17. Jahrhunderts, die englische Revolution im 17. und die französische im 18., den Abfall Nordamerikas von England führt er als Belege an. Aus der allerjüngsten Zeit könnte vielleicht noch der Hinweis darauf beigefügt werden, dass das Aufkommen der rechtsrevolutionären Parteien in einigen Ländern erleichtert worden ist durch die Hoffnung bestimmter Kreise auf Ermässigung der Steuerlasten.
Immerhin: weder die Zahl der Kriege noch die der Revolutionen ist so gross, dass bei jenen Zusammenhängen schon von einer erwiesenen "Gesetzmässigkeit"gesprochen werden könnte. Hier fehlt die breite Basis der Beobachtung, die bei der Forschung nach Gesetzen unerlässlich ist. Es hat denn auch Kriege gegeben, die keine starken Spuren in der Struktur des Finanzhaushaltes zurückliessen — so etwa die Kriege der Jahre 1859 und 1866 — und der Steuerdruck ist bei manchen Revolutionen wohl nur neben anderen Faktoren das treibende Motiv gewesen.
III.
Neben dem Versuch, das gesamte finanzpolitische Geschehen aus einer solchen einheitlichen, dem historischen Materialismus nahestehenden, Grundauffassung heraus zu erklären, stehen Entdeckungen von Gesetzmässigkeiten, die sich nur auf Teilgebiete beziehen. Ihre Zahl ist freilich nicht allzu gross und sie können im allgemeinen auch nicht auf das Interesse so breiter Kreise rechnen, wie das der Fall ist bei den Gesetzen, die auf dem Gebiete der Bevölkerungslehre, der Moralstatistik und der Nationalökonomie erforscht worden sind.
Am geringsten ist ihre Zahl in der Lehre von den öffentlichen Ausgaben, während die Lehre von den öffentlichen Einnahmen und vom öffentlichen Kredit mehr und namentlich für die praktische Finanzpolitik bedeutsamere Regeln entdecken konnte.
Dass die Staatsausgaben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte einen fast ununterbrochenen Anstieg zeigen und dass hierin ein fast unabwendbares Schicksal liegt, das ist eine Wahrnehmung, die heute Gemeingut geworden ist. Längst dahin ist der Optimismus des französischen Finanzministers de Villèle, der im Jahre 1828 die Einbringung eines Ausgabenbudgets von mehr als einer Milliarde Franken in der Deputiertenkammer mit den Worten begleitete: "Messieurs saluez ce milliard, vous ne le reverrez plus!" Fortschreitende Geldentwertung, wachsende Bevölkerungszahl und immer weitere Ausdehnung der staatlichen Tätigkeit treiben die öffentlichen Ausgaben unaufhaltsam hinauf. Dabei spielen die Geldentwertung und im 19. Jahrhundert zeitweise auch die Bevölkerungsvermehrung eine nicht minder grosse Rolle als der steigende Interventionismus des Staates, der schon 1856 von Charles Dupont-White, dann aber besonders von Adolf Wagner in seinem Lehrbuch der Finanzwissenschaft (1877) als "Gesetz der wachsenden Ausdehnung der Staatstätigkeit", das zum "Gesetz der wachsenden Ausdehnung des Finanzbedarfes" führe, bezeichnet wurde.
Nicht alle finanzwissenschaftlichen Forscher haben sich mit der Feststellung des immer weiter um sich greifenden Interventionismus und des dadurch gegebenen immer grösseren Anschwellens der Ausgabenbudgets begnügt. Sie wollten auch die tieferen Gründe dieser Entwicklung ermitteln und stiessen dabei natürlich auf die politischen Umwälzungen, die durch die Mitwirkung der breiten Massen bei der Gesetzgebung bzw. bei der Bestellung des Parlamentes herbeigeführt worden waren. Vor allem Leroy-Beaulieu hat in seinen wissenschaftlichen Werken wie in den zahllosen Leitartikeln, die er für den "Economiste français"schrieb, immer wieder die Sucht des Parlamentes, den Wählern wirtschaftliche Vorteile auf Kosten des Staates zu verschaffen, hingewiesen. Die Demokratie neigt nach ihm zwangsläufig zur Verschwendung der öffentlichen Gelder und ist die kostspieligste Staatsform — ein Satz, der schon zur Zeit, als Leroy-Beaulieu ihn niederschrieb, historisch wohl nicht ganz richtig war angesichts der Finanzpolitik verschiedener absoluter Monarchien am Ausgang des 18. Jahrhunderts und der uns Heutigen, die wir die gewaltigen Ausgaben der totalitären Staaten erlebt haben, schon ganz überholt vorkommt. In der Schweiz sind wir, auf Grund von Beobachtungen an den Landsgemeindekantonen und von Erfahrungen mit dem Finanzreferendum, wohl sogar umgekehrt geneigt, um so eher eine sparsame Ausgabenpolitik für möglich zu halten, je unverfälschter sich die rein demokratische Staatsform erhalten konnte.
IV.
Ergiebiger als auf dem Gebiete der Ausgaben ist, wie schon erwähnt wurde, die Ausschau nach Regelmässigkeiten auf dem Gebiete der finanziellen Deckung.
Hier hat vor allem die Frage nach der Art der Finanzierung von Kriegen Anlass zur Beobachtung einer vermeintlichen Regelmässigkeit geführt. Den moralischen, politischen und ökonomischen Argumenten, welche von jeher für die Erhebung
von Kriegssteuern an Stelle von Kriegsanleihen geltend gemacht wurden, hat wiederum Adolf Wagner den Hinweis auf einen seiner Meinung nach zwangsläufigen Sachverhalt beigefügt. Es ist die Anschauung, dass die Kriegsanleihe — zum mindesten am Anfange eines Krieges — schon deswegen als Deckungsmittel nicht in Frage komme, weil dann der "Kredit regelmässig am tiefsten erschüttert" sei. Zu dieser Ansicht scheint Wagner vor allem durch den Misserfolg der ersten Kriegsanleihe des Norddeutschen Bundes im Jahre 1870 bewogen worden zu sein, die, weil sie schon 14 Tage nach Kriegsausbruch aufgelegt wurde, trotz einem Zinssatz von 5 % und einem Emissionskurs von 88 % nur zu zwei Dritteln gezeichnet wurde. Die Lehre Adolf Wagners hat noch nachgewirkt bis zum Vorabend des Krieges von 1914, und es hat damals gute Kenner des Kapitalmarktes gegeben, welche der Ansicht waren, dass für die Kriegsfinanzierung nur Steuern und Papiergeld in Frage kommen würden. Die kriegführenden Grossmächte haben sich denn auch im ersten wie im zweiten Weltkriege insofern an diese Auffassung gehalten, als sie mehrere Wochen oder Monate verstreichen liessen, bis sie die erste Kriegsanleihe auflegten. Aber im weiteren Verlauf haben sie, gestützt auf die grossen, nach Anlage drängenden Kriegsgewinne, und auf die Liquidität des Geld- und Kapitalmarktes, die sich aus dem Warenmangel ergab, dann allerdings Anleihen in einem Umfange aufnehmen können, welcher die These von dem notwendigen Versagen des Kredites im Kriege unhaltbar machte.
Gehen wir zu den einzelnen Finanzquellen über, so stossen wir bei den öffentlichen Unternehmungen auf eine Streitfrage, welche die Gemüter zeitweise lebhaft beschäftigt hat: auf die Frage nach ihrer Leistungsfähigkeit im Vergleich zu privaten Unternehmungen. Es ist für die einen ein sozialökonomisches Gesetz, dass der Staat nicht zum Unternehmer taugt, für die anderen ein ebensolches Gesetz, dass er im Gegenteil alles viel besser macht als die Privatwirtschaft.
Die Behandlung dieses Problems hat allzulange darunter gelitten, dass man übersah, wie sehr die Qualität der Staatsbetriebe
durch Zeit und Ort bestimmt wird. Staatliche Unternehmungen weisen nach technischer und organisatorischer Ausrüstung, nach ihrem Geschäftsgebaren in den verschiedenen Teilen der Welt wohl fast ebensogrosse Unterschiede auf wie die Typen der privaten Unternehmungen. Wer einen Vergleich zwischen Privatwirtschaft und Staatswirtschaft ziehen will, muss schon zu der Methode greifen, die der "Verein für Sozialpolitik" einmal anwandte, als er eine grosse Zahl von Gemeindebetrieben Deutschlands und anderer Länder monographisch durchleuchten liess. Es kamen viele interessante Einzelheiten dabei heraus, aber jene Kontroverse ist auch durch diese umfassende Untersuchung nicht eindeutig entschieden worden, aus dem einfachen Grunde nicht, weil ein Nebeneinander oder auch nur ein Nacheinander von gleichartigen Unternehmungen auf dem Gebiete derselben Stadt nur selten vorkommt und auch dann im Grund unvergleichbare Erscheinungen vorliegen. Eine Strassenbahnlinie im Stadtzentrum kann nicht mit einer solchen, die in die äusseren Quartiere führt, verglichen werden, und ein Gaswerk vor der Verstadtlichung nicht mit demselben Betrieb nachher, wenn inzwischen Konsumverhältnisse, Arbeitsbedingungen, Rohstoffpreise sich stark verändert haben.
V.
Wird die Prüfung des Wertes der öffentlichen Unternehmungen durch hineinspielende wirtschaftspolitische Interessen erschwert, so ist dies mitunter in noch höherem Grade der Fall bei den Steuern. Das verständliche Bestreben der politischen Parteien wie der wirtschaftlichen Gruppen, die Steuerlast tunlichst von den eigenen Mitgliedern fernzuhalten und anderen zuzuwälzen, wird aussichtsvoller, wenn zu seiner Unterstützung mehr oder weniger feststehende Grundsätze oder gar Gesetzmässigkeiten angerufen werden können.
Wir finden solche Auseinandersetzungen in Bundesstaaten schon bei der grundlegenden Frage, wie die Steuerquellen zwischen Bund und Gliedstaaten zu verteilen seien. Die historische
Erfahrung zeigt, dass beim Zusammenschluss bisher voll souveräner Staaten zu einer Föderation der Bund sich zunächst regelmässig mit der Zuweisung der Zölle, der Verbrauchssteuern und Verkehrssteuern begnügt und das Gebiet der direkten Steuern den Einzelstaaten überlässt. So war es bis zum ersten Weltkriege in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Deutschland, in der Schweiz, in Kanada, in Australien und in anderen Bundesstaaten. Die Gründe für die auffällige Einheitlichkeit dieser Ordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleiches waren ursprünglich wohl überall ähnlicher Art. Es kam vor allem darauf an, im Interesse der Bildung eines einheitlichen Rechts- und Wirtschaftsgebietes die Grenzzölle als Instrument der auswärtigen Handelspolitik in die Hände der Zentralgewalt zu legen, die Belästigungen des freien Verkehrs im Inlande, welche regionale Verbrauchs- und Verkehrssteuern bewirken, zu beseitigen und die Stellungnahme zu den heiklen Fragen, welche bei der Gestaltung der Vermögens- und Einkommenssteuer auftreten, den Einzelstaaten zu überlassen. So wird es verständlich, dass dieser gewohnheitsmässige Zustand schliesslich zu der Auffassung führte, die Maxime: "die indirekten Steuern dem Bunde, die direkten den Gliedstaaten" entspreche sozusagen einer politischen Gesetzmässigkeit, sie sei durch die "Natur der Dinge" gegeben.
Heftige Kämpfe mussten daher entstehen, als wachsender, meist durch Kriegslasten bedingter Finanzbedarf in allen den genannten Staaten den Bund veranlasste, seine Hoheit auch auf das Gebiet der direkten Besteuerung auszudehnen. Die föderalistischen Parteien beriefen sich auf die Tradition, auf die natürliche Arbeitsteilung zwischen Bund und Gliedstaaten — aber der durch die Kriege gegebene Notstand war mächtiger und heute ist das vermeintliche Gesetz fast ganz ausser Kraft gesetzt, es gibt in allen genannten Staaten direkte Bundessteuern.
Ein grösseres Beharrungsvermögen als die Ordnung des Finanzausgleichs in Bundesstaaten zeigen einige Zusammenhänge auf steuerpolitischem Gebiet, welche ganz besonders die demokratischen Staaten betreffen. Hier wäre vor allem auf die
auffällige Tatsache hinzuweisen, dass eine Steuer, die wegen ihrer fehlenden Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit im allgemeinen als nicht mehr zeitgemäss gilt, ausgerechnet in den Demokratien heute noch besteht, nämlich die Kopfsteuer. Die poll tax in den amerikanischen Einzelstaaten, der impôt personnel in den französischen Departementen und Gemeinden, die Personal-, Manns- und Aktivbürgersteuern in den schweizerischen Kantonen ragen als Zeugen veralteter Steuersysteme noch immer in die Gegenwart, aber sie scheinen doch bis zu einem gewissen Grade mit dem Wesen der Demokratie zusammenzuhängen, die keine "Gratisbürger", keine Stimmberechtigten anerkennen will, die nur mitbeschliessen und mitwählen, aber nicht mitzahlen.
Aber nicht nur in diesem Punkte zeigt sich der konservative Charakter der Demokratien. Er tritt auch besonders hervor in einer deutlichen Abneigung gegen moderne Formen der Steuererhebung. Unter der Abneigung des Volkes gegen einen zu grossen Beamtenapparat und gegen die Allmacht des Staates hat nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Amerika und in Frankreich der technische Ausbau der Erhebungsmethoden, insbesondere bei der Vermögens- und Einkommenssteuer, bis in die jüngste Zeit gelitten. Hat doch die Landsgemeinde von Appenzell A. Rh. noch im Jahre 1939 das primitive Mittel der obligatorischen Selbsttaxation abgelehnt.
Man hört nun allerdings etwa die Meinung, dass anderseits die Demokratie zu übermässigem Radikalismus, besonders bei der Steuerbefreiung der untersten Einkommensschichten und bei der Gestaltung der Progression der Vermögens- und Einkommenssteuer neige. Aber diese Ansicht beruht doch wohl auf einer Verallgemeinerung einzelner Fälle. In der Mehrzahl der schweizerischen Kantone hat die Höhe der steuerfreien Existenzminima mit der seit drei Jahrzehnten eingetretenen Geldentwertung nicht Schritt gehalten und die hohe Belastung der obersten Schichten des Vermögens und Einkommens rührt häufig weniger von einem zu raschen Tempo der Progressionsskala als vielmehr von der übersetzten Höhe der einfachen Ansätze her, die ihrerseits
bedingt ist durch den vorhin erwähnten Widerstand gegen eine genaue Ermittlung der Steuerobjekte.
Die eben berührten Zusammenhänge zwischen Staatsform und Steuerrecht können jedenfalls nur mit grossen Vorbehalten als Gesetzmässigkeiten bezeichnet werden. Das Bild ist sogar auf einem homogenen Beobachtungsgebiete, wie die Schweiz eines ist, zu bunt und mannigfaltig, die durch parteipolitische Verschiebungen bewirkten Änderungen sind zu häufig, als dass der Eindruck einer eigentlichen Gesetzmässigkeit sich geradezu aufdrängen könnte.
Viel verbreiteter und stärker ist die Überzeugung vom Verlauf der Dinge nach strengen Gesetzen dort, wo es auf die Ergründung wirtschaftlicher Zusammenhänge ankommt. Die Frage, wie die Steuern auf das Wirtschaftsleben, auf Produktion, Zirkulation und Konsumtion der Güter wirken, wie insbesondere die Verteilung der Steuerlast auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen sieh gestaltet, berührt ja ein Problem, das durchaus nicht nur die Gelehrten und die Spezialisten der Steuerpolitik beschäftigt, sondern in gewissen Momenten die breitesten Kreise des Volkes interessiert und sie manchmal sogar erregt.
Gibt es auf diesem Gebiete Gesetzmässigkeiten? Werden gewisse Steuern regelmässig von den Personen, die sie an den Fiskus zu entrichten haben, auf andere Personen überwälzt, auf Personen, mit denen sie Güter, Dienstleistungen oder Kapitalien austauschen?
Es ist bemerkenswert, dass gleich die ersten Versuche zu einer Behandlung des Überwälzungsproblems mit grossem Nachdruck das Walten von Gesetzen auf diesem Gebiete behauptet haben. Der englische Philosoph John Locke hat schon im Jahre 1692 den Satz aufgestellt, dass es unnötig sei, neben der Grundsteuer noch andere Steuern zu erheben, da letztere ja doch samt und sonders auf das Grundeigentum überwälzt würden. Damit wurde Locke zum Vorläufer der Physiokraten, der Quesnay, Mercier de la Rivière, Mirabeau, die das Problem der Steuerüberwälzung zuerst in seiner grossen Bedeutung erkannt und ihm im Rahmen ihrer volkswirtschaftlichen Grundanschauung, in der Lehre vom
"produit net", wonach lediglich der Landwirtschaft die Fähigkeit zuerkannt wird, neuen Reichtum zu erzeugen —während Gewerbe und Handel sich nur mit der Umformung und Übertragung der Bodenprodukte befassen — eine denkbar einfache Lösung gegeben haben. Alle Steuern, welcher Art immer sie seien, fallen nach dieser Lehre auf das "produit net" zurück und das rationellste und die geringsten Umtriebe und Kosten verursachende Steuersystem besteht also in der Erhebung einer einzigen Abgabe, der Grundsteuer.
Mit dem Abrücken der Wissenschaft von der physiokratischen Lehre ist auch ihre Theorie der Steuerüberwälzung zu einer dogmengeschichtlichen Kuriosität geworden, welche heute kaum noch die Finanzwissenschaft, geschweige die öffentliche Meinung beschäftigt. Aber es bleibt das Verdienst der Physiokraten, das Problem der Steuerüberwälzung, dem ja so grosse praktische Bedeutung zukommt, in voller Klarheit gesehen und es zur Diskussion gestellt zu haben, wenn es auch heute noch von einer restlosen Lösung weit entfernt ist. In den Kämpfen zwischen Freihändlern und Schutzzöllnern spielt die Frage, ob der Zoll vom ausländischen Produzenten oder vom inländischen Konsumenten getragen wird, noch immer eine hervorragende Rolle. Die subjektive Vermögens- und Einkommenssteuer, die Erbschaftssteuer, die Steuer vom Wertzuwachs des Bodens, die Kriegsgewinnsteuer setzten sich im Laufe der letzten hundert Jahre fast überall in der Gesetzgebung durch, weil die öffentliche Meinung davon überzeugt war, dass diese Abgaben nicht überwälzt werden können, dass hier das Steuersubjekt auch der wirkliche Steuerträger sei.
Die Finanzwissenschaft freilich steht dem ganzen Problem, seit vor vielen Jahrzehnten Lorenz von Stein die ersten Fragezeichen hinter diese hergebrachten Anschauungen machte, zurückhaltend gegenüber. Die Einkalkulierung der Vermögens- und Einkommenssteuer, ja sogar der Kriegsgewinnsteuer in die Geschäftsunkosten ist eine zu häufig beobachtete Erscheinung, als dass die Unüberwälzbarkeit dieser Steuern als gesetzmässige Regel aufgefasst werden könnte. Es hat Skeptiker gegeben,
welche sogar die wenigstens partielle Überwälzbarkeit der Erbschaftssteuer, etwa in Form der Einschränkung des Aufwandes der Erben für Luxuswaren, behauptet haben.
Die Frage der Steuerüberwälzung, die nur denkende Steuerzahler beschäftigt, lässt den Fiskus im allgemeinen kalt. Ihn interessiert die Herkunft der Steuergelder nicht allzustark, vorausgesetzt, dass sie pünktlich und in der erwarteten Höhe aufkommen. Aber dieser letztere Punkt erregt dafür seine Aufmerksamkeit in um so höherem Grade, und so sind es praktische Steuerbeamte gewesen, welche vor mehr als 200 Jahren die Gesetzmässigkeit entdeckt haben, die als die "Lehre vom Steuereinmaleins" in die Finanzwissenschaft eingegangen ist. Jonathan Swift, der gewöhnlich als der Entdecker dieses Gesetzes gilt, hat in einer 1728 erschienenen Schrift das Urheberrecht ausdrücklich englischen Zollbeamten zuerkannt, die sich dahin geäussert hatten, dass nach ihren Beobachtungen die Verdoppelung von Zollansätzen nicht auch zu einer Verdoppelung der Zollerträgnisse führe, weil dann eben der Import nachlasse oder der Schmuggel zunehme.
Das "Steuereinmaleins"hat seither immer mehr Anerkennung gefunden. Es hat mit sozusagen umgekehrtem Vorzeichen glänzend gespielt bei der Zürcher Steuerreform vom Jahre 1919, wo eine Herabsetzung des Tarifes, die auf einzelnen Stufen 70% erreichte, nicht zu Steuerausfällen, sondern im Gegenteil zu gewaltiger Vermehrung der Einnahmen führte, weil eben die Steuererleichterungen den Übergang zu einer besseren Steuermoral begünstigten. Wir haben anderseits die Ausserachtlassung des "Steuereinmaleins" noch vor einigen Jahren erlebt, als das eidgenössische Parlament, entgegen den Warnungen des Bundesrates, Erhöhungen der Tabaksteuer vornahm, die statt der erwarteten Mehreinnahme von 5 Mill. Franken eine solche von nur 59 Franken brachte, weil die Raucher sich der billigeren Ware zuwandten.
Der Fiskus interessiert sich aber auch noch von einem anderen Gesichtspunkt aus für ökonomische Gesetzmässigkeiten. Zeitpunkt und Ausmass des Konjunkturwechsels sind von grosser
Bedeutung für die Budgetierung der Steuereinnahmen. Von jeher war bekannt, dass Steuern vom Verbrauch und Verkehr im allgemeinen empfindlicher von den Schwankungen der Konjunktur betroffen werden als veranlagte Steuern. Innerhalb der letzteren Gruppe wieder ist die vom Kapitalbetrag berechnete Vermögenssteuer stabiler in ihren Erträgnissen als die Einkommens- und Erwerbssteuer, obgleich selbst diese häufig eine bemerkenswerte Widerstandskraft zeigt, wie dies z. B. bei der eidgenössischen Krisenabgabe der Fall war, die trotz ihrem ominösen Namen in den Jahren 1935/38 nur verhältnismässig geringe Oszillationen aufwies.
Aber allerneuestens haben einige Konjunkturtheoretiker aus ihren Lehren vom notwendigen und sogar hinsichtlich des Zeitpunktes berechenbaren Konjunkturwechsel noch weitergehende Folgerungen gezogen. In der Depression der 1930er Jahre gaben sie den Finanzministern den Rat, sich nicht zu grämen über die gewaltigen Defizite im Staatshaushalt. Das sei ganz unbedenklich, es sei sogar ratsam, die Defizite noch zu vergrössern durch ausgiebige Arbeitsbeschaffungsmassnahmen und Steuererleichterungen. Auf die "Ankurbelung der Wirtschaft" komme es vor allem an. In der mit Sicherheit zu erwartenden Prosperitätsperiode werde die Tilgung der aufgelaufenen Schulden dann ein leichtes sein. In einigen Ländern, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Schweden, hat man auf sie gehört, in anderen hat man zwar auch Krisenmassnahmen getroffen, die erforderlichen Finanzen aber doch lieber, soweit nur möglich, auf dem Steuerwege beschafft.
VI.
Auch das letzte Kapitel der Lehre vom Finanzhaushalt — die Lehre vom öffentlichen Kredit —zeigt Versuche zur Entdeckung von Gesetzmässigkeiten. Im 18. Jahrhundert werden beunruhigte Staatsgläubiger vom Abbé Terray, einem der letzten Finanzminister des ancien régime, mit dem Hinweis zu trösten versucht, dass alle hundert Jahre einmal der Staatsbankrott eben
eine unausweichliche Notwendigkeit sei. lind skrupulöse Finanzminister ihrerseits werden wieder beruhigt durch die schon David Hume bekannte Erscheinung, dass der Staat nach einem Staatsbankrott leichter Kredit findet a13 vorher, weil die neuen Gläubiger vor einer bereinigten und erleichterten Finanzlage stehen. Im Jahre 1928 entwickelt der Italiener Federico Flora in einer für die Festgabe für Georg Schanz geschriebenen Abhandlung über die Zukunft der öffentlichen Anleihen im Angesichte der gewaltigen Schuldenlast, die der erste Weltkrieg hinterlassen hat, noch optimistischere Gedankengänge. Steigendes Nationaleinkommen, fortschreitende Geldentwertung und immer grössere Verbreitung der Anleihetitel in allen Kreisen der Bevölkerung werden nach ihm die Schuldenlast immer mehr erleichtem. In froher Laune schliesst er seine Betrachtung mit den Worten: "Il debito pubblico è come il vino. Invecchiando migliora".
Von diesem Optimismus wäre ein kleines Quantum den Geldtheoretikern zu wünschen, welche in den letzten Jahren die Öffentlichkeit mit düsteren Voraussagen über die vermeintlich unausweichlichen Folgen der Verschuldung des Staates beunruhigt haben. Schon als die ungedeckte Schuld der Eidgenossenschaft knapp 3½Milliarden Franken betrug, prophezeiten sie den baldigen Ausbruch eines Inflationsprozesses. Seither sind mehr als drei Jahre verstrichen, der Schuldenüberschuss ist fast auf das Doppelte, auf 6,7 Milliarden Franken, gestiegen, aber die Inflation ist ausgeblieben. Der Index der Lebenskosten ist von 184 Ende 1941 auf 208 Ende 1944 gestiegen, entfernt nicht so stark wie in den drei letzten Jahren des ersten Weltkrieges, wo er von 115 auf 211 hinaufschnellte, obgleich damals die Zufuhren viel reichlicher und die Staatsschulden weit niedriger waren. Die schärfere Preiskontrolle und das noch unerschütterte Vertrauen des Volkes in die Stabilität der Währung sind eben von grösserer Bedeutung gewesen als die Technik der Kriegsfinanzierung.
Diese beiläufige Bemerkung enthält einen Hinweis grundsätzlicher Art, mit dem ich schliessen möchte, den Hinweis darauf,
dass die sozialwissenschaftliche Forschung sich nicht zu sehr auf rein logisches Denken und statistische Daten verlassen darf. Stets sollte sie vielmehr im Auge behalten, dass das volkswirtschaftliche Geschehen aus Massenhandlungen von Menschen besteht, die ihrerseits wieder vom Fühlen und Denken dieser Massen abhängen. Mag ein Volk auch zehnmal in der gleichen Lage sich gleichartig benommen haben — und mag flugs daraus ein "Gesetz" gemacht worden sein — eine Gewähr dafür, dass es beim elften Male, beeinflusst durch neue Ideen, neue Befürchtungen oder Hoffnungen, sich nicht ganz anders verhält und so das vermeintliche Gesetz dahinfällt, besteht dennoch nicht. Den ehrgeizigen Traum, eine "soziale Physik" zu werden, muss die Nationalökonomie aufgeben. Aber sie hat Aussicht auf schöne Erfolge, wenn sie, als soziale Psychologie, sich stets der Aufgabe bewusst bleibt, den Geist und den Willen der wirtschaftenden Menschen zu erforschen.






