SPRACHE UND NATION
Vortrag anlässlich des Dies academicus 1996
1997 UNIVERSITÄTSVERLAG FREIBURG SCHWEIZ
Die Deutsche Bibliothek — CIP Einheitsaufnahme Altermatt, Urs:
Sprache und Nation. Vortrag anlässlich des Dies academicus 1996 / Urs Altermatt.
— Freiburg, Schweiz: Univ.-Verl., 1996 (Freiburger Universitätsreden; N.F., Nr. 53) ISBN 3-7278-1118-8
Veröffentlicht mit Unterstützung des Hochschulrates Freiburg Schweiz und der Rektorates der Universität Freiburg Schweiz
© 1997 by Universitätsverlag Freiburg Schweiz Paulusdruckerei Freiburg Schweiz ISBN 3-7278-1118-8
Als die Universität Freiburg i.Ue. 1889 gegründet wurde, erwogen Staatsrat Georges Python und sein Bündner Mentor Caspar Decurtins die Errichtung einer dreisprachigen Hochschule. 1 Aus finanziellen Gründen kamen die Gründungsväter von diesen Plänen ab. Zustande kam eine zweisprachige Universität, die — und das dürfen wir am Dies academicus 1996 mit Stolz festhalten —die älteste funktionierende zweisprachige Hochschule Westeuropas bildet, eine Hochschule, in der Französisch und Deutsch gleichberechtigte Sprachen darstellen. Gewiss: Es existiert auch die Université Libre von Brüssel, doch sie ist in zwei Teile getrennt. An den Universitäten Barcelonas erlangte in den 1990er Jahren das Katalanische gegenüber dem Spanischen einen gleichberechtigten Status.
Sonst gibt es in West- und Zentraleuropa keine wirklich zweisprachigen Universitäten mehr. 1783 ging die Prager Universität von der lateinischen zur deutschen Unterrichtssprache über. Im 19. Jahrhundert gewann das Tschechische an Bedeutung und drängte das Deutsche im Kulturleben der Stadt in die Defensive. 1882 teilte sich die Universität in eine deutsche und eine tschechische Sektion auf. Nach 1945 blieb nur
noch der tschechoslowakische, nach 1993 der tschechische Teil übrig. In Löwen trennte sich 1970 die altehrwürdige Universität in eine flämische und eine französische Hochschule auf.
Wie ich in meinem Buch «Das Fanal von Sarajevo» (1996) ausführlich dargelegt habe, ist die Entwicklung der Universitäten ein Spiegelbild des wachsenden Ethnonationalismus in Staat und Gesellschaft Europas. 2 Jede Nation soll einen Staat und jeder Staat nur eine einzige Nation umfassen. So lautet die Formel, die seit dem 19. Jahrhundert die politische Karte Europas prägt.
Die nationale Einigung Italiens 1866 bzw. 1870 und der Zerfall der Tschechoslowakei von 1993, der deutsch-französische Krieg von 1870/71, der Erste Weltkrieg von 1914-1918 und der Balkan-Krieg von 1991-1995 gehören thematisch zusammen, obwohl sie auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Ereignisse darstellen; sie sind Etappen in der grossen Epoche der europäischen Nationalisierung.
In Europa ist die Sprache mehr als ein Kommunikationsmittel; sie ist Ausdruck und Symbol der verschiedenen Kulturen des Kontinents. Der Bezug auf die Sprache und Kultur bildet seit dem 19. Jahrhundert den Vorwand, um Territorien zu teilen und ethnisch-kulturell zu säubern. Was am Ende des 20. Jahrhunderts auf dem Balkan und im Kaukasus geschieht, ist die brutale Übersteigerung der normalen europäischen Geschichte. In pharisäischer Selbstgerechtigkeit und
Heuchelei blicken wir Westeuropäer nach dem Südosten unseres Kontinents, ohne dass uns bewusst wird, dass wir in milderer Form die gleichen Konzepte der ethnischen und kulturellen Teilung verfolgen und in unseren Teilen Europas weitgehend schon verwirklicht haben.
Der europäische Sprachnationalismus
Die Friedensordnungen von 1919, 1945 und 1989/90 brachten in Europa neue Grenzziehungen hervor, die darauf abzielten, kulturell homogene Nationalstaaten mit einer einzigen oder einer vorherrschenden Staatssprache zu schaffen. Nach dem Ersten Weltkrieg versuchten die Europäer, die geopolitische Karte ihres Kontinentes nach dem Nationalitätenprinzip neu zu zeichnen. Wie der britische Historiker Eric J. Hobsbawm bemerkt, folgte auf den Versuch, den Kontinent in ethnisch und sprachlich homogene Territorialstaaten aufzuteilen, die Barbarisierung, das heisst die massenhafte Vertreibung oder Vernichtung von Minderheiten. 3
Die ethnisch-kulturelle Karte Europas wurde im Verlaufe der vergangenen hundert Jahren eintöniger. Im ausgehenden 19. Jahrhundert wiesen die Reiche der Osmanen, der Habsburger und der Romanows noch grosse Nationalitäten ohne eigenen Staat auf. 4 1910 ergab die Volkszählung in der Habsburger Monarchie, dass in Österreich-Ungarn neben 12 Millionen Deutschen 10 Millionen Magyaren, 6,5 Millionen Tschechen,
5 Millionen Polen, 4 Millionen Ukrainer, 3,2 Millionen Rumänen, 2,9 Millionen Kroaten, 2,3 Millionen Juden, 2 Millionen Slowaken, 2 Millionen Serben, 1,2 Millionen Slowenen und 800'000 Italiener wohnten. Im Osmanischen Reich lebten um 1900 — nach einer anderen Zählart, die Religion und Ethnie vermischt — 14 Millionen Muslime, das heisst Türken, Kurden und Araber, 2,57 Millionen Griechen, mehr als 1 Million Armenier, 830'000 Bulgaren, 215'000 Juden, 120'000 Katholiken, 32'000 Maroniten sowie weitere Minderheiten. Auch das Deutsche Reich umfasste um die Jahrhundertwende noch zahlreiche nichtdeutsche Volksgruppen: 3 Millionen Polen, 200'000 Französischsprechende und je 100'000 Dänen, Masuren, Litauer, Tschechen, Kaschuren und Sorben.
Homogenisierung
Wo in Europa sprachliche Minderheiten lebten, sahen sie sich in der Regel dem internen Homogenisierungsdruck durch das sogenannte Staatsvolk ausgesetzt. Greifen wir das Beispiel Ungarns heraus. 5
1850 machten im Königreich Ungarn die Einwohner magyarischer Herkunft erst 41,6 Prozent aus. 1910 waren bei 18 Millionen Einwohnern schon 54,5 Prozent ungarischer Muttersprache; 16,1 Prozent gaben Rumänisch als erste Sprache an, 10,7 Prozent Slowakisch und 10,4 Prozent Deutsch. In einem halben Jahrhundert hatte sich der magyarische Anteil um fast 15 Prozent erhöht.
Hinter dem Wachstum der Magyaren stand eine bewusste Sprachenpolitik der Regierung, die Ungarisch ab 1879 für die obligatorische Schulsprache erklärte, die Beamten nach sprachlichen Kriterien auswählte und die Ortsnamen magyarisierte. Auf älteren Bildern heisst Budapest meistens noch in deutscher Sprache Ofen. Mit Hilfe von Begünstigungen und Zwangsmassnahmen wurden die Volksgruppen anderer Sprachen und Ethnien zu mehr oder weniger freiwilliger Assimilation angehalten. Sobald ein Rumäne oder ein Slowake im öffentlichen Raum Ungarisch sprach, sobald er einen ungarischen Namen und Vornamen annahm, sah er sich keiner Diskriminierung mehr ausgesetzt. Damit wurde das Ungarische zur Sprache des öffentlichen Lebens.
Eine weitere Zäsur in der Sprachengeschichte Ungarns brachte die Niederlage des Königreichs im Ersten Weltkrieg. Der Vertrag von Trianon bestimmte 1920, dass Ungarn mehr als 70 Prozent seines Vorkriegsgebietes und über 60 Prozent seiner Vorkriegsbevölkerung an die Nachbar- und Nachfolgestaaten abzutreten hatte. Dadurch brach das multiethnische Königreich zusammen. Als Reaktion rückten die Ungarn fortan die sprachlich-kulturelle Identität ihrer Nation noch mehr in den Vordergrund, was zur Folge hatte, dass die in Ungarn verbliebenen Minderheiten vollends unter Druck gerieten. In der Zeit von 1920 bis 1945 bekannten sich die meisten Ungaren zu einem kulturellen Nationenbegriff, der in der Epoche des
europäischen Faschismus ethnische Züge annahm. Die Magyarisierung schritt voran. 1990 sah die Sprachenstatistik folgendermassen aus: über 98 Prozent gaben Ungarisch als Muttersprache an, Deutsch, Slowakisch, Rumänisch, Kroatisch, Serbisch, Slowenisch sprach insgesamt kein Prozent. Über die Sinti und Roma existieren keine zuverlässigen Zahlen.
Dem ungarischen Beispiel können unzählige andere aus Ost- und Westeuropa angefügt werden. Die Mehrsprachigkeit war für die europäischen Regierungen bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Störung der nationalen Harmonie, ein Hindernis auf dem Weg zur Nationalisierung von Staat und Gesellschaft.
Bekannt sind die Wechselbäder, die die Elsässer und Lothringer zwischen 1871 und 1918 im Spannungsfeld von Deutschland und Frankreich durchmachen mussten. Unbekannter ist die Russifizierungspolitik der Zaren gegenüber den Weissrussen, Litauern und Ukrainern. 6 Diese Völker galten als Westrussen oder Kleinrussen, also als Teile des russischen Volkes. Im Sommer 1863 untersagte das zaristische Innenministerium in einem geheimen Zirkular den Druck von Büchern in ukrainischer Sprache mit Ausnahme von Werken der Belletristik.
Schweiz und Belgien als Antithesen
Die zunehmende sprachliche Nationalisierung konnte die kulturelle Vielfalt Europas nicht völlig
überdecken. Auch wenn die Staatssprache für die meisten europäischen Nationalstaaten im 20. Jahrhundert identitären Charakter annahm, blieb im Alltag die Mehrsprachigkeit erhalten. Selbst in den klassischen Sprachnationen wie etwa Frankreich konnten sich Regionalsprachen wie das Korsische oder das Bretonische ausserhalb des öffentlich-repräsentativen Bereiches halten. 7
Die Schweiz ist insofern ein europäischer Sonderfall, als sie die Mehrsprachigkeit schon im 19. Jahrhundert verfassungsmässig verankert hat. Nur noch Belgien entwickelte im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine ähnliche Mehrsprachigkeit. 8 1830 legte die provisorische Regierung fest, dass das Französische Staatssprache sei; wenn es aber die Situation erfordere, seien einzelne Texte auch auf Flämisch und Deutsch zu veröffentlichen. Die Bevorzugung des Französischen ist damit zu erklären, dass die Belgische Revolution das Werk des Bürgertums war, das in seiner grossen Mehrheit auch in den flämischen Provinzen Französisch als Umgangssprache benutzte. Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts gewann die flämische Sprachenbewegung an Gewicht. 1873 erfolgte die Gleichberechtigung der Sprachen vor Gericht, 1878 in der Staatsverwaltung, 1883 wurde das Flämische an den staatlichen Mittelschulen in den niederländischen Provinzen zugelassen. Seit 1898 wurden die Gesetze des belgischen Staates offiziell in Französisch und Flämisch erlassen. Flämisch erhielt den Status einer belgischen
Staatssprache und wurde dem Französischen gleichgesetzt. Briefmarken, Banknoten, öffentliche Gebäude mussten zweisprachig beschriftet werden, der König legte seinen Eid in beiden Sprachen ab.
Mit den Sprachengesetzen der 1930er Jahre wurde für Flandern und Wallonien die Einsprachigkeit in Verwaltung, Unterricht, Rechtssprechung und Armee in den jeweiligen Landesteilen festgelegt. Die Sprachgrenze war damit geboren. Nur die Region von Brüssel war zweisprachig.
Dadurch entstanden zwei Sprachenblöcke mit eigenen Volkskulturen, Fahnen und Liedern. Dieser sprachenseparatistische Aufbau führte Belgien nach dem Zweiten Weltkrieg an den Rand der politischen Lähmung. Erst die Staatsreformen von 1970-1993 brachten eine Beruhigung, indem sie das Land zu einem föderalistischen Bundesstaat mit den drei autonomen Regionen Flandern, Wallonien und Brüssel-Hauptstadt und den drei Landessprachen Französisch, Niederländisch und Deutsch verwandelten.
In Luxemburg, Malta und Irland spielt das Territorialprinzip keine Rolle. Die offizielle Mehrsprachigkeit hat funktionellen Charakter. Die Muttersprache der Bevölkerung Luxemburgs ist Letzeburgisch; Französisch und Deutsch werden als Amtssprachen benutzt. In Malta wird Maltesisch für die internen, Englisch für die externen Belange verwendet. Irisch und Englisch haben in Irland offiziell eine gleichberechtigte Stellung. Allerdings sprechen die meisten
Iren kein Irisch. Diese Sprache hat als Symbol der Nationalkultur eher ideelle denn praktische Bedeutung. 9
Minderheitenschutz
In einigen Ländern Europas kamen nach dem Ersten Weltkrieg Minderheitengesetze zur Anwendung, um die Sprachen der kleineren Volksgruppen zu schützen. Zu erwähnen ist an erster Stelle Finnland, das 1917 seine Unabhängigkeit erlangte und dabei Finnisch und Schwedisch als National- und Amtssprachen anerkannte. 10 Die Gesetzestexte erscheinen seit 1919 in beiden Sprachen, obwohl mehr als 95 Prozent der Bevölkerung Finnisch sprechen. Die grosszügige Minderheitenregelung ist darauf zurückzuführen, dass Finnland bis anfangs des 19. Jahrhunderts dem Königreich Schweden angehörte. Nach dem schwedisch-russischen Krieg von 1808/09 wurde Finnland an Russland abgetreten. Das Schwedische behielt trotz der allmählichen Herausbildung eines finnischen Nationalbewusstseins lange Zeit sein kulturelles Übergewicht. Erst das Sprachengesetz von 1922 gliederte das Land verwaltungstechnisch in ein- und zweisprachige Gebiete ein. Als zweisprachig gelten Gemeinden, wenn die sprachliche Minderheit 10 Prozent oder — bei geringerer Prozentzahl — mindestens 5000 Personen umfasst. 1991 anerkannte Finnland ausserdem das Lappische als Amtssprache für die Provinz Lappland.
Im deutschsprachigen Südtirol, das nach dem Ersten Weltkrieg Italien angegliedert worden war, wurden die Spannungen 1969 mit einem Autonomiestatut entschärft.
Den grössten Erfolg erzielte der Minderheitenschutz in Spanien, wo in den 1970er Jahren Baskisch, Katalanisch und Galizisch in den Regionen offiziellen und gleichrangigen Status erlangten. Schauen wir kurz auf das illustrative Beispiel Kataloniens. 11 Die grösste Ausdehnung erreichte die Föderation Katalonien-Aragón vom 12. bis zum 14. Jahrhundert. Erst nach dem Spanischen Erbfolgekrieg zu Beginn des 18. Jahrhunderts verlor Katalonien seine Sonderrechte. Im Zeichen der Romantik entstand in den 1830er Jahren die kulturelle Aufbruchbewegung der «Renaixença». Die Sprache wurde nun zunehmend Instrument eines erstarkten ethnisch-nationalen Bewusstseins. In der Folge machte die sprachliche Standardisierung des Katalanischen Fortschritte: 1913 wurden orthographische Normen, 1918 eine offizielle Grammatik und 1932 ein Wörterbuch publiziert.
Mit dem Sturz der Monarchie in Spanien 1932 erhielt Katalonien ein Autonomiestatut; Katalanisch wurde Amtssprache. 1936 begann der Bürgerkrieg, 1939 die Franco-Diktatur, die alle regionalen Autonomiebestrebungen in Spanien drakonisch unterdrückte. Das Katalanische wurde aus Presse und Radio, von Strassenschildern, Werbeplakaten und sogar von Grabsteinen verbannt. Dazu kam, dass der materielle Wohlstand
Kataloniens zu einer starken Einwanderungsbewegung sozialer Unterschichten mit andern Sprachen Spaniens führte. Dennoch konnte sich das Katalanische in allen Bevölkerungsgruppen halten, da es unter der Franco-Diktatur ein Mittel des ethno-nationalen und vielfach auch linken Protestes war.
Seit den 1950er Jahren kam eine Wende in Gang. Ab 1965 wurde das Katalanische in der katholischen Kirche wieder als Verwaltungs- und Liturgiesprache anerkannt. 1967 wurde an der Universität von Barcelona eine Abteilung für katalanische Sprache zugelassen. In all diesen Jahren diente die Musik als Ausdrucksmittel der katalanischen Sprache.
Ab 1969 verstärkten sich die Autonomiebestrebungen Kataloniens. Die nach dem Tod Francos einsetzende Demokratisierung Spaniens brachte Katalonien kulturell wieder eine weitgehende Selbständigkeit. Die neue Verfassung Spaniens von 1978 verwarf dann die Vorstellung des Spanischen als einziger Nationalsprache. Das Autonomiestatut von 1979 stellte für Katalonien beide Sprachen gleichberechtigt nebeneinander. Zwar blieb Spanisch weiterhin die offizielle Staatssprache, die alle Spanier beherrschen müssen, aber die autonomen Regionen konnten nun ihrer eigenen Sprache einen offiziellen Status einräumen.
Die neue Sprachenpolitik veränderte tatsächlich die Ausgangslage. Dafür spricht eine 1991 durchgeführte Umfrage, wonach 94 Prozent der Befragten angaben, Katalanisch zu verstehen. Zwei der fünf in
Barcelona erscheinenden Tageszeitungen sind in Katalanisch verfasst. Auch an den Universitäten wird wieder katalanisch gelehrt und geprüft. Und in der Metro drohen Schilder den Schwarzfahrern unzweideutig, aber einsprachig, d.h. auf katalanisch, mit Bussen.
Sprachenblöcke
Eines steht fest: Im Unterschied zu Nordamerika, wo sich die verschiedenen Einwanderergruppen miteinander vermischten, besitzen die europäischen Völker mit ihren unterschiedlichen Sprachen Territorien, die sie hartnäckig verteidigen. Wo sich in einem Staat zwei starke Sprachgemeinschaften mit festen Territorien gegenüberstehen, entwickelt sich meist ein System der Sprachenblöcke, das auf das politische Gemeinwesen desintegrative Wirkungen hat.
Die Mehrsprachigkeit setzt einen föderalistischen Staatsaufbau voraus. In einem zentralistischen Einheitsstaat werden die Völker zentrifugal. Man gebe ihnen eine föderalistische Verfassung und sie werden zentripet. Das sagte schon im 19. Jahrhundert der österreichische Politiker Adolph Fischhof. 12 Man kann föderalistisch sein, ohne multinational zu sein; wenn aber der Staat multinational ist, muss er föderalistisch sein. In der Tschechoslowakei lösten die Sprachenblöcke den Zentralstaat auf.
Unter der Mitwirkung äusserer Mächte können aber sogar Bürgerkriege ausbrechen. Infolge des Einmarsches
türkischer Truppen zerbrach Zypern in zwei sprachlich und religiös unterschiedliche Teilstaaten, in Griechisch- und Türkisch-Zypern. Die politische Einheit ist vor allem dort gefährdet, wo ethnische und religiöse Gegensätze die kulturell-sprachlichen und die wirtschaftlichen überlagern. Das frühere Jugoslawien und der Kaukasus bieten illustrative Beispiele.
Da die Menschen in Zeiten raschen sozialen Wandels ein Minimum an Rückbindung und Tradition brauchen, produziert die Dynamik der Zeitgeschichte fortwährend ethno-nationalistische Reaktionen. Die Brüche und Verwerfungen der Krisenzeiten bilden den Nährboden von Nationalismen, deren Erscheinungsformen äusserst vielfältig sind.
Für die Europäische Union besteht die schwierige Aufgabe darin, den angestammten europäischen Völkern und ihren Lebensräumen die kulturelle Identität zu bewahren und gleichzeitig den Menschen die soziale Mobilität in der modernen Gesellschaft zu ermöglichen. Dabei könnte das Schweizer Modell durchaus nachahmenswerte Elemente aufweisen. Europa steht in einem gewissen Sinne vor der Entscheidung, sich zu balkanisieren oder zu helvetisieren. Hier stimme ich dem Philosophen Karl Jaspers weitgehend zu.
Irritationen in der Sprachenlandschaft der Schweiz
Die Schweiz definierte sich 1798 bzw. 1848 als multinationaler Staat von «Völkerschaften» und anerkannte die Mehrsprachigkeit als Ordnungsprinzip. 13 Dabei lauteten die Grundregeln der schweizerischen Sprachenordnung wie folgt:
Erstens besitzt die Schweiz keine alleinige Staatssprache wie die meisten europäischen Länder.
Zweitens gilt der ungeschriebene Verfassungsgrundsatz der individuellen Sprachenfreiheit, die allerdings keinen absoluten Charakter besitzt. Die Sprachenordnung sieht Einschränkungen vor, sofern diese im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig erscheinen.
Drittens ist der Sprachenschutz an territoriale Einheiten und nicht an personale Verbände gebunden. Dadurch besitzt jede Landessprache ihren angestammten territorialen Bereich, dessen Umfang —und das ist entscheidend —durch die Gemeinden und die Kantone bestimmt ist. Die Kantone sind befugt, dafür zu sorgen, dass die Einwohner in der Schule die offizielle Sprache der Region erlernen und diese im Verkehr mit den Gemeinde- und Kantonsbehörden verwenden.
Viertens kennt die schweizerische Verfassung keine staatsrechtlichen Sprachenblöcke. Die Sprachgemeinschaften besitzen keine staatlichen Institutionen wie in Belgien. Die Behörden hüten sich, ihre Bürger nach sprachlichen Kriterien einzuteilen. In den Identitätskarten
fehlt jeder Hinweis auf die sprachliche Zugehörigkeit. Demgegenüber wurde in der Schweiz die Religion oder Konfession aufgrund anderer historischer Voraussetzungen jahrzehntelang in den Pässen vermerkt.
Stabile Stärkeverhältnisse
Diesen Prinzipien ist es weitgehend zu verdanken, dass der Sprachenfrieden in der Schweiz bisher erhalten werden konnte. Die Stärkeverhältnisse der Sprachgemeinschaften blieben in hohem Grade stabil, obwohl das Land seit dem 19. Jahrhundert eine gewaltige wirtschaftliche Entwicklung mit enormen sozialen Mobilitäten durchmachte.
Anlässlich der Volkszählung von 1860 betrug bei der Schweizer Bevölkerung die deutschsprachige Mehrheit 69,5 Prozent. 14 1910 waren es 72,7 Prozent, 1950 74,2 Prozent und 1990 73,4 Prozent. Das Französische verlor gegenüber dem Deutschen bei der Schweizer Bevölkerung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts rund drei Prozentpunkte: 1860 23,4, 1910 22,1, 1950 20,6 und 1990 20,5 Prozent. Die italienischsprachigen Schweizer zählten stets ungefähr 4 Prozent: 1860 5,4, 1910 3,9, 1950 4,0, 1990 4,1 Prozent. Der Anteil der rätoromanischsprechenden Schweizer lautete 1860 1,7, 1910 1,2 und 1950 1,1 Prozent. Im Jahre 1990 gaben noch 0,7 Prozent der Schweizer Rätoromanisch als ihre Hauptsprache an, was rund 40'000 Personen entspricht.
Bei der gesamten Wohnbevölkerung, in der die Ausländer einbezogen sind, sieht das Zahlenverhältnis ähnlich aus. Die Deutschsprachigen verloren zwar wegen der starken Einwanderung aus den lateinischen Ländern in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an Boden, während die Italiener gewannen. 1910 waren 8,1, 1950 5,9 und 1990 7,6 Prozent italienischer Sprache. Den Höhepunkt verzeichnete die italienischsprachige Wohnbevölkerung 1970 mit 11,9 Prozent.
Nachzutragen ist, dass in diesen Statistiken nur die Sprachenverteilung bei den offiziell anerkannten Nationalsprachen aufgeführt ist. Zieht man alle Sprachen mit ein, so übertreffen einzelne Sprachgruppen von ausländischen Einwohnern die rätoromanische Landessprache: 1990 sprachen 117'000 Einwohner Spanisch, 109'000 Serbokroatisch, 94'000 Portugiesisch und 61'000 Englisch.
Die Bilanz liegt auf der Hand: Sieht man vom Rätoromanischen ab, kann man in der Schweiz für das 19. und 20. Jahrhundert nicht von einer sprachlichen Homogenisierung der Sprachenlandschaft sprechen. Im Gegenteil, der politische Schutz der minoritären Sprachgruppen gewann im 20. Jahrhundert an Bedeutung.
Trotz der aussergewöhnlichen Stabilität der Sprachenverhältnisse stehen in der Schweiz die Sprachgruppen in einem labilen Beziehungsnetz zueinander. Da die Menschen im Verlaufe ihres Lebens ihre Identifikationen verändern, bewerten sie zu verschiedenen
Zeiten ihre Sprache unterschiedlich. Es gab in der Schweizer Geschichte Perioden, in denen das nationalpolitische Interesse derart im Vordergrund stand, dass die kulturellen Unterschiede der Sprachgruppen zurückstehen mussten. So beherrschte die Ideologie des Schweizertums die Zeitperiode von 1935 bis 1970. Als Reaktion begannen die Sprachgemeinschaften in den späten 1960er Jahren ihre kulturelle Identität neu zu entdecken.
Wenn wir das Verhältnis zwischen Deutsch- und Welschschweiz genauer anschauen, lassen sich fünf Phasen hervorheben:
1. Die Vorherrschaft der Kulturkämpfe 1830-1880: Die Gründungsväter der Verfassung von 1848 fanden auf äusserst pragmatische Weise zur Mehrsprachigkeit. Der Verfassungsentwurf von 1847 enthielt noch keine Bestimmungen zur Sprache. 15 Erst in der Parlamentsdebatte brachte der Vertreter des Kantons Waadt einen entsprechenden Antrag ein. Da die Waadtländer gleichzeitig erklärten, man verlange nicht die dreisprachige Abfassung der Parlamentsprotokolle, wurde der Vorschlag ohne Gegenstimme angenommen. Damit wurde die Mehrsprachigkeit der Schweiz in Anlehnung an die Helvetische Republik von 1798 zum Verfassungsgrundsatz erhoben. Grosse öffentliche Beachtung fand dieser Entscheid nicht, weil die Schweizer sich in den stürmischen Zeiten von 1830-1848 hauptsächlich um die föderalistische
Staatsform und die Stellung der katholischen Kirche stritten. Dies hat der Historiker Francis Python eindrücklich aufgezeigt. 16
Erst die nationalen Einigungsbewegungen in Deutschland und in Italien hatten zur Folge, dass die Schweizer ihr politisch begründetes Nationalverständnis klar definierten, um der sprachnationalen Sogwirkung ihrer Nachbarländer entgegenzuwirken. 17 Auf diese Weise konsolidierte sich der junge Bundesstaat wirtschaftlich, politisch und ideologisch, bevor die europäischen Nationalismen im Ersten Weltkrieg eskalierten. Dabei profitierte er davon, dass die Kulturkämpfe der Jahre von 1830 bis 1880 die Sprachgrenzen relativierten und über diese hinweg ein multikulturelles Netz von weltanschaulich-politischen Loyalitäten schufen. Als in den 1880er Jahren der Kulturkampf abflaute, waren die weltanschaulichen Solidaritäten derart stark verankert, dass sich die Parteienlandschaft quer zu den Sprachgruppen bildete. Ein katholisch-konservativer Freiburger französischer Sprache fühlte sich einem katholisch-konservativen Luzerner deutscher Sprache mehr verbunden als einem radikal-liberalen Genfer französischer Zunge. Sprachsolidaritäten spielten in der Inkubationsperiode des Nationalstaates von 1800 bis 1880 eine geringe Rolle.
2. Von Animositäten zum Sprachengraben 1880-1918: Als Folge der industriellen Modernisierung
und Mobilität verschlechterten sich gegen die Jahrhundertwende von 1900 die Beziehungen zwischen den schweizerischen Sprachgruppen. Um 1900 fühlten sich vor allem die Tessiner marginalisiert und beruhigten sich erst mit dem Eintritt Giuseppe Mottas in den Bundesrat 1911. 18
Im Ersten Weltkrieg öffnete sich der berühmte Graben zwischen der deutschen und der französischen Schweiz, der ohne die aussenpolitische Neutralität das Land gesprengt hätte. 1914 appellierte der Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger Carl Spitteler eindringlich an die staatspolitische Neutralität der Schweizer und bat sie, ihre gegensätzlichen Sympathien mit den Nachbarnationen im Hinblick auf die gemeinsame Geschichte und die gemeinsame Staatsbürgerschaft zurückzustellen. 19 Im Gefolge des Grabens entstand auch der Begriff «Romandie», der die Distanz zu Bem und Pans in gleicher Weise betonte. 20
Nach 1918 verlor das Malaise zwischen Deutsch und Welsch fast plötzlich an Bedeutung, obwohl die Schweizer Behörden kaum praktische Massnahmen ergriffen hatten. Versöhnend wirkte die Bundesratswahl des Genfers Gustave Ador als Nachfolger des gestürzten germanophilen Arthur Hoffmann im Jahre 1917. Langfristig brachte der Landesstreik von 1918 die Wende, da er den sozialen Graben des Klassenkampfes mit voller Wucht ins öffentliche Bewusstsein trug und die sprachlich-kulturellen Streitigkeiten verdrängte.
3. Die Zwischenkriegszeit und der Zweite Weltkrieg im Zeichen der geistigen Landesverteidigung: Während die Staatstheoretiker im späten 19. Jahrhundert die Vielsprachigkeit noch als Hemmfaktor für den nationalen Zusammenhalt einstuften, begannen die Politiker und Intellektuellen nun die Mehrsprachigkeit zur eigentlichen Staatsidee emporzustilisieren. Durch den gemeinsamen Widerstand aller vier Sprachgemeinschaften gegen die totalitären und ethnonationalistischen Volkstumsideologien des Nationalsozialismus und des Faschismus formte sich in der Periode von 1920 bis 1940 das multinationale Staatsbewusstsein der Schweizer endgültig heraus. 21 1938 nahm das Volk demonstrativ einen neuen Sprachenartikel in die Bundesverfassung auf, der das Rätoromanische zur vierten Landessprache erklärte.
4. Wohlwollende Gleichgültigkeit 1945-1970: Nach dem Zweiten Weltkrieg prägte der Ost-West-Konflikt die geistige Landschaft der Gesellschaft. In den langen fünfziger Jahren beherrschten Wirtschaftswachstum und Wohlstand sowie der Ausbau des Sozialstaates die Politik. Die Sprachenfragen wurden überdeckt. Zwischen den Landesteilen bestand eine wohlwollende Gleichgültigkeit; auf politischer und sozialer Ebene dominierte bis 1965 die Konkordanzstimmung. Selbst im Kanton Freiburg, wo die frankophone Mehrheit jahrzehntelang ängstlich an ihrer Hegemoniestellung festhielt und die deutschsprachigen
Freiburger faktisch diskriminierte, konnte die deutschsprachige Minderheit ihre Stellung verbessern. 1960 erhielt die deutsche Minderheit zwei Staatsräte, was dem kantonalen Sprachenproporz entsprach. 22
5. Der Vormarsch des Sprachenregionalismus nach 1970: Gegen Ende der sechziger Jahre änderte sich das einvernehmliche Klima zwischen Deutsch und Welsch und führte zunächst zu punktuellen Konflikten. Die Diskussionen entzündeten sich an der Besetzung hoher Posten in der Bundesverwaltung oder in der Armee, bei denen die Romands übergangen wurden. Die Welschen beklagten sich auch darüber, dass das Französische im Alltag der Bundesverwaltung eine schwache Stellung besässe. In den achtziger Jahren kritisierten sie den Vormarsch des Dialekts in den elektronischen Medien der deutschen Schweiz und warnten vor einer Hollandisierung. 23 Wenn sich die Schweizer Mundart in Richtung einer eigenen Sprache entwickle, drohe den Deutschschweizern eine ähnliche Marginalisierung ihrer Sprache wie den Niederländern.
Es wäre indessen falsch, in den siebziger und frühen achtziger Jahren von einem «welschen Nationalismus» zu sprechen. Eine «identité romande» existierte nicht. Allerdings nahm die «idée romande», die früher hauptsächlich literarischen Charakter besass, nun politische Züge an. Als 1981 die «Association romande de solidarité francophone» eine trikoloreähnliche
Romandie-Fahne lancieren wollte, war das Echo in der Westschweiz aber reserviert. 24 1982 erschien von Alain Charpilloz und Geneviève Grimm-Gobat die Schrift «La Romandie dominée», die das Vetorecht der sprachlichen Minderheiten propagierte. 1984 lancierte der Freiburger Georges Andrey den Neologismus «Romandisme». 25
Den grössten Erfolg verbuchte das ethnonationale Denken bei der Entstehung des Kantons Jura in den siebziger Jahren. 26 Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte das separatistische «Rassemblement jurassien» den Konflikt zu ethnisieren und den zugewanderten Deutschschweizern das Stimrnrecht in der Abstimmung über die Trennung des Juras vom Kanton Bern abzusprechen. Roland Béguelin wollte die Schweiz umbauen und die Romandie zu einer «entité intermédiaire» zwischen den Kantonen und der Eidgenossenschaft machen. Bemerkenswerterweise stiess der Rassemblement-Führer mit seinen Postulaten zum «ethnischen Föderalismus» in der welschen Schweiz auf keine Gegenliebe.
Die Kaskade der Volksabstimmungen, die 1974 eine knappe Mehrheit für die Gründung des neuen Kantons ergab, liess im Jura die jahrhundertealte Konfessionsgrenze hervortreten. Die ethno-linguistischen Thesen der Separatisten, die von einer Einheit des Jura ausgegangen waren, wurden nicht bestätigt. Die französische Sprache allein genügte nicht, den neuen Kanton zu konstituieren.
Schleichende Belgisierung der Schweiz?
Am Ende des 20. Jahrhunderts befindet sich die Schweiz in einer ähnlichen Lage wie zu Beginn des Saekulums: Die Sprachgruppen streben auseinander. Ohne Zweifel nimmt der Sprachenregionalismus zu und lässt die politischen Grenzen der Kantone und die weltanschaulichen Barrieren der klassischen Parteimilieus in den Hintergrund treten.
Die Mehrheit der Deutschschweizer überstimmt ohne Skrupel die Romands in den Europafragen und schafft damit einen psychologischen Graben. Die Tessiner schwanken zwischen einem saturierten Réduitdenken in der Wohlstandsprovinz und einer oszillierenden Faszination für die wiederentdeckte Lombardei. Und die Welschen ziehen sich in den Schmollwinkel einer künstlich stilisierten Romandie zurück.
In der Westschweiz blieben freilich die kulturseparatistischen
Tendenzen nicht unwidersprochen. Der
Historiker Pierre du Bois schrieb 1984: «Mais existe-t-il
une conscience romande positive? Les réactions
minoritaires ne semblent pas déboucher sur une
romandisation des esprits. A l'usage, les clivages traditionnels
demeurent. Et demeurent les consciences qui
les sous-tendent. Même au moment où la question des
langues, au début du siècle, trouble la Suisse, l'idée
romande reste circonscrite à des cercles très
restreints.» 27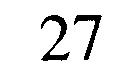
Auf der anderen Seite postulierte im Herbst 1992 der Genfer Staatsrat Guy-Olivier Segond anlässlich einer vom «Nouveau Quotidien» und vom Westschweizer Fernsehen organisierten Tagung in Glion die Bildung eines mit Entscheidungskompetenzen ausgestatteten Rates der französischsprachigen Kantone. 28 Die Stimmung ist ambivalent.
Fällt die Schweiz in Sprachenblöcke auseinander?
Die kulturelle Krise zwischen den Sprachgemeinschaften ist so schwerwiegend, dass wir eine Auslegeordnung der Probleme vornehmen müssen. Welche Faktoren sind für die schleichende Belgisierung verantwortlich? 29
1. In dem Masse, in dem sich die traditionellen Bindungen der klassischen Parteimilieus nach 1970 lockerten, wurden die orientierungslos gewordenen Menschen für neue politische Heilslehren anfällig. Dabei boten sich — scheinbar — natürliche Kategorien wie die Sprache als Integrationselemente an. Je mehr sich die von der Konsumwirtschaft bestimmten Moden anglichen, desto stärker wuchs in den Menschen das Bedürfnis, sich wenigstens in der kulturellen Identität voneinander zu unterscheiden. Damit gewann die Sprachenfrage an Bedeutung, ohne dass dies der politischen Öffentlichkeit zunächst bewusst wurde.
2. Nachdem die konfessionellen Fragen des Kulturkampfes und die sozialen Themen des Klassenkonfliktes weitgehend aus den öffentlichen Debatten verschwunden
waren, traten zum Teil sprachenpolitische Themen an deren Stelle. Für Quebec und Flandern wiesen Sozialwissenschaftler nach, dass der Regionalismus an Stärke gewann, als die Kirchen ihre gemeinschaftsbildende Kraft verloren.
3. Die Dominanz der Deutschschweiz in Politik und Wirtschaft schuf unter den sprachlichen Minderheiten ein Reizklima. Minderwertigkeitskomplexe regten sich, die Gruppenidentität wuchs.
Als Reaktion betonen die Romands ihren Minderheitenstatus stärker und unterstreichen die kulturelle Differenz, was in eine politische Rebellion umschlagen kann. Der Druck aus der Deutschschweiz hat zur Folge, dass die französischsprachigen Schweizer ihre kulturelle Eigenart vermehrt hervorheben und zu ihrer Verteidigung die Romandie als künstliche Einheit erfinden.
Dieses Phänomen ist nicht neu, erhält aber neue Facetten. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestand ein welsches Inferioritätsgefühl gegenüber der wirtschaftlich stärkeren deutschen Schweiz, das sich damals in einem spezifisch welschen Patriotismus äusserte. 30
Zahlreiche Politiker und Intellektuelle erklären die Wirtschaftsprobleme der Westschweiz nicht mehr mit sozioökonomischen, sondern mit kulturellen oder sogar ethnischen Faktoren. Probleme wie Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot und die damit verbundenen sozialen Ungleichheiten werden als Folgen ethno-linguistischer
Differenzen wahrgenommen. Die Wirtschaftsmetropole Zürich erscheint vielen Romands als Inbegriff der hässlichen Deutschschweiz, die die lateinische Schweiz erbarmungslos an den Rand drängt. Gerade im Jahre 1996 verletzten Unternehmen wie die «Swissair», die «Novartis» und «Feldschlösschen» mit ihren ökonomisch motivierten Entscheiden die Gefühle der Welschen.
4. Den Massenmedien kommt in diesem Wandlungsprozess eine Schlüsselrolle zu. Bis um 1970 besassen die Westschweizer Kantone politische Öffentlichkeiten, die mehr oder weniger auf die kantonale Politik ausgerichtet waren. Mit der Pressekonzentration entstanden in Lausanne und Genf überregionale Zeitungen, die sich an das gesamte Welschland wenden. Dadurch entsteht im öffentlichen Raum unter dem Druck der Medien und der Politik allmählich eine segregierte Gesellschaft, die von Klischees und Vorurteilen geprägt ist. Die gewöhnlichen Leute, die am Stammtisch oder im Gesangsverein schiedlich und friedlich miteinander zusammenleben, fangen in den Zeitungen und in den Ratssälen an, die imaginierte Gemeinschaft der Romands oder der Deutschsprachigen zu verteidigen. Strassenschilder, Bahnhofbeschriftungen und Zugsankündigungen werden zu ersten ethno-linguistischen Schlachtplätzen.
Aus zahlreichen Studien wissen wir, dass die Schweizer lieber auf die Medien des sprachverwandten Nachbarlandes ausweichen, als das Radio und das
Fernsehen der anderssprachigen Landsleute zu benutzen. 31 Das hat zur Folge, dass die sprachenregionale Aufteilung und damit die latente Ethnisierung im Bewusstsein der Menschen voranschreiten. Deutsch-, Französisch- und Italienischschweizer betrachten die Welt durch verschiedene Brillen. Am besten kann man dies in der zweisprachigen Stadt Freiburg jeden Morgen an den unterschiedlichen Presseaushängen feststellen.
5. Im Zusammenleben zwischen der deutschen und lateinischen Schweiz erschwert der unterschiedliche Stellenwert der gesprochenen und geschriebenen Sprache das gegenseitige Verständnis. Ohne Zweifel: die Dialekte der Deutschschweizer vergrössern die Sprachenbarrieren. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass für die Deutschschweizer der Dialekt ein wesentliches Identitätsmerkmal darstellt, um sich von den Deutschen zu unterscheiden. Ausserdem verkörpern die Mundarten die politische Vielfalt der Kantone.
Für den nationalen Zusammenhalt der Schweiz hatte dies Vorteile: Weil die Deutschschweizer bisher ein äusserst fragmentiertes Sprachenbewusstsein besassen, strebten sie keine kulturelle Vereinheitlichung an. Ihre partikularistische Mentalität hatte zur Folge, dass sie trotz ihrer zahlenmässigen Stärke keine ernsthaften Anstalten trafen, ihre Sprache zum Merkmal des schweizerischen Staates zu machen und sie als Staatssprache den andern Sprachgruppen aufzuzwingen.
Es waren nicht zuletzt die Mundarten, die die Germanisierung der Schweiz verhinderten. Wenn man über die Nachteile der Dialektwelle spricht, darf man dies nicht ausser Betracht lassen.
Eine gegenläufige Tendenz ist nicht zu unterschätzen: Je mehr sich die Deutschschweizer über die elektronischen Medien, vorab über das Fernsehen, in den hochdeutschen Sprachraum integrieren und ein Standarddeutsch zu sprechen beginnen, desto mehr wächst die kulturelle Nivellierung. Auch im alemannischen Teil bestehen sprachnationale Tendenzen, die dazu führen können, dass kulturimperialistische Attitüden entstehen.
An der Wurzel des Verständigungsproblems steht nicht der Dialekt, sondern die mangelnde Sprachenkompetenz auf beiden Seiten. Die Romands, die sich über die Mundartwelle in Radio und Fernsehen der deutschen Schweiz aufregen, lesen kaum Deutschschweizer Zeitungen, obwohl diese durchaus in einem korrekten Hochdeutsch verfasst sind. Umgekehrt benutzen die Deutschschweizer und die Tessiner das welsche Fernsehen und Radio nicht häufiger, auch wenn sie dort nicht auf die Dialektbarriere stossen. In diesem Zusammenhang könnte allerdings die Wirtschaftskrise eine positive Wirkung auf die Beziehungen der französischen zur deutschen Schweiz ausüben. Durch die verschärfte Situation auf dem Arbeitsmarkt sehen sich nämlich viele Romands und Deutschschweizer veranlasst, sich bessere Fremdsprachenkenntnisse
anzueignen, um so ihre Chancen am Arbeitsplatz zu verbessern.
6. Als eigentliche Bedrohung der Vielsprachigkeit der Schweizer ist der Vormarsch des Englischen als Kommunikationssprache in Wirtschaft, Technik und Hochschulen anzusehen. Die Landessprachen verlieren ihre Bedeutung als Zweitsprache. 32
Krise der schweizerischen Viersprachigkeit
Ins öffentliche Bewusstsein traten die latenten Spannungen zwischen der deutschen und der welschen Schweiz wie ein Donnerschlag am 6. Dezember 1992 nach der Volksabstimmung über den Beitritt zum «Europäischen Wirtschaftsraum» (EWR). Einmal mehr sah sich die französische Schweiz durch die Deutschschweizer majorisiert.
Da die Medien seit 1970 dem Sprachenthema hohe Aufmerksamkeit schenken, rücken die Resultate der Volksabstimmungen regelmässig in den Brennpunkt der öffentlichen Debatte. Diese Perspektive entspricht der Tatsache, dass das Stimmverhalten der Schweizer seit den siebziger Jahren stärker vom Sprachenfaktor bestimmt wird.
Trotzdem bezeichnen die Schweizer die Sprachenfrage
in Umfragen nicht als vordringliches Problem.
Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Viele
Deutschschweizer neigen wie alle Mehrheiten dazu,
die Probleme der Minderheiten zu übersehen oder zu
bagatellisieren.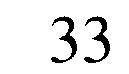
Die Krise der schweizerischen Mehrsprachigkeit ist nicht zu bestreiten. Die viersprachige Schweiz läuft im ausgehenden 20. Jahrhundert Gefahr, in Sprachenblöcke auseinanderzufallen. Überall kommen ethno-linguistische Tendenzen auf. Soziale Konflikte werden ethnisiert und bekommen damit einen scheinbar unabwendbaren Charakter.
Zahlreiche Deutschschweizer beginnen im Rückgriff auf eine idealisierte Vergangenheit die Festung Schweiz gegenüber dem Ausland abzuschotten. Auf der andern Seite öffnen sich viele Welsche zwar dem neuen Europa, verschliessen sich aber in einem ähnlichen Ethnozentrismus den «confédérés» jenseits der Saane. Xenophobie bleibt Xenophobie, auch wenn sie sich —bloss —gegen die eigenen Landsleute richtet. Was den einen der antieuropäische Helvetismus ist, ist den andern der antialemannische Romandismus. Beide Ethnozentrismen stellen eine Art von kulturellem Populismus dar, der die Ängste der Menschen ausnutzt und die komplexen Probleme der Gesellschaft mit simplizistischen Klischees und Vorurteilen ethnisiert. Hüben und drüben werden Merkmale wie Nation oder Sprache gegen jedes Hinterfragen immunisiert und für die eigenen Zwecke politisch instrumentalisiert.
Die Krise der helvetischen Mehrsprachigkeit ist eine Krise der Gleichgültigkeit, in der die Formel von der Einheit in der Vielfalt zur nichtssagenden Phrase verkommt. 1965 schrieb Denis de Rougemont, dass die Schweiz deshalb gut funktioniere, weil die Schweizer
durch die politischen Institutionen miteinander verbunden seien, sonst aber in ihren eigenen Regionen und Kantonen ohne grosse gegenseitige Kenntnisse leben würden. 33
Am Ende des 20. Jahrhunderts ist diese These nicht mehr gültig. Wie René Knüsel, Hanspeter Kriesi und andere richtig feststellen, haben die wirtschaftlichen und politischen Interdependenzen auf nationaler und internationaler Ebene derart zugenommen, dass eine passive Koexistenz nicht mehr ausreicht. 34 Bis 1950 reagierten die Schweizer auf interkulturelle Probleme mit einem föderalistischen Reflex, der es den Sprachgemeinschaften ermöglichte, ihr Leben in den Kantonen mehr oder weniger nach eigener Façon zu gestalten. Diese Strategie versagt am Ende des 20. Jahrhunderts.
Und schliesslich eine letzte Bemerkung: Die Globalisierung
der Wirtschaft rückt das Englische derart in
den Vordergrund, dass die jungen Schweizer neben
ihrer Muttersprache eine andere Landessprache nur
noch halbbatzig und halbherzig lernen. Die viersprachige
Schweiz läuft Gefahr, zu einer anderthalbsprachigen
(= 1 1/2) Schweiz abzusinken. Immer deutlicher
zeigt sich, dass die Strategie des Laisser-faire-Laisser-aller
in der Sprachenfrage nicht mehr
genügt. Wenn sich der Proporz im Bereich der Politik
als Selbstverständlichkeit für den Umgang mit Minderheiten
durchgesetzt hat, muss sich das Proporzdenken
auch in der Wirtschaft ausbreiten. Von den 100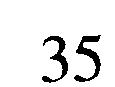
grössten Schweizer Firmen haben nur 16 ihren Hauptsitz in der französischen und bloss eine in der italienischsprachigen Schweiz. 35 Die Eidgenossenschaft braucht sprachenpolitische Regeln, an die sich auch die Wirtschaft über alles Profitdenken hinaus halten muss.
Neue Spielregeln
Noch weist die Schweiz im europäischen Vergleich eine hohe soziale Kohäsion auf. Die traditionellen Institutionen der Politik halten die Sprachgemeinschaften zusammen. Unter der Oberfläche der politischen Stabilität sind aber Tiefenströmungen vorhanden, die auf eine zunehmende Ethnisierung von Gesellschaft und Politik und damit auf die Bildung von Sprachenblöcken hindeuten. Vorläufig wirkt der Wohlstand noch als Kohäsionsfaktor.
Noch im Jahre 1966 konnte der Historiker Herbert Lüthy festhalten, dass die Schweiz mit Erfolg vermieden habe, die Mehrsprachigkeit zu problematisieren. 36 Diese Haltung ist am Ende des 20. Jahrhundert anachronistisch geworden. Die Schweiz braucht auf allen Ebenen eine bewusste Sprachenpolitik.
Ich halte diesen Vortrag am Dies academicus 1996 der zweisprachigen Universität Freiburg. Wie keiner andern Universität unseres Landes wächst ihr die nationale und internationale Aufgabe der interkulturellen Vermittlung zu. Als in Europa und der Schweiz einzigartige Brücke zwischen dem französischen und
deutschen Sprachraum sollte die Freiburger Universität im Hinblick auf das Bundesjubiläum von 1998 einen mutigen Schritt unternehmen und ein kulturwissenschaftliches Institut zur Verständigung der Kulturen und Sprachen gründen, das sich dem Verhältnis von Mehrheiten und Minderheiten widmet.
Wenn die Eidgenossenschaft weiterhin ein Modell für das multikulturelle Zusammenleben in Europa bleiben will, ist es unerlässlich, dass die einzelnen Kultur-, Sprach- und Religionsgemeinschaften zwar ihre kulturelle Identität behalten können, darüber hinaus aber den politischen Zusammenhalt der Staatsbürger-Nation anstreben. Dies betonte bereits im 19. Jahrhundert der Schriftsteller Gottfried Keller im «Grünen Heinrich», als er die doppelte Identität der Schweizer beschrieb —als Bürger der republikanischen Schweiz und als Angehörige der deutschen, französischen und italienischen Kultur.
Ein multikulturelles Gemeinwesen wie die Schweiz kann nur existieren, wenn es sich auf die Toleranz der politischen Kultur der Bürgergesellschaft stützt. Ich möchte diesen Gemeinsinn in altmodischer Weise Patriotismus nennen. Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas spricht in diesem Zusammenhang in Anlehnung an Dolf Sternberger von «Verfassungspatriotismus», der gegenüber der Verfassung politische Loyalität vom Bürger verlangt, aber keine Einschmelzung der kulturellen Unterschiede in einem Eintopf voraussetzt. 37
Was in der Schweiz notwendig ist, sind neue Spielregeln der «political correctness», die das Zusammenleben der Sprach- und Kulturgemeinschaften in der Politik und Kultur, aber auch in den Bereichen der Wirtschaft anleiten. Ohne eine bewusste Sprachenpolitik geht es nicht mehr.
ANMERKUNGEN
in: Die Schweiz. Mit Beiträgen von Hans Elsasser u.a., Redaktion: Hans-Georg Wehling, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1988; ders., Les rapports entre les groupes linguistiques, in: Handbuch Politisches System der Schweiz, Bd. 3, Föderalismus, hg. von Raimund E. Germann und Ernest Weibel unter Mitarbeit von Hans Peter Graf, Bern/Stuttgart 1986, 221-263; Iso Camartin, Nichts als Worte? Ein Plädoyer für Kleinsprachen, München 1985: Pierre du Bois (Hg.), Union et division des Suisses. Les relations entre Alémaniques, Romands et Tessinois aux XIXe et XXe siècles, Lausanne 1983; Robert Schläpfer (Hg.). Die viersprachige Schweiz, Zürich/Köln 1982; Hermann Weilenmann, Pax Helvetica. Oder die Demokratie der kleinen Gruppen, Zürich 1951; Cyril Hegnauer, Das Sprachenrecht der Schweiz, Zürich 1947.

minorités ethnolinguistiques autochtones à territoire: l'exemple du cas helvétique. Lausanne 1994.






