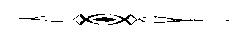Drei akademische Vorträge rechtsgeschichtlichen Inhalts,
gehalten zu Basel von
Basel. C. Detloff's Buchhandlung. 1881.
Schultze'sche Buchdruckerei (L. Reinhardt) in Basel.
Vorrede.
Ich übergebe hiermit drei Vorträge rechtsgeschichtlichen Inhalts, die ich in den Jahren 1878, 1879 und 1881 gehalten habe, gedruckt einem grösseren Publikum. Ich bitte bei der Beurtheilung dieser Vorträge nicht vergessen zu wollen, dass dieselben nicht speziell für den Gelehrten, sondern für ein weiteres akademisch gebildetes Publikum bestimmt sind. Der erste und dritte Vortrag sind unverändert zum Abdruck gelangt; der Text des zweiten dagegen ist erheblich verkürzt. Dafür sind die in denselben aufgenommenen Briefe bedeutend vermehrt, und vollständiger mitgetheilt, als diess in einem mündlichen Vortrag möglich war.
Basel, den 27. Februar 1881. Schulin.
I. Über das Wesen des Rechts, wie sich solches aus der Geschichte des römischen Rechtes erkennen lässt.
Rektoratsrede. gehalten am Jahresfeste der Universität,
in der Aula des Museums.
Das Wesen der Dinge, soweit dasselbe überhaupt für den menschlichen Verstand erkennbar ist, lässt sich nur aus einer geschichtlichen Betrachtung ihrer Entstehung erkennen. Es gilt diess nicht nur für die materielle, sondern ebenso wohl für die ideelle Welt. Die sog. descriptiven Wissenschaften liefern nur die erste positive Grundlage für das Streben nach der Erkenntniss. Der beste Geograph, der beste Astronom, der beste Anatom weiss uns, wenn er nichts weiter als Geograph, Astronom, Anatom ist, doch keinerlei Antwort zu geben auf die Frage: Was ist die Erde, was sind die Sterne, was ist der Mensch? Der beste Kenner einer Sprache oder der Vorschriften einer positiven Religion oder der Bestimmungen eines positiven Rechtes, sie alle sind bloss durch ihre Kenntniss noch nicht im mindesten im Stande, sei es eine einzelne Erscheinung im Gebiete ihres Wissens, sei es gar das Wesen der Sprache, der Religion, des Rechtes zu erklären.
Spekulative Contemplation des Gewordenen kann ihnen zur Erkenntniss nichts helfen; sie lässt sie in den Dingen nur wiederlesen,
 was sie selbst hineingeschrieben haben. Erst die Erforschung der
Entstehung des Gewordenen öffnet den richtigen Weg zur Erkenntniss.
Sie zeigt, was trotz aller Veränderung, soweit man rückwärts sehen
kann, stets das gleiche geblieben ist; sie zeigt, welcherlei Combinationen
welcherlei Wirkungen erzeugt haben, — und damit giebt
sie einen Fingerzeig, in welcher Richtung der Kern des Dinges zu
suchen sei. Keine Wissenschaft kann sich dieser Wahrheit verschliessen;
und wenn sie es doch thut, thut sie 's zum eigenen Tode. Und doch
hat jede Wissenschaft schon in dieser Richtung gesündigt und sich
damit an den Rand des Verderbens gebracht. Das Spekulieren
und Meditieren ist gar verführerisch.
was sie selbst hineingeschrieben haben. Erst die Erforschung der
Entstehung des Gewordenen öffnet den richtigen Weg zur Erkenntniss.
Sie zeigt, was trotz aller Veränderung, soweit man rückwärts sehen
kann, stets das gleiche geblieben ist; sie zeigt, welcherlei Combinationen
welcherlei Wirkungen erzeugt haben, — und damit giebt
sie einen Fingerzeig, in welcher Richtung der Kern des Dinges zu
suchen sei. Keine Wissenschaft kann sich dieser Wahrheit verschliessen;
und wenn sie es doch thut, thut sie 's zum eigenen Tode. Und doch
hat jede Wissenschaft schon in dieser Richtung gesündigt und sich
damit an den Rand des Verderbens gebracht. Das Spekulieren
und Meditieren ist gar verführerisch.
Die Rechtswissenschaft gehört zu denjenigen Wissenschaften, welche sich mit Vorliebe dieser Sünde schuldig gemacht haben, und wer wüsste nicht, dass sie in Folge dessen zeitweise so tief gesunken ist, dass man, vor lauter Unnatur ihre Natur gar nicht mehr erkennend, sie aus der Zahl der Wissenschaften hat streichen wollen. Nicht wenig hat zu diesen Fehlern gerade die Rezeption des römischen Rechtes, das uns in vollständig abgeschlossener und abgerundeter Form, wie ein vollendetes Kunstwerk entgegentrat, beigetragen; und doch ist gerade eine historische Betrachtung des römischen Rechtes in hohem Grade geeignet, den Weg zur Erkenntniss des Wesens des Rechtes zu ebnen.
Allerdings stellen sich dieser historischen Betrachtung des römischen Rechtes zwei grosse Hemmnisse entgegen: Die mangelhafte Ueberlieferung und unsere Unfähigkeit, die Dinge anders als durch unsere eigene Brille anzusehen. Die schönen Göttersagen Griechenlands malten sich dereinst in einem Griechenschädel ganz anders als in unserem Kopf, und in dem Praetor manches heutigen Pandektisten wäre wohl kaum ein Römer im Stande gewesen, einen Praetor zu erkennen. Aber einiges Studium des Antiken weiss doch diesen Mangel auf ein Geringes zu reduzieren, und auch die Quellen der Ueberlieferung fliessen nicht so karg, dass es uns unmöglich wäre, ein in den Hauptzügen richtiges Bild der Entwicklung des römischen
Rechts zu entwerfen, mögen auch im einzelnen Lücken vorhanden sein oder Irrthümer unterlaufen.
Was uns aber die Geschichte der Entwicklung des römischen Rechtes über das Wesen des Rechtes lehrt, ist folgendes:
Recht, Moral und Sitten oder Gebräuche sind ihrem innersten Wesen nach gleichartige Dinge, die sich nur durch Aeusserlichkeiten von einander unterscheiden. Es ist diess eine Wahrheit, welche bereits die klassische römische Jurisprudenz erkannt hatte, wenn sie sämmtliche Rechtsregeln iii die drei Sätze zusammenfassen zu können glaubte: Ehrbar leben, niemanden verletzen, jedem das Seine zukommen lassen; oder wenn sie das Recht definierte als das System des Guten und Billigen, als die gegliederte Zusammenstellung der Vorschriften, wonach der Mensch sein Leben einrichten soll. Das Wort Recht ist hier im erhabensten Sinne des Wortes gebraucht, in welchem es Sittlichkeit und Sitten mit umfasst. In diesem Sinne können wir das Recht definieren als die Richtschnur für das menschliche Wollen und Handeln.
Jeder Willensentschluss eines Menschen ist das Produkt eines Kampfes von Motiven, von denen eines stärker als die andern, sei es allein in ursprünglicher Kraft, sei es von andern unterstützt, sei es durch den Kampf mit andern geschwächt, den Geist und Körper eines Menschen zu einem gewissen Verhalten bestimmt. Unter diesen Motiven nehmen die Vorstellungen eines durch ein gewisses Verhalten herbeizuführenden Erfolges einen hervorragenden Platz ein. Ist nun einmal durch einen Willensentschluss, durch eine Handlung, für einen Menschen das Gefühl der Befriedigung erzeugt worden, so wird eben die Erinnerung an dieses Gefühl der Befriedigung in Zukunft ihm Motiv werden, bei ähnlichen Combinationen wieder gerade so zu handeln. Worin das Gefühl der Befriedigung, die Empfindung der Annehmlichkeit, besteht, und ob der Mensch zur ersten ihm Befriedigung verschaffenden Handlung nur durch blindes Herumtasten gelangt, oder ob ihn nicht vielmehr eine gewisse Naturanlage mit Nothwendigkeit zu derselben hinführt, das sind Fragen,
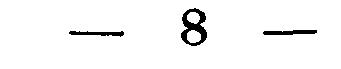 deren Beantwortung dem Rechtshistoriker als solchem unmöglich ist,
und die deshalb hier vollständig ausser Betracht bleiben.
deren Beantwortung dem Rechtshistoriker als solchem unmöglich ist,
und die deshalb hier vollständig ausser Betracht bleiben.
Aus einer grösseren Reihe von Erinnerungen an Handlungen, wodurch das Gefühl der Befriedigung erzeugt wurde, wird sich allmählich eine Summe von Regeln bilden, die Motive sein werden für das zukünftige Handeln des Menschen. Diese Summe von Regeln, diese Richtschnur für sein Wollen und Handeln sind sein Recht, sind seine Sitte, sind sein Charakter. Das in diesem Recht gegebene Motiv wird allerdings nicht immer den Ausschlag geben bei den Willensentschlüssen des Menschen; es kann in einem bestimmten Fall von anderen, stärkeren Motiven besiegt werden. In diesem Fall handelt der Mensch nach seiner eigenen Auffassung unrechtlich, unsittlich: er geräth mit sich selbst in Widerspruch, und sein Gewissen wird ihn dafür züchtigen; im anderen Fall handelt er nach seiner Auffassung rechtlich, sittlich.
Sein Recht oder seine Sitte bildet sich nun aber der Mensch nicht allein durch seine Erfahrung weiter aus, sondern auch durch Reflexionen, so dass man hier schon, wo manchem vielleicht das Wort Recht kaum als gerechtfertigt erscheinen mag, die beiden grossen Massen unterscheiden kann, in welche das Recht im gewöhnlichen Sinne des Wortes von jeher zerfallen ist, und in welche es in alle Ewigkeit zerfallen wird: Gewohnheitsrecht und Gesetzesrecht.
Was die Eltern als Recht erkannt haben, theilen sie ihren Kindern mit; was die in einer Lebensgemeinschaft lebenden Menschen als Recht erkennen, theilen sie sich gegenseitig mit. So entstehen traditionelle und allgemeine Vorstellungen von Recht. Diese allgemeinen Rechtsvorstellungen absorbieren die individuellen Rechtsvorstellungen nicht vollständig. Für ein grosses Gebiet des menschlichen Wollens und Handelns gelangen allgemeine Rechtsvorstellungen überhaupt gar nie zur Ausbildung. Wenn sie aber einmal für ein gewisses Gebiet zur Ausbildung gelangt sind, so beanspruchen sie innerhalb dieses Gebietes eine absolute Anerkennung von jedermann; sie dulden innerhalb dieses Gebietes, so lange sie nicht etwa
abgeblaßt sind, keine individuellen Rechtsvorstellungen neben sich. Wer den allgemeinen Rechtsvorstellungen zuwider handelt, scheidet sich damit selbst aus der Gemeinschaft aus; und dass er sich ausgeschieden hat, werden ihn seine Genossen fühlen lassen, bald in schwächerem, bald in stärkerem Grad, bis zur vollständigen Ausstossung, ja bis zur Tödtung, je nachdem sie ehrenhafte oder unehrenhafte, in individuellen Rechtsvorstellungen begründete oder nicht darin begründete Motive annehmen.
Diess sind die Uranfänge des Rechtes. Ein Unterschied zwischen Recht und Sitte, zwischen Rechtlichkeit und Sittlichkeit kann hier noch nicht gemacht werden.
Für die Weiterbildung des Rechtes zu dem, was wir heute darunter verstehen, sind namentlich dreierlei Faktoren massgebend: die Religion und die Entstehung und Entwicklung religiöser Genossenschaften, dann die Bildung und Entwicklung des Staates, endlich die Entstehung und Entwicklung anderer organisierter menschlicher Lebensgemeinschaften.
Keines Menschen Verstand ist so blöde, dass der Mensch sich selbst fur den Schöpfer und Herrn der Welt hielte. Jeder Mensch weiss sich selbst und seine Schicksale abhängig von einer höheren Gewalt, und durch Abstraktion kommt er zur Annahme der Existenz eines höheren, die Welt regierenden, göttlichen Wesens. Wie über das Recht, so bilden sich auch über dieses göttliche Wesen bei in Lebensgemeinschaft mit einander lebenden Menschen gemeinsame Vorstellungen aus.
Je nachdem ein Volk mit besserer oder geringerer Auffassungsgabe ausgestattet ist, je nachdem es mehr oder minder im Stande ist, sich die natürlichen Zusammenhänge der Vorgänge, die es sieht, zu erklären, desto mehr oder weniger wird es bei allem, was da geschieht, an das Eingreifen dieses übernatürlichen, mit unbekannter Machtfülle ausgestatteten Wesens denken.
Hat das Volk ein fein organisiertes Nervensystem, lebt es unter Verhältnissen und in einem Klima, wo der Himmel lacht, und die
 Beschaffung der täglichen Lebensnothdurft nicht viel Mühe macht,
so wird es geneigt sein, zu idealisieren, zu phantasieren; es wird
sich ein höchstes Wesen ausmalen als Lenker der Welt, das mit den
einzelnen Menschen, den höchstgebildeten materiellen Wesen, die es
kennt. — und höheres, unsichtbares hatte es ja nie gesehen, kennt
es also auch nicht, — die grösste Aehnlichkeit hat, nur dass man es
vollkommener denkt, als man selbst ist; dass man ihm alle möglichen
Schwächen, die man an sich selbst entdeckt, abdenkt; — ja, wenn
die Denkkraft des Volkes sehr ausgebildet ist, so wird man sogar bemüht
sein, sich das vollkommene menschenähnliche Wesen ohne Körper
zu denken: ein Versuch, der allerdings kaum je vollkommen gelingt.
Der mächtige und majestätische Gott, der uralte und doch ewig junge
Mann, mit würdevollem Antlitz, mit alles durchbohrendem, mildem
oder zornigem Auge, mit langem, weissem Bart, der auf einer Wolke
schwebt und von Blitzen und Donnern getragen wird, er spuckt doch
mehr oder minder in dein Gehirn eines jeden Menschen, der überhaupt
an einen Gott glaubt. Der materielle Mensch kann sich nie
von der Materie ganz lossagen.
Beschaffung der täglichen Lebensnothdurft nicht viel Mühe macht,
so wird es geneigt sein, zu idealisieren, zu phantasieren; es wird
sich ein höchstes Wesen ausmalen als Lenker der Welt, das mit den
einzelnen Menschen, den höchstgebildeten materiellen Wesen, die es
kennt. — und höheres, unsichtbares hatte es ja nie gesehen, kennt
es also auch nicht, — die grösste Aehnlichkeit hat, nur dass man es
vollkommener denkt, als man selbst ist; dass man ihm alle möglichen
Schwächen, die man an sich selbst entdeckt, abdenkt; — ja, wenn
die Denkkraft des Volkes sehr ausgebildet ist, so wird man sogar bemüht
sein, sich das vollkommene menschenähnliche Wesen ohne Körper
zu denken: ein Versuch, der allerdings kaum je vollkommen gelingt.
Der mächtige und majestätische Gott, der uralte und doch ewig junge
Mann, mit würdevollem Antlitz, mit alles durchbohrendem, mildem
oder zornigem Auge, mit langem, weissem Bart, der auf einer Wolke
schwebt und von Blitzen und Donnern getragen wird, er spuckt doch
mehr oder minder in dein Gehirn eines jeden Menschen, der überhaupt
an einen Gott glaubt. Der materielle Mensch kann sich nie
von der Materie ganz lossagen.
Ist nun aber die Phantasie eines Volkes, angeregt durch die Naturerscheinungen, die es nicht erklären kann, eine sehr bewegte, so wird sie sich nicht begnügen mit der Annahme des einen höchsten, alleinherrschenden Wesens, sondern sie wird sich den ganzen unsichtbaren Weltraum bevölkert denken mit unzähligen unsichtbaren Wesen; jede unerklärte Wirkung, die man sieht, wird man der Thätigkeit eines solchen unsichtbaren Wesens zuschreiben. Die Wirkungen, die man sieht, erscheinen nicht immer als gute; man hätte geglaubt, ein guter: Mensch hätte etwas anderes verdient, als Unglück; man hätte geglaubt, eine Saat, die da zerstört ist, hätte aufgehen müssen: man schreibt diese Wirkungen dem Wirken einer unheilbringenden, tückischen Macht zu. Und wenn man dann wieder Freude erlebt im Leben, wenn Kinder geboren werden und heranwachsen, und wenn man in ihnen sich selbst wieder verjüngt sieht, nur schöner und edler; wenn die Ernte herrlich gediehen ist und gar nicht alle untergebracht
werden kann in den vorhandenen Scheunen; wenn der Himmel lacht und alles Fröhlichkeit und Seligkeit athmet; — ja dann kann es nicht ausbleiben, dann erblickt man darin das Wirken der guten, der segenbringenden, der himmlischen Götter.
In dem Wechsel von Glück und Unglück erblickt man das Resultat eines Kampfes der guten und bösen Götter; die verschiedensten Zufälligkeiten und Ereignisse geben Anlass zu den verschiedensten Phantasiegemälden, und es bilden sich allmählich die verwickeltsten Göttersagen aus.
Den Göttern aber, die der Mensch sich selbst erdacht, bringt er Opfer und Gebete dar. Es ist das Bewusstsein der eigenen Macht- und Hülflosigkeit; es ist die Furcht und das Grauen, das ihn erfüllt, vor der unbekannten Macht ihm unbekannter Wesen, deren Werke er beständig vor Augen sieht; es ist das Gefühl der Dankbarkeit für die Wohlthaten, die ihm diese unbekannten Wesen erwiesen haben, — das ihn veranlasst, diese Wesen zu verehren; er dankt für das Gute, das sie ihm haben zu Theil werden lassen; er bittet um weiteren Segen; durch Demuth und Unterwürfigkeit, durch Gebete und Geschenke hofft er ihren Zorn von sich abzuwenden, hofft er zu erlangen, dass ihre schädlich wirkende Macht ihn gütigst verschonen werde.
So geht's bei höher begabten Völkern mit glücklicher Naturanlage, die unter glücklichen Verhältnissen leben.
Ist aber die Phantasie eines Volkes schwach, oder ist sie durch ungünstige Verhältnisse erstickt worden, dann kommt das Volk nicht dazu, sich ideale Vorstellungen von dem Herrn und Lenker der Welt zu machen. Die Wirkungen werden gesehen, aber ihre Hervorbringung wird den einflusslosesten Dingen auf der Welt zugeschrieben. Denn von Menschen sind sie nicht ausgegangen; etwas unsichtbares kann man sich nicht denken; man sucht also den nächsten besten Klotz oder die nächste beste Figur als Agens, und verehrt dieses Nichts wegen der geheimnissvollen, ihm zugeschriebenen Macht: so entsteht Götzendienst, so entsteht Fetischismus.
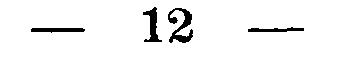
Die Götter lenken die Geschicke der Menschen. Die Götter haben den Menschen geschaffen, und sie werden ihn auch wieder vernichten. Der Mensch kennt eine Anzahl von Gesetzen und Regeln, wonach er sein Erdenleben einrichten soll; wie diese Gesetze entstanden sind, wer sie zuerst erlebt oder erdacht hat, weiss er nicht; was ist natürlicher, als dass er sie als einen Ausfluss des Willens der Götter betrachtet. Die Götter wachen über die Befolgung der von ihnen festgesetzten Regeln; sie werden den Fehlbaren zur Verantwortung ziehen, und ihn ausstossen aus der Gemeinschaft derer, die ihren Geboten gemäss gehandelt haben. Diese werden sie belohnen, jenen werden sie ihren Zorn fühlen lassen.
Durch diese Vorstellungen erhält der Mensch ein neues Motiv, rechtlich, sittlich zu handeln, und zwar ein dreifach mächtiges: sein Gott will es; er belohnt den Guten; er bestraft den Bösen.
Und weitere Entwicklungen knüpfen sich an diese Vorstellungen an.
Die Gemeinschaft der Menschen, welche denselben Gott erkannt haben und anbeten, verbindet sich zu gemeinsamer Verehrung desselben. Als ein wesentlicher Bestandtheil dieser gemeinsamen Verehrung erscheint es, dass die Gemeinschaft darüber wache, dass alle ihre Angehörigen dem Willen des Gottes entsprechend leben. Bis zu einem gewissen Grade übt deshalb die Gemeinschaft geradezu einen direkten Zwang gegen ihre Angehörigen aus auf Befolgung des göttlichen Willens. Oder sie stellt zu den vorhandenen auf Befolgung des göttlichen Willens wirkenden Motiven wenigstens noch ein weiteres auf, indem sie den Fehlbaren mit einer von ihr selbst zu exequierenden Strafe bedroht. Diese Strafe hat einen mannigfach gemischten Charakter: sie wird angedroht und vollzogen von der: Gemeinschaft gewissermassen als Vertreterin der Gottheit, um die widerspenstigen Motive im Willen der einzelnen Genossen zu bändigen; zugleich dient sie zur Entsühnung der Gemeinschaft, deren Angehöriger gefehlt hat; zur Entsühnung dieses Angehörigen selbst; zur Befriedigung des Rachegefühls, das die Genossen oder einzelne
derselben wegen Störung der Ordnung oder ihrer durch diese Ordnung geschützten Interessen empfunden haben; und endlich hat sie als Todesstrafe bisweilen auch noch die Bedeutung, dass der Fehlbare möglichst schnell vor den Richterstuhl seines göttlichen Richters befördert werde.
Ich erinnere hier an die altrömische Strafe der sacratio. Sie ist ursprünglich weiter nichts, als die vorhin erwähnte Ausstossung aus der noch nicht weiter organisierten Menschengemeinschaft. Später verwandelt sie sich in eine von der religiösen Genossenschaft des römischen Volkes zu verhängende Ausstossung. Der Ausgestossene ist alles göttlichen und menschlichen Rechtes baar; er ist nicht nur, weil aus jeglicher Rechtsgemeinschaft ausgeschlossen, ökonomisch ruiniert, sondern als gläubiger Mensch ist er auch geistig vernichtet. Jedermann darf ihn todten; ja nicht nur erlaubt ist es jedermann, ihn zu tödten, sondern geradezu geboten. Die Seelen der geächteten und gebannten Menschen, heisst es, werden den Göttern geschuldet; sie sollen deshalb, von den Körpern befreit, möglichst schnell gen Himmel befördert werden.
Es versteht sich natürlich von selbst, dass der von den religiösen Genossenschaften auszuübende direkte oder indirekte Zwang gegenüber ihren Angehörigen nicht zum Schutz aller Regeln für das menschliche Wollen und Handeln zur Anwendung gebracht wird. Die Beobachtung einer gewissen Anzahl von Regeln erscheint den Genossen als so wesentlich, die Beobachtung dieser Regeln erscheint als von der Gottheit mit solcher Bestimmtheit und Intensität geboten, dass ihre Nichtbeachtung als eine unentschuldbare, als eine schlechte Handlung erscheint. Andere Gebote dagegen erscheinen mehr als gute Rathschläge. Wer diese nicht befolgt, handelt dumm, handelt unzweckmässig, handelt eigenmächtiger, als es sich mit einem ungestörten Zusammenleben mehrerer Menschen verträgt. Nur die erste Classe von Regeln nimmt die Religionsgemeinschaft unter ihren Schutz; den Schutz der anderen überlässt sie der Gottheit, dem Gewissen des Einzelnen und dem Sittenurtheil der Genossen. Die
 Grenze zwischen diesen beiden Classen von Regeln ist aber eine stets
unsichere und fluktuierende.
Grenze zwischen diesen beiden Classen von Regeln ist aber eine stets
unsichere und fluktuierende.
So bildet sich zuerst ein Auseinanderfallen der Regeln für das menschliche Wollen und Handeln in mehrere Classen: einmal Recht, dessen Beobachtung von der äusseren Autorität der Religionsgenossenschaft direkt erzwungen wird; dann Moral, deren Beobachtung die Religionsgenossenschaft selbst höchstens indirekt durch Androhung von Strafen erzwingt, während sie sonst die Wacht über ihre Beobachtung den Göttern, dem Gewissen und dem Sittenurtheil der Genossen überlässt, und endlich Sitten und Gebräuche, deren Verletzung die Götter vielleicht auch ahnden, die aber hauptsächlich nur geschützt werden durch das Gewissen und das Sittenurtheil der Genossen.
Dass das Eingreifen der religiösen Genossenschaft zu Gunsten des Rechtes meistens unterbleibt, wenn der Genosse nur sein äusseres Handeln der Rechtsregel gemäss einrichtet, mag er diess aus rechtlichem oder aus unrechtlichem Motiv thun, das ist keine Folge irgend welcher Eigenthümlichkeit des Rechtes, dem mit äusserlicher Befolgung Genüge geschehen wäre; sondern es hat das ausschliesslich seinen Grund darin, dass es der Genossenschaft unmöglich ist, einen Blick zu thun in das Innere ihrer Glieder.
Innerhalb des Rechtes tritt naturgemäss der Unterschied zwischen Gewohnheitsrecht und Gesetzesrecht hervor. Manche Rechtssätze muss die Religionsgenossenschaft, um sie schützen zu können, zuvor klar formulieren. Diese durch Reflexion gefundenen Rechtssätze bilden das Gesetzesrecht; die anderen, deren Ausbildung ausschliesslich dem nicht reflektierenden Dahinleben der Genossen überlassen wird, bilden das Gewohnheitsrecht.
Ein ähnliches Auseinanderfallen des Gesammtgebietes des Rechtes im höchsten Sinne des Wortes in eine Anzahl Sondergebiete ohne scharf markierte Grenzen, wie es sich nach dem Geschilderten unter dem Einfluss der Religion und der religiösen Organisation der Menschheit vollzieht, findet zum zweiten Mal statt unter dem Einfluss der Entstehung und Entwicklung der Staatsidee.
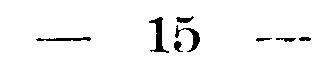
Stellen wir uns ein Rudel Menschen beiderlei Geschlechts vor, die zusammenleben, weil sie von einem gemeinsamen Stammelternpaar abstammen, oder weil sie sich sonstwie zusammengefunden haben. Nicht ein Mann lebt mit einer Frau, nicht ein Mann mit mehreren bestimmten Frauen, nicht eine Frau mit mehreren bestimmten Männern, oder was sich sonst noch für Combinationen denken lassen oder wirklich vorkommen, sondern alle leben ohne Ordnung, ohne Regel zusammen. Das einzige, was sie zusammenhält, ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Trieb der Geselligkeit, wie er sich auch bei in Heerden lebenden Thieren findet; das einzige, wodurch sie ihre Zusammengehörigkeit äusserlich dokumentieren, dass sie in Zeiten der Gefahr, die ihnen durch Naturereignisse, durch wilde Thiere, durch andere Menschen droht, wenn die Kraft des einzelnen zur Abwendung der Gefahr nicht ausreicht, sich zu gemeinsamem, organisiertem Handeln verbinden. Hier sehen wir die Uranfänge des Staates. Diese Uranfänge des Staates sind etwas von der Natur gegebenes, das aber durchaus der überlegten Organisation seitens des Menschen bedarf.
In der grossen Vagheit und Unbestimmtheit des Zweckes, der: bei dieser Organisation verfolgt wird, liegt die Fähigkeit des Staates begründet, immer weitere Gebiete der menschlichen Interessen und Bestrebungen in das Gebiet seiner Organisation hineinzuziehen, ohne deswegen aufzuhören, Staat zu sein. Zur Sorge für die Sicherheit nach aussen kommt die Sorge für die Sicherheit nach innen; und diese Sorge bringt es mit sich, dass der Staat seine Angehörigen zur Beobachtung gewisser Rechtsregeln zwingt, und dass er gewisse Handlungen derselben mit Strafe bedroht. So bildet sich allmählich die Idee aus, dass es auch Aufgabe des Staates sei, über der Beobachtung einer gewissen Anzahl von Rechtsregeln seitens seiner Angehörigen zu wachen, nur dass diese Rechtsregeln grossentheils andere sind, als diejenigen, um deren Beobachtung sich die religiösen Genossenschaften kümmern. Diese sorgen mehr für die Beobachtung derjenigen Regeln, durch deren Verletzungen ein
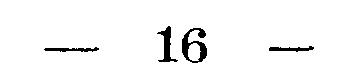 gedeihliches Verhältniss zwischen den Menschen und der Gottheit
gestört werden könnte; jener kümmert sich dagegen mehr um die
Beobachtung derjenigen Regeln, deren Verletzung Unfriede unter den
Menschen zur Folge haben könnte. Aber vielfach sind es doch die
gleichen Rechtsregeln, welche die Religionsgemeinschaft und der
Staat beschützt; und wenn nun gar die Religionsgemeinschaft und
der Staat aus denselben Menschen besteht, so wird der durch die
eine und der durch den anderen zu gewährende Rechtsschutz sehr
nahe zusammenfallen; aber doch sind einmal die Organe, wodurch
die Religionsgemeinschaft den Rechtsschutz ausübt, vielfach verschieden
von den entsprechenden Organen des Staates; und dann ist auch
die Art der Ausübung des Rechtsschutzes seitens der Religionsgenossenschaft
und seitens des Staates gewöhnlich eine verschiedene,
indem die erstere mehr auf das Innere des Menschen zu wirken
versucht, d. h. versucht, ihm neue Motive zum rechtlichen und sittlichen
Handeln zu schaffen, während die Mittel des Staates fast
ausschliesslich in rein äusserlichem Zwang und daneben als motivgebend
höchstens in der Androhung von Strafe bestehen.
gedeihliches Verhältniss zwischen den Menschen und der Gottheit
gestört werden könnte; jener kümmert sich dagegen mehr um die
Beobachtung derjenigen Regeln, deren Verletzung Unfriede unter den
Menschen zur Folge haben könnte. Aber vielfach sind es doch die
gleichen Rechtsregeln, welche die Religionsgemeinschaft und der
Staat beschützt; und wenn nun gar die Religionsgemeinschaft und
der Staat aus denselben Menschen besteht, so wird der durch die
eine und der durch den anderen zu gewährende Rechtsschutz sehr
nahe zusammenfallen; aber doch sind einmal die Organe, wodurch
die Religionsgemeinschaft den Rechtsschutz ausübt, vielfach verschieden
von den entsprechenden Organen des Staates; und dann ist auch
die Art der Ausübung des Rechtsschutzes seitens der Religionsgenossenschaft
und seitens des Staates gewöhnlich eine verschiedene,
indem die erstere mehr auf das Innere des Menschen zu wirken
versucht, d. h. versucht, ihm neue Motive zum rechtlichen und sittlichen
Handeln zu schaffen, während die Mittel des Staates fast
ausschliesslich in rein äusserlichem Zwang und daneben als motivgebend
höchstens in der Androhung von Strafe bestehen.
Es wäre nun aber ein verhängnissvoller Irrthum, wollte man annehmen, der Staat wäre immer dabei stehen geblieben, bloss der inneren Ruhe und Sicherheit zu lieb, den Rechtsschutz zu üben. Die Zwecke des Staates mehren sich in einem fort lawinenartig, und der Staat wächst mit seinen Zwecken. Förderung des materiellen und des geistigen Wohls seiner Angehörigen, die blosse Idee, dass der Mensch rechtlich und sittlich leben solle, sie alle geben ihm neue Motive ab für die Ausbildung und Ausdehnung des Rechtsschutzes. So nimmt der staatliche Rechtsschutz immer grössere Dimensionen an, und bis zu welchem Ziele diese Entwicklung vorwärts gehen wird, ist durchaus noch nicht abzusehen.
So wenig wie der religionsgenossenschaftliche kann sich der staatliche Rechtsschutz auf alle von der den Staat bildenden Menschengemeinschaft anerkannten Regeln für das menschliche Wollen und Handeln beziehen, und auch für diejenigen, auf welche er sich
bezieht, ist er nicht immer der gleiche. Es vollzieht sich hier dieselbe Trennung des Rechtsstoffes, wie wir sie bereits gegenüber der Religionsgemeinschaft kennen gelernt haben. Die Beobachtung mancher Sätze erzwingt der Staat direkt, natürlich nur soweit Zwang menschenmöglich und nicht widersinnig ist: das ist das positive Recht des Staates. Anderer Sätze Beobachtung stellt er nur indirekt dadurch sicher, dass er ihre Nichtbeobachtung mit Strafe bedroht; auch wird die Strafe bisweilen mit dem direkten Zwang auf Befolgung combiniert. Die Strafen und der mannigfachsten Art, je nach der Culturstufe der Völker verschieden, und es werden mit Androhung oder Vollzug dieser Strafen gar vielfache Nebenzwecke verfolgt. Doch muss diess hier ausser Betracht bleiben.
Diejenigen Sätze, deren Beobachtung der Staat nur durch Androhung von Strafe erzwingen will, bilden keinen Theil des positiven Rechtes des Staates; wohl aber sind die Strafandrohungen selbst Theil dieses Rechtes, und es ist gewiss keine Verirrung, sondern nur richtiger Takt der Rechtswissenschaft, wenn sie sich stets nur mit letzteren, nie aber mit ersteren beschäftigt hat.
Gegenüber der Rechtsmasse steht die Masse der Moral und die Masse der Sitten und Gebräuche. Die Grenze zwischen Recht und Moral ist eine stets schwankende. Ein innerer Unterschied zwischen beiden besteht nicht. Zum rechtlichen Leben gehört gerade so wohl das rechtliche Wollen, wie das rechtliche Handeln; nicht anders, als zum sittlichen Leben sittliches Wollen und Handeln gehört. Jede rechtliche Handlung ist auch eine sittliche, und nie kann eine unrechtliche Handlung sittlich oder eine unsittliche Handlung rechtlich sein. Der ganze Unterschied ist der rein äusserliche, dass die Beobachtung der Rechtsnorm ausser von der Rechtsordnung auch noch vom Staat verlangt und erzwungen wird, während die Beobachtung der reinen Sittennorm nur ein Postulat der Rechts- und Sittenordnnng ist, über dessen Erfüllung ausschliesslich das Gewissen des einzelnen Menschen und das Sittenurtheil der Mitmenschen wachen.
Eben aus der inneren Gleichheit zwischen Moral und Recht erklärt sich die Möglichkeit der beständigen Verrückung der Grenzen zwischen beiden, wobei im allgemeinen die Beobachtung zu machen ist, dass neue Grenzregulierungen mit wenigen Ausnahmen das Gebiet des Rechtes auf Kosten der Moral erweitern.
Eine natürliche Folge des staatlichen Rechtsschutzes ist es, dass der Staat dann und wann in die Lage gebracht wird, sich darüber auszusprechen, welcherlei Norm er als Rechtsnorm befolgt wissen wolle. Es wiederholt sich hier wieder die Eintheilung des Rechts in Gewohnheitsrecht und Gesetzesrecht. Naturgemäss ist es, dass, je mannigfacher und verwickelter die Lebensverhältnisse eines Volkes werden, je mehr ganz neue Lebensverhältnisse auftauchen, und je grösser das Gebiet des Staates wird, um so mehr Aussprüche des Staates über das, was er als Recht gehandhabt wissen wolle, nöthig werden. Das Gesetzesrecht wird so sein Gebiet zu Ungunsten des Gewohnheitsrechtes stets erweitern, und diese Entwicklung birgt schwere Gefahren für die ganze Entwicklung des rechtlichen und socialen Lebens des Volkes in sich. Menschlicher Unverstand, wenn nicht schlimmere Dinge, wird hier gar oft Sätze als Rechtssätze aufstellen, die nimmer so genannt zu werden verdienen, und die äussere Macht des Staates wird ihnen als Rechtssätzen Anerkennung erzwingen. Hier kann allerdings scheinbar ein Antagonismus zwischen Recht und Moral zu Stande kommen; aber dieser Antagonismus ist nur ein scheinbarer; nicht Recht und Moral widersprechen sich, sondern es wird nur etwas für Recht ausgegeben, was auf diesen hehren Namen keinen Anspruch hat.
Aber es droht durch die Gesetzgebung dem Rechtsleben noch eine andere grosse Gefahr. Wie das Leben stets flüssig und tausenderlei Veränderungen unterworfen ist, so müssen es auch die Rechtssätze sein, welche dasselbe beherrschen wollen. Das Gewohnheitsrecht entspricht diesem Erforderniss, leidet dafür aber oft an dem Mangel der Unbestimmtheit und Unklarheit. Das Gesetzesrecht dagegen ist steifer und unbeholfener und kann deshalb oft den Lebensbedürfnissen
nicht schnell genug folgen. Einigermassen wird diesem Mangel allerdings dadurch abgeholfen, dass, wenn die Gesetzgebung zu sehr zurückbleibt, neue gewohnheitsrechtliche Normen die alten gesetzlichen Normen verdrängen. Aber wenn durch allzu grosse Gewöhnung des Volkes an gesetzliche Normierung der Verhältnisse die Ader der gewohnheitsrechtlichen Rechtsbildung unterbunden ist; wenn der gemeine Mann sich zu sehr daran gewöhnt hat, den Gesetzgeber für sich denken zu lassen, so verliert auch dieses Auskunftsmittel vieles von seiner Heilkraft, und es ist dann die Gefahr, dass alte, unbrauchbar gewordene Gesetze in Kraft bestehen bleiben und überall hemmend und lähmend wirken, eine sehr grosse. So wenig der Staat das Recht erzeugt hat, so wenig soll er sich zum Hauptfortbildner desselben machen; er soll die Rechtsbildung der Uebung der Leute überlassen, und nur in den dingendsten Nothfällen durch Gesetze eingreifen. Wo er sich aber zur Gesetzgebung genöthigt sieht, soll er sich darauf beschränken, die durch die Gewohnheit erzeugten und approbierten Rechtssätze möglichst rein in seinen Gesetzen wiederzugeben, und durch eigenes Werk nur die in ihnen gegebenen Prinzipien weiter zu entwickeln, Lücken auszufüllen und Widersprüche auszugleichen; thut er mehr, will er ganze Rechtsinstitute aus einem von ihm selbst aufgestellten Prinzip heraus neu construieren, so unternimmt er mehr, als er zu leisten im Stande ist; er handelt wie ein Gärtner, der die Natur rektifizierend die Bäume viereckig schneiden will, und seine Thätigkeit ist von tödtlichem Einfluss auf das ganze rechtliche, staatliche und sociale Leben des Volkes.
Keines Rechtes Entwicklung war, was das Verhältniss von Gesetzes- und Gewohnheitsrecht anbelangt, eine gesundere und naturgemässere als die des römischen Rechtes; und hierin eben ist der Grund zu suchen, warum das römische Recht den römischen Staat so lange überlebt hat und warum es im Stande war, sich den Bedürfnissen ganz anderer Zeiten und Völker, als bei denen es entstanden war, so sehr anzuschmiegen, dass es noch über tausend Jahre
nach dem Untergang des römischen Reiches zu einer neuen Weltherrschaft gelangen konnte, deren Spuren nie ganz verwischt werden werden. Schlecht hat sich hier die Prophetengabe Cicero's bewährt, wenn er in der Rede für den Murena den Werken der römischen Feldherrn, die durch ihre Thaten das Reich vertheidigen und befestigen, einen unbestreitbaren und unermesslichen Vorzug vor den Werken der römischen Juristen vindizieren will. Jene sind elendiglich zu Schanden geworden, diese aber haben alle Zerstörung als ein unverwüstliche Denkmal der Grösse des Geistes des römischen Volkes überdauert.
Von allen Theilen der Geschichte des römischen Rechtes ist wohl keiner geeigneter, als die Geschichte des Obligationenrechts, um an seiner Betrachtung das Wesen des Rechtes kennen zu lernen.
Ein gegebenes Wort zu halten, galt den alten Römern für eine gerade so heilige Pflicht, wie den alten Deutschen. Die Göttin Fides ward öffentlich von Staats wegen und privatim durch Gebete und Opfer verehrt, und mit ihrem Kultus sind besonders die drei Flamines betraut. Hierdurch verwandelte sich die rein moralische Pflicht, Wort zu halten, in eine religiöse Pflicht, die man, ohne sich dem Zorn der Götter und der Verachtung der Menschen auszusetzen, nicht verletzen durfte.
Wenn man eine besonders starke und unverbrüchliche Verpflichtung zu Stande bringen wollte, so verband man mit dem Versprechen eine Anrufung der Götter, worin man ihre Gnade für den Fall des Worthaltens, ihren Zorn für den Fall des Wortbruch herabflehte, und womit man wohl auch symbolische Handlungen zu verbinden pflegte, wie z. B. dass man einen Stein aus der Hand warf und dabei den Jupiter anflehte, er möge für den Fall des Wortbruchs den flehenden — jedoch ohne dass dadurch der Stadt oder der Burg Schaden geschähe — so aus seinem Hauswesen hinauswerfen, wie er jetzt diesen Stein aus seiner Hand werfe. Oder man schlachtete ein Lamm und betete dabei zu Jupiter und den übrigen Göttern, sie möchten den Betenden, wenn er wissentlich sein
Wort breche, gerade so treffen, wie er jetzt dieses Lamm treffe, und was derartige symbolische Handlungen mehr waren. So eingegangene Verpflichtungen galten als besonders heilig und unverletzlich; der Wortbruch ward nicht nur von den Göttern geahndet, sondern auch ihre irdischen Vertreter, die Pontifizes, suchten denjenigen, der sich so verpflichtet hatte, zum Worthalten zu zwingen, in einem weitläufigen und eigenthümlichen Verfahren, dessen spätester Form auch in der unendlich mangelhaften Gestalt; wie sie uns überliefert ist, man noch die Tendenz ansieht, möglichst durch moralische Mittel auf den Willen des Schuldners einzuwirken und erst im äussersten Nothfall zu härteren, die ganze geistige, ökonomische und physische Existenz des Schuldners bedrohenden Mitteln zu schreiten.
Durch den Schutz, welchen die Pontifizes jenen Verpflichtungen angedeihen liessen, verwandelten diese sich in wahre Rechtspflichten im engeren Sinne des Wortes. Es war bei diesen Verpflichtungen üblich, dass der Gläubiger die Verpflichtungsworte componierte und sie dem Schuldner zum Nachsprechen vorsagte. Für gewisse häufig vorkommende Verpflichtungen bildeten sich allmählich stehende Formularien aus, über deren zweckmässigste Composition die Pontifizes wachten. Man nannte eine derartige Verpflichtung im allgemeinen fide promissio; in ihr liegt der eine älteste Kern der späteren stipulatio.
Wie man bei der fidepromissio die Götter zu Zeugen anrief, so konnte man statt ihrer auch die Mitbürger, die Quiriten zu Zeugen anrufen. So wird uns von einer alterthümlichen Eingehungsform von Obligationen berichtet, deren Namen mit unserem deutschen wette, wadia und dem griechischen verwandt ist, dem vadimonium, auch sponsio genannt. Genau ist uns die Form des vadimonium nicht bekannt; soviel aber wissen wir, dass das Geschäft abgeschlossen wurde vor Quiriten als Zeugen; dass ausser dem Hauptschuldner sich noch andere zur grösseren Sicherheit des Gläubigern zu verpflichten pflegten, (sponsores, consponsores, vades, subvades); dass der kurz und bündig concipierte Wortlaut
der Verpflichtung vom Gläubiger dem Schuldner vorgesprochen, und dann von diesem nachgesprochen, oder doch wenigstens mit der Antwort spondeo, ich verpflichte mich, beantwortet wurde: und dass auch noch sonstige Handlungen dabei vorgenommen wurden, die wohl ursprünglich materielle Sicherstellung des Gläubigen durch Pfänder zum Zweck hatten, die aber später zu symbolischen Handlungen herabgesunken oder ganz weggefallen sind.
Ein anderes bekanntes Zeugengeschäft des älteren römischen Rechtes ist das nexum. Das nexum ist ursprünglich ein vor 5 Zeugen abgeschlossener Darleihevertrag, wobei die geliehene Summe dem Schuldner in Erzstücken vor Zeugen zugewogen wurde, und dieser diese Summe, und vielleicht auch noch Zinsen, zu schulden bekannte. Nach Aufkommen des geprägten Geldes hörte man auf, die Summe zuzuwägen; man begnügte sich damit, mit einem Stückchen Erz an die Wage zu schlagen, und dieses Stückchen Erz dann dem Schuldner hinzugeben, der nun die Summe, welche das Stückchen repräsentierte, schulden zu wollen bekannte. Die wahre Zahlung hatte entweder vorher stattgefunden; oder sie fand nachher statt; oder sie fand gar nicht statt, indem der ganze Akt nur vorgenommen wurde, um die Existenz einer irgend wie sonst begründeten Geldschuld des Schuldners an den Gläubiger zu constatieren. So ward das nexum zu einem reinen Formalgeschäft: bloss weil jemand vor 5 Zeugen ein Stückchen Erz, womit an eine von einer weiteren Person gehaltenen Wage geschlagen war, und das eine bestimmte angegebene Summe repräsentieren sollte, angenommen hatte, und dadurch diese Summe zu schulden bekannt hatte, schuldete er diese Summe, ohne dass irgend etwas auf den materiellen Schuldgrund ankam. Es ist diess der Wechsel des alten Roms. Diese und andere vor einer hergebrachten Anzahl von Zeugen eingegangenen Obligationen wurden vom römischen Staate durch einen sehr strengen Schuldprozess, der bis zur physischen und rechtlichen Vernichtung des Schuldners führte, geschützt. Dass aber dieser Staatsschutz nicht uranfänglich gewesen ist, davon hat sich unter anderm eine Spur erhalten in
 der üblichen Mehrzahl der Schuldner beim vadimonium. Schon
die Anwesenheit von Zeugen bei einer Verpflichtung bewirkt, dass
dieselbe nicht leicht gebrochen wird; haben sich nun aber gar mehrere
vor Zeugen verpflichtet, so hat der Gläubiger nicht nur gegen
Insolvenz, sondern namentlich auch gegen Wortbruch um so mehr Garantie.
Mit der Erstarkung des staatlichen Rechtsschutzes schwindet
immer mehr das Bedürfniss nach mehreren Schuldnern; aber selbst
im justinianischen Rechte ist eine Cumulation mehrerer Schuldner
noch viel üblicher als bei uns.
der üblichen Mehrzahl der Schuldner beim vadimonium. Schon
die Anwesenheit von Zeugen bei einer Verpflichtung bewirkt, dass
dieselbe nicht leicht gebrochen wird; haben sich nun aber gar mehrere
vor Zeugen verpflichtet, so hat der Gläubiger nicht nur gegen
Insolvenz, sondern namentlich auch gegen Wortbruch um so mehr Garantie.
Mit der Erstarkung des staatlichen Rechtsschutzes schwindet
immer mehr das Bedürfniss nach mehreren Schuldnern; aber selbst
im justinianischen Rechte ist eine Cumulation mehrerer Schuldner
noch viel üblicher als bei uns.
Allmählich gewöhnte man sich sowohl bei der fidepromissio, wie beim vadimonium daran, das Hauptgewicht darauf zu legen, dass der Gläubiger den Schuldner präcis fragte, und dass der Schuldner congruent antwortete. Alles andere hielt man für Nebensache, die auch wegbleiben könne; und so kamen fidepromissio und vadimonium oder sponsio auf ein und dieselbe Form heraus: die stiputatio, die Steifmachung, die Festmachung, Verabredung. Die Form ist einfach: Frage des Gläubigers: Willst du schulden? Antwort des Schuldners: Ich will schulden. Zeugen zuzuziehen ist zweckmässig, bleibt immer üblich, ist aber nicht absolut nöthig für: die Gültigkeit der stipulatio. Lange dauerte es, bis eine in der abgeschwächten Form der stipulatio eingegangene Obligation, wenn der Schuldner ihre Existenz bestritt, unter den Staatsschutz genommen wurde; zu gleicher Zeit mit ihr ward die litterarum obligatio und das mutuum für klagbar erklärt, d. h. durch gewisse Einträge in Geschäftsbücher begründete Obligationen und das formlose Darlehen.
Das zum Wesen der stipulatio gehörige Minimum von Form ward, allerdings immer mehr abgeblaßt, während der ganzen Dauer des römischen Reichs als unerlässliche Voraussetzung für die Klagbarkeit einer Obligation angesehen. Nur ganz wenige, aber im Verkehr häufig vorkommende Obligationen, wie Kauf und Miethe, hatten sich auch von dieser letzten Spur von Formvorschrift frei gemacht, und waren als formlose Verträge klagbar. Die anderen
 formlosen Verträge hiessen obligationes naturales, moralische Verpflichtungen.
Eine Klage aus ihnen gegen einen widerspenstigen
Schuldner war nicht möglich; aber ganz ohne rechtliche Bedeutung
sind doch auch sie schon in der römischen Kaiserzeit nicht mehr;
erzeugten sie auch keine Klage, so konnten sie doch zur Begründung
einer Compensationseinrede oder dergl. recht wohl benutzt werden.
formlosen Verträge hiessen obligationes naturales, moralische Verpflichtungen.
Eine Klage aus ihnen gegen einen widerspenstigen
Schuldner war nicht möglich; aber ganz ohne rechtliche Bedeutung
sind doch auch sie schon in der römischen Kaiserzeit nicht mehr;
erzeugten sie auch keine Klage, so konnten sie doch zur Begründung
einer Compensationseinrede oder dergl. recht wohl benutzt werden.
Bei uns heutzutag wird regelmässig auf Grund eines jeden formlosen Versprechens von vermögensrechtlichem Inhalt gegen den Schuldner eine Klage gegeben; ja man will diesen Schutz bisweilen sogar auf Versprechen ausdehnen, an deren Erfüllung der Gläubiger nur ein Affektionsinteresse hat.
So sehen wir also hier im Gebiet des Obligationenrechtes das klarste Beispiel vor uns, wie immer mehr Moralsätze sich im Laufe der Zeit in Rechtssätze im engeren Sinne des Wortes verwandeln, wie das Recht immer mehr sein Gebiet auf Kosten der reinen Moral erweitert.
Ausser den Religionsgenossenschaften und dem Staat habe ich
noch andere organisierte menschliche Lebensgemeinschaften genannt,
durch welche sich die Entwicklung des Rechtes und die Ausschälung
des Rechtsbegriffs aus dem weitern Begriff der Sitte vollzieht.
Ich meine hier vor allem die Familie; dann die weiteren Stammesgenossenschaften;
die Gemeinden; endlich sonstige Corporationen irgend
welcher Art. In Rom ist der Einfluss dieser Genossenschaften von
verschwindend geringem Einfluss auf die Rechtsentwicklung gewesen;
und möge es deshalb genügen, diese Faktoren der Rechtsentwicklung
nur .erwähnt zu haben.