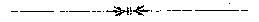ie Zukunft der Schweiz
von
Professor des Bundesstaatsrechts
Buchdruckerei K. J. Wyss Bern, 1902
Separatabdruck aus dem Politischen Jahrbuch der schweiz. Eidgenossenschaft Band XVIGeehrte Angehörige und Freunde der Hochschule Bern
Vielleicht zum letzten Male begrüsst Sie der Rektor in diesen nicht in jedem Sinne ehrwürdigen Räumen, bevor wir eine schönere Heimath der schweizerischen Wissenschaft auf stolzer Höhe im Angesichte der ewigen Firnen beziehen
Als unsere Vorgänger vor ungefähr 200 Jahren in die jetzigen Räume eines ehemaligen Klosters eintraten, sangen sie, wie wir damaligen Berichten entnehmen, den 114. Psalm «Als Israel aus Aegypten zog» Der gleiche Gedanke wenigstens wird uns beseelen, wenn wir aus dem «Klosterhofe» auf die «grosse Schanze übersiedeln, auf der unsere Burg fortan am ganz richtigen Platze steht
«Ein Haus für Ewiges gegründet, Das keine Zeitfluth untergräbt, Daraus, von reiner Hand entzündet Ein täglich Opfer aufwärts strebt.»
Ich will es füglich dem «Rektorat des Auszuges» überlassen, einen Rückblick auf diese zwei Jahrhunderte zu werfen, welche nach und nach in vielen stufenweisen Erhöhungen den geistigen Bau der jetzigen Hochschule erstellt haben, auf den es ja noch mehr ankommt, als auf den materiellen. Ich will dieses Thema nicht vorwegnehmen.
Um so weniger, als ich nach meiner speziellen Beschäftigung dazu neige, in der Hochschule Bern nicht
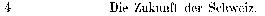 bloss eine Burg des Wissens zu erblicken, sondern die
Haupt- und Centralfestung der schweizerischen
Eidgenossenschaft, auf deren Bau und Erhaltung es
für dieselbe noch mehr ankommt, als auf die Festungen
am Gotthardt und im Wallis, und die auf jeden Fall uneinnehmbar,
und jedem unserem Staate feindlichen Gedanken
unzugänglich gestaltet werden muss.
bloss eine Burg des Wissens zu erblicken, sondern die
Haupt- und Centralfestung der schweizerischen
Eidgenossenschaft, auf deren Bau und Erhaltung es
für dieselbe noch mehr ankommt, als auf die Festungen
am Gotthardt und im Wallis, und die auf jeden Fall uneinnehmbar,
und jedem unserem Staate feindlichen Gedanken
unzugänglich gestaltet werden muss.
Wollen Sie mir es daher gütigst erlauben, dass ich auch an dieser Stelle von der schweizerischen Eidgenossenschaft und ihrer Zukunft spreche.
«Vergangenheit und Zukunft» hätte ich eher gesagt, wenn nicht das Thema dadurch von vorneherein als zu weitläufig charakterisirt für einen kurzen Vortrag erschienen wäre. Wahr aber ist es, dass mehr, als in irgend einem andern europäischen Staat, die Zukunft unseres Gemeinwesens in seiner Vergangenheit begründet und unabänderlich an dieselbe geknüpft ist.
Wir haben fortzusetzen, was Andere gründeten, auszuführen, was sie nur ahnten, zu verstehen, worin sie fehlten, um diese alte Republik unbeschädigt an Geist und Körper der neuen Generation zu überliefern, welche in den jüngern Mitgliedern unserer Versammlung — männlichen und weiblichen ganz gleichmässig — bereit und fähig sein muss sie zu übernehmen.
I.
Ein Prophet eines Volkes, dessen Staatsaufgabe eine gewisse, oft sogar unverkennbare, Aehnlichkeit mit der unsrigen hatte, frägt dasselbe in einem kritischen Zeitpunkte im Namen seines und ihres Herrn:
«Was sollte man doch noch mehr thun an meinem Weinberg, das ich nicht gethan habe an ihm? Warum hat er denn Herlinge gebracht, während ich wartete, dass er Trauben brächte?»
Ist das so, oder ist es nicht so? In dieser Frage liegt, mit Einem Worte ausgedrückt, die Zukunft der Eidgenossenschaft.
Ist es nicht ganz wahr, dass wir, unser jetziges Volk, in dieses herrliche, von Vielen beneidete Land ohne unser Verdienst hineingeboren worden sind;
frei von vornherein von der unendlich schweren Aufgabe, unter der andere Völker seufzen, die politische Unabhängigkeit erst erringen zu müssen;
frei von übergrosser materieller Sorge, in gleichmässigerem Wohlstand aller Klassen. und daher natürlich geneigter zu gegenseitigem Wohlwollen,
frei auch von gesetzlicher Klassenherrschaft unter uns selbst, die ja lange, gerade hier in Bern vorzugsweise. bestand,
frei in unsern religiösen Ueberzeugungen, um deren Selbstbestimmung Jahrhunderte kämpften und anderwärts noch kämpfen;
geachtet vom Ausland, mehr als jemals seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts, und aus bessern Gründen als damals,
und auch besser im Stande auf dieser Achtung mit dem nöthigen Nachdruck bestehen, wenn sie bedroht wird
Das Alles und noch mehr ist uns, die wir jetzt leben, zum weitaus grösseren Theil in den Schoss gefallen, wir haben es nicht erkämpft, oder uns auch nur erheblich darum bemühen müssen. Sind wir nun zufrieden und
dankbar und haben wir alle die Früchte gebracht, die von einer solchen, endlich herbeigekommenen Aera eines fünfzigjährigen ungestörten äusseren und inneren Friedens zu erwarten waren? Das ist die weitere Frage. —
Es ist kaum zu leugnen, dass die Grundstimmung der ganzen Zeit, in der wir leben, das gewissermassen in der Luft liegende Gefühl des Seienden und Kommenden nicht Friede und Glück genannt werden kann, sondern einer Unruhe und Unsicherheit.
Typisch dafür ist der Boerenkrieg, der seit zwei Jahren die Gedanken der gebildeten Nationen vorzugsweise beschäftigt.
Gewaltanwendung gegen ein kleines Volk, das selbstständig bleiben will, um eines behaupteten höheren Kulturzweckes für ein grösseres Ganze willen; allgemeines Zuschauen zu diesem ungleichen, mit Verletzung vieler Regeln der Menschlichkeit und des Völkerrechtes geführten Kriege, unter Missbilligung zwar, Erbitterung sogar stellenweise, aber mit der Faust in der Tasche, aus Sorge und Berechnung für das eigene Wohl
Der Glaube an den Werth und Sieg der Gerechtigkeit auf Erden unsicher geworden; ja der Glaube an Gott selber, der sie schützen muss, wenn er besteht in Millionen, die ihn vorher noch theilweise besassen, tief erschüttert.
Das ist unsere allgemeine Gegenwart Was wird nun die nächste Zukunft sein, die daraus sich folgerichtig ergiebt?
Es scheint im Augenblicke fast unausweichliches politisches Schicksal aller Völker zu sein, dass sie einer Periode der Zusammenschmelzung der bestehenden Staaten zu
wenigen grösseren Gemeinwesen entgegengehen, wobei zwar in der inneren Verwaltung und theilweise auch in der äussern Form den einzelnen bisherigen Staaten noch eine gewisse Selbständigkeit verstattet wird, aber doch nicht mehr die völlige freie Entschliessung. in allen wichtigen Angelegenheiten, welche wir mit dem Namen: der Souveränität bezeichnen.
Vorgearbeitet ist dieser Tendenz der Agglomeration durch die Neigung der heutigen Menschen, die materiellen, oder sog. wirthschaftlichen Fragen für wichtiger anzusehen als die politischen; und durch die vielen, sich noch täglich vermehrenden internationalen Kongresse und Verträge, an denen manche Leute auch bei uns nur die schöne Seite sehen, die aber alle doch einen theilweisen Verzicht auf die Selbständigkeit enthalten, dem man sich, einmal eingegangen, nicht mehr leicht entwinden kann.
Nicht ohne Grund bezeichnet man diese Tendenz der Agglomeration jetzt überall, sogar in dem republikanischen Welttheil Amerika, mit dem Namen des Imperialismus. Es ist in der That genau die Herrschaftsart, welche das römische Kaiserthum vor 2 Jahrtausenden über die civilisirten Völker im Namen der allgemeinen Civilisation oder Humanität ausübte, und die auch unsere Vorfahren in diesem Lande gezwungen waren, in der äussern Form eines Bundes, anzuerkennen
Damals war das Ideal mancher Jetztlebenden auf der Erde vorhanden Ein mächtiges Staatswesen, in welchem ein, oft sehr erleuchteter, einheitlicher Staatswille ohne Widerstand überall hin gebot Eine allgemeine, gleichmässige Civilisation ohne merkliche Standesunterschiede und mit der Möglichkeit für Alle selbst zu den höchsten Stufen des Staates durch die eigene Tüchtigkeit zu gelangen.
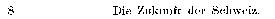 Ein allgemeiner dauerhafter Friede im Innern
des weiten Reiches. der dauerhafteste, der je auf Erden
vorhanden gewesen. ist, welcher allen Künsten und Wissenschaften
ungehinderte Entfaltung gestattete. Eine allgemeine
Rechtsgleichheit mit einem intelligenten Privatrecht
und einer Aufhebung fast aller Rechtsunterschiede,
wenigstens unter den Menschen verbunden, die man als
solche betrachtete.
Ein allgemeiner dauerhafter Friede im Innern
des weiten Reiches. der dauerhafteste, der je auf Erden
vorhanden gewesen. ist, welcher allen Künsten und Wissenschaften
ungehinderte Entfaltung gestattete. Eine allgemeine
Rechtsgleichheit mit einem intelligenten Privatrecht
und einer Aufhebung fast aller Rechtsunterschiede,
wenigstens unter den Menschen verbunden, die man als
solche betrachtete.
Eine allgemeine Religionsfreiheit, welche allen Kulten mit Ausnahme der grob unsittlichen, oder dem Staate direkt oppositionellen, freie Ausübung gestattete, weil man sie alle gleichmässig vom Standpunkte einer Privatangelegenheit. oder demjenigen der blossen Nützlichkeit betrachtete, so wie es heute wieder das Ideal Vieler ist. Eine allgemeine Begeisterung für Kunst und Feste und eine Ausbildung in dieser theatralischen Seite des Lebens, wie sie kaum jetzt wieder ebenso gross besteht Das war damals alles ungefähr zwei Jahrhunderte lang vorhanden; aber was war das Ende dieser grossen Kulturperiode, der räumlich ausgedehntesten und zeitlich am längsten andauernden in der bisherigen Geschichte?
«Gleichwie Kinder, deren Glieder zu sein eingeschnürt worden sind — so sagt uns ein Rhetor aus der letzten Zeit des Classizismus 1) —Pygmäen werden, so ist unser allzu zarter, durch Vorurtheile und Gewohnheiten gefesselter
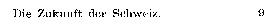 Geist nicht mehr. fähig, die Grösse der Alten erreichen.»
Und ein berühmter Geschichtsschreiber fährt
fort «Diese verkleinerte Natur des Menschengeschlechtes
sank täglich noch mehr unter ihr altes Mass Die römische
Welt war in der That von einer Race Pygmäen bevölkert,
als die gewaltigen Hünen des Nordens einbrachen,
um das zu klein gewordene Geschlecht zu verbessern.
Sie stellten den männlichen Geist der Freiheit wieder
her und diese Freiheit wurde nach zehn Jahrhunderten
neuerdings wieder die Mutter der jetzigen Künste und
Wissenschaften.»
Geist nicht mehr. fähig, die Grösse der Alten erreichen.»
Und ein berühmter Geschichtsschreiber fährt
fort «Diese verkleinerte Natur des Menschengeschlechtes
sank täglich noch mehr unter ihr altes Mass Die römische
Welt war in der That von einer Race Pygmäen bevölkert,
als die gewaltigen Hünen des Nordens einbrachen,
um das zu klein gewordene Geschlecht zu verbessern.
Sie stellten den männlichen Geist der Freiheit wieder
her und diese Freiheit wurde nach zehn Jahrhunderten
neuerdings wieder die Mutter der jetzigen Künste und
Wissenschaften.»
Man erinnert sich unwillkürlich an solche Dinge, wenn man heute das ausschliessliche Interesse grosser Massen nur noch an sog. wirthschaftlichen Fragen, anstatt den politischen, eigentlicher gesagt an Essen und Trinken und alltäglichem Wohlbefinden, und daneben noch an grossen Festspielen und Schaustellungen bemerkt; wenn man den Verfall selbst der Kunst erblickt, die trotz ihrer übergrossen Schätzung dennoch wenig Originelles, das zugleich schön ist, mehr zu erzeugen vermag; wenn man die beständig zunehmende Erholungsbedürftigkeit fast aller Altersstufen, schon der Kinder sogar, nach kurzer Arbeitszeit sieht, oder wenn man, selbst in Bern, kleinen Schulmädchen begegnet, die mit Brillen, oder mit Klavier- und andern Neurosen behaftet sind, —Verhältnisse, die noch in meiner Jugend gänzlich unbekannt in der Schweiz waren
Das sind in allen Völkern Europas Vorzeichen ihrer Zukunft, und man sieht selbst die kräftige Race nicht mehr, welche die sinkenden civilisirten Nationen allfällig wieder aufzufrischen im Stande wäre.
Soweit leben auch wir in der allgemeinen Bewegung der Zeit und ist unsere Zukunft ein Bestandtheil derselben
Für den Augenblick: vielleicht sogar ohne dass wir es ganz zu hindern im Stande sind.
Denn es ist die Methode im Gange der Weltgeschichte, welche wir stets beobachten können, dass jeder, auch einer schlechten, geistigen Strömung Entwicklung gestattet wird, damit sie ausreifen und ihre Früchte aufweisen kann Das Gute aber erhält sich dann vorderhand, bevor das Böse sich wieder einmal ausgelebt und seine wahre Natur ohne Maske gezeigt hat, nicht bloss durch Wissen, d. h. theoretische Ueberzeugung, sondern ebensosehr durch Glauben, d. h. durch Vertrauen auf seine Macht und seinen endlichen Sieg, auch in einer Welt, wie sie jetzt ist und zeitweise immer war
Wenn die Wissenschaft selbst dieses Vertrauen erschüttert, statt es fest zu begründen und nöthigenfalls allein noch aufrecht zu erhalten, dann hat sie einen vergänglichen Charakter und keinen besonderen Werth für den Staat, dessen Schutz sie geniesst.
II
Speziell liegt uns eine Vergleichung durch Rückblick noch näher, Wenn wir auf die Zeit gerade vor hundert Jahren zurücksehen wollen.
Damals ging die schweizerische Eidgenossenschaft nach einem grossartigen, aber vergeblichen Versuche einer Neugestaltung unaufhaltsam der täuschenden Staatsreform entgegen, die auch jetzt wieder völlig an der Tagesordnung ist und die man Protektorat nennt —d. h. vorsichtige, die nationale Empfindlichkeit schonende Eingliederung in ein grösseres wirthschaftliches und nach Aussen gemeinsames
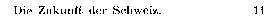 Ganze, welche dabei noch eine gewisse Selbständigkeit
in der Verwaltung, und einen eigenen Staatsnamen
gestattet. 1)
Ganze, welche dabei noch eine gewisse Selbständigkeit
in der Verwaltung, und einen eigenen Staatsnamen
gestattet. 1)
Das war unser politischer Zustand von dem Verfassungsversuch von Malmaison des Jahres 1801 bis zu der grossen Völkererlösung in der Schlacht bei Leipzig von einem neuen Cäsarenthum, welches das alte eine Zeit lang mit Glück zu kopiren versuchte.
Glauben Sie ja nicht, dass damals der schweizerische Volksgeist und die schweizerische Freiheitslust gross genug gewesen wären, sich einer allmähligen, völligen Aufsaugung in einen grössern Staat zu erwehren. Die Bestrebungen aller unserer leitenden Staatsmänner gingen nur dahin, die täuschende Form zu wahren und für unsere Provinz des grossen, centraleuropäischen Reiches, das sich dauernd zu bilden schien, den Titel «Vermittler», nicht geradezu Kaiser», beizubehalten
Aber dieser Vermittler war seit der Geburt seines Sohnes, des sog Königs von Rom, spätem Herzogs von Reichstadt, ein «erblicher» geworden und die Schweiz war eigentlich eine Monarchie, nicht mehr eine Republik. Wenn Ihnen diese glücklicherweise kurze Phase unserer Geschichte neu sein sollte, so lese ich Ihnen nur die Hauptstelle aus der Eröffnungsrede der schweizerischen
Tagsatzung von 1812 durch den Landammann Burkhardt von Basel, also ein offizielles Aktenstück ersten Ranges, gegen das auch keine Stimme in der ganzen Eidgenossenschaft, nicht von ferne, sich erhob.
Der Landammann sagte vom Präsidentenstuhl der Tagsatzung herab:
«So wird der kaiserliche Erbprinz, der König von Rom, seiner Zeit die Gunst des erhabenen Vaters, welcher in der Geschichte alle seine Vorgänger durch Selbstgründung eines grossen Reiches übertrifft, einer seinem Reiche seit den ältesten Zeiten treu ergebenen Nation beibehalten behalten und sich erinnern, dass derselben wiederhergestellte Verfassung, ihre Ruhe und Frieden, das selbsteigene Werk seines erlauchten Vaters gewesen Dieser gebenedeiete König von Rom gehört unserem besten, höchsten Freund, unserem wahren Beschützer zu!
Auch ist er noch überdies ein Abstämmling des österreichischen Kaiserhauses, dessen erbvereinigter Gewogenheit die Schweiz so viele Jahrhunderte hindurch sich zu erfreuen hatte Gebenedeiet sei also von uns dieser grosse König, (ein Kind in den Windeln!) gebenedeiet von der ganzen schweizerischen Nation als ihr erblich verbündeter Vermittler!» . r
Am Schluss seiner Rede versichert dann freilich der Landammann, die schweizerische Nation bestrebe sich immer ihres alten Namens würdig zu sein. das Beispiel der Altvordern höre nie auf vor ihren Augen zu schimmern, der gleiche Geist belebe uns, und unser ganzes Bestreben gehe dahin, diese Gesinnungen unter uns rein zu erhalten; daher sehen wir der Zukunft getrost entgegen.
Die Tagsatzungsgesandten nahmen das alles hin, ich denke als das, was es war, sprachen natürlich in Basel
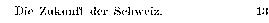 viel von St. Jakob an der Birs, und Schaffhausen betonte
ganz besonders (18 Monate bevor daselbst die Alliirten
unbeanstandet einrückten), es sei jedes Schweizers Pflicht,
den Bund mit dem französischen Kaiserreich fest und unverbrüchlich
zu halten. 1)
viel von St. Jakob an der Birs, und Schaffhausen betonte
ganz besonders (18 Monate bevor daselbst die Alliirten
unbeanstandet einrückten), es sei jedes Schweizers Pflicht,
den Bund mit dem französischen Kaiserreich fest und unverbrüchlich
zu halten. 1)
Der mit Furcht gemischte Respekt vor Gewaltmenschen lag eben damals, wie in dei Renaissancezeit und wie jetzt auch wieder, in der ganzen Zeitrichtung, und die Gebildetsten selbst waren nicht frei davon,
Wir können uns, einigermassen wenigstens, damit trösten, dass damals, im Juli 1812, auch der grösste deutsche Dichter dor Kaiserin von Frankreich in Carlsbad ein Lobgedicht auf ihren Gemahl überreichte, worin es hiess:
«Worüber trüb Jahrhunderte gesonnen, Er übersieht's im hellsten Geisteslicht, Das Kleinliche ist Alles weggeronnen.»
Es schliesst, zu einer Zeit, wo die Armeen ganz Europas bereits nach Russland aufgebrochen waren, und eine Kriegsära ungeheurer Art, ein wahrer Völkerkrieg schon begonnen hatte. mit der Anrede an Vater und Sohn Napoleon:
«Uns sei durch sie das letzte Glück beschieden, Wer Alles wollen kann, will auch den Frieden.»Zum Glück gab es noch einen andern Willen, damals, wie heute, über der Welt, und im gleichen Jahre noch brach dieser Imperialismus zusammen, wie wir auch den
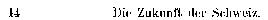 heutigen noch hoffen überall brechen zu sehen. «Ein Staat,
der nicht mehr zu retten ist», wie Goethe an Knobel noch
am 14. August 1812 schreibt, Preussen, erhob sich dennoch
in von diesem grossen Dichter ungeahnter Kraft und «der
Freiheitssinn und die Vaterlandsliebe, die man aus den
Alten zu schöpfen meint und die in den meisten Leuten
zur Fratze wird», wie er ebenfalls am 18. November 1806
nach der Schlacht von Jena geschrieben hatte, war doch
mächtiger als der gewaltigste Militärstaat, den die Welt
seit Rom gesehen hatte.
heutigen noch hoffen überall brechen zu sehen. «Ein Staat,
der nicht mehr zu retten ist», wie Goethe an Knobel noch
am 14. August 1812 schreibt, Preussen, erhob sich dennoch
in von diesem grossen Dichter ungeahnter Kraft und «der
Freiheitssinn und die Vaterlandsliebe, die man aus den
Alten zu schöpfen meint und die in den meisten Leuten
zur Fratze wird», wie er ebenfalls am 18. November 1806
nach der Schlacht von Jena geschrieben hatte, war doch
mächtiger als der gewaltigste Militärstaat, den die Welt
seit Rom gesehen hatte.
Es giebt noch eine unerschütterliche Gerechtigkeit in der Welt, wenn sie auch manchmal etwas spät erscheint, weil sie sich Zeit lassen kann und zuerst menschliche, willige Werkzeuge finden muss. Sie würde rascher wirken, wenn solche immer, wenn auch nur in kleinen Kreisen, vorhanden wären.
III.
Aus der Zeit, die damals für die Schweiz bestand und folgte, finden sich zunächst in einem erst in diesem Jahre von der badischen historischen Kommission publizirten Werke: «Politische Korrespondenz Carl Friedrichs von Baden» einige für uns nicht uninteressante, bisher noch unbekannte Nachweisungen.
Das Regentenhaus Baden suchte sich bei seinem übermächtigen Nachbar, theils durch eine mitunter kaum mehr ganz würdige Nachgiebigkeit in allen Dingen, ähnlich der unsrigen, theils aber mit den Mitteln in Gunst zu erhalten, welche auch noch jetzt kleinen monarchischen Staaten eine gewisse Zuversicht auf ihre Erhaltung verleihen.
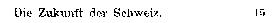 Der Kurfürst Carl Friedrich verlangte nämlich
für seinen Kurprinzen Carl Ludwig Friedrich die Hand
einer Verwandten der Gemahlin Napoleons, die er dann
auch gewissermassen als Preis und Garantie des Rheinbundes
(1806) erhielt. Für diese kaiserliche Adoptiv-Prinzessin 1)
war aber Baden zu klein, und es findet sich
unter diesen Korrespondenzen eine Denkschrift des
badischen Gesandten in Paris, Baron v. Reizenstein, welche
die Schweiz für dieselbe verlangt. Die historische
und politische Begründung dieses Begehrens durch den
badischen Diplomaten ist wunderlich genug.
Der Kurfürst Carl Friedrich verlangte nämlich
für seinen Kurprinzen Carl Ludwig Friedrich die Hand
einer Verwandten der Gemahlin Napoleons, die er dann
auch gewissermassen als Preis und Garantie des Rheinbundes
(1806) erhielt. Für diese kaiserliche Adoptiv-Prinzessin 1)
war aber Baden zu klein, und es findet sich
unter diesen Korrespondenzen eine Denkschrift des
badischen Gesandten in Paris, Baron v. Reizenstein, welche
die Schweiz für dieselbe verlangt. Die historische
und politische Begründung dieses Begehrens durch den
badischen Diplomaten ist wunderlich genug.
Er sagt: «Cette mesure serait en même tems conforme à la justice et à la politique. La Suisse est une de ces possessions, qui dans les tems les plus heureux, c'est à dire il y a six siècles, appartenaient aux ancêtres du Prince electoral, leur titre le plus glorieux c'est d'avoir été les fondateurs de villes dans des siècles de barbarie, davoser fondé entre autres les villes de Berne et de Fribourg, agrandi et fortifié celles de Moudon, Yverdon, Burgdorf et autres. Une politique bienfaisante vient également à l'appui de ce changement. Après tout ce que la Suisse a éprouvé depuis dix ans il est difficile de. se persuader
qu'elle puisse être heureuse et tranquille à moins d'un gouvernement héréditaire, et jamais le gouvernement anglais ne cessera de fonder sur ce pays des espérances de trouble et d'influence au détriment de la France; jamais elle ne cessera d'y entretenir par ses émissaires les factions, aussi longtems que par l'établissement d'un gouvernement pareil la porte ne lui en sera pas fermée sans retour. C'est donc une véritable conquête sur l'Angleterre que la France fera, en procurant la Suisse à une maison, dont le dévouement lui est assuré pour jamais, et qui peut déjà se regarder comme faisant partie de la maison impériale elle-même.» (pag. 603.)
Der französische Minister des Auswärtigen scheint sich gegenüber diesem Plan etwas kühl verhalten zu haben und auch Madame Talleyrand scheint sich mit der Sache, aber eher in ungünstigem Sinne befasst zu haben. Reizenstein schreibt:
Paris. 18 avril 1806.
«Dès que j'avais appris que le duché de Berg était destiné au prince Murat j'avais jeté les yeux sur la Suisse en la demandant sous le titre de «royaume d'Helvétie» dans un mémoire que le Prince Electoral a remis à l'Empereur, quoique plus tard, que je ne l'avais desiré. Thiard en a eu quelque connaissance vague probablement par Mr. Talleyrand, et il a été aussitôt courir chez Dalberg lui en faire la confidence, en disant que nous devions avoir perdu le semis commun pour nous permettre des demandes aussi exorbitantes, et que Mr. de Talleyrand avait dit plusieurs fois: Non, la totalité de la Suisse, c'est trop, c'est impossible. Quel motif pouvait-il avoir alors à parler d'une chose, qui doit rester extrêmement secrète, à une femme sans en communiquer avec moi.» etc.
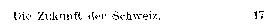
Dagegen scheint die Kurprinzessin, nachmalige Grossherzogin Stephanie von Baden, 1) die erst in unserer Zeit, 1860, starb, nicht ganz ungeneigt gewesen zu sein, unsere, Königin zu werden, denn Reizenstein schreibt am 23. April nach Hause:
«Au reste je dois rendre la justice à la jeune princesse électorale, qu'elle est infiniment plus sensible aux intérêts politiques, que ne l'est son époux. Elle étudie la statistique et les cartes géographiques et elle a déjà dit à l'Empereur, que le pays (Baden) était d'une superbe taille, mais qu'il lui manquait l'embonpoint ..... Elle me dit, alors quelle savait pour sûr que l'Empereur avait, de très grandes vues pour la maison de Bade et qu'il ferait beaucoup pour elle, mais il fallait seulement lui laisser le tems de mûrir ses projets; qu'elle voyait bien qu'il fallait surtout encore avoir Bâle et cette partie de la Suisse, mais que ce serait mieux encore, si on pouvait trouver un autre royaume pour le roi de Wurtemberg et incorporer son pays an notre. Je l'ai beaucoup félicité sur son bon apétit et votre Exc. conviendra sans peine que ce sont de très belles vues pour une jeune personne de 16 ans.» (610.)
Aus der Schweiz hingegen scheinen nicht günstige Nachrichten angelangt zu sein, denn am 7. Mai schreibt Reizenstein aus Paris:
«Quant à la Suisse il (Talleyrand) y prévoit encore de grandes difficultés, non qu'il ne soit pas persuadé, que la France doit désirer cette mesure et qu'elle mériterait une approbation générale, mais il n'est pas sans inquiétude
sur l'opposition qu'on trouverait en Suisse, qui pourrait même aller jusqu'à une guerre civile, et sur le biais qu'il faudra prendre pour préparer cette affaire et la bien conduire.»
Endlich findet sich auch noch in dieser interessanten Korrespondenz, die ein rechtes Bild der damaligen dreisten und schamlosen Diplomatie darbietet, ein Brief Napoleons selbst an seine Adoptivtochter, der der ganzen Sache einen Dämpfer aufgesetzt zu haben scheint. Er sagt in diesem ziemlich kategorischen Billet (pag. 689), das in lauter kurzen abgerissenen Sätzen eher wie ein militärischer Befehl, als wie ein Schreiben an eine junge Dame lautet, über diesen Gegenstand nur:
«Accommodez-vous du pays et trouvez tout bien, car rien n'est plus impertinent que de parler toujours de Paris et des grandeurs qu'on sait qu'on ne peut avoir. C'est le défaut des Français, n'y tombez pas.»
Diese nüchterne, verständige Haltung der Hauptperson, auf die es ankam, machte offenbar auch den Herrn von Reizenstein allmählig etwas bescheidener; er schreibt am 20. Juli 1806, nachdem er sich über Länderschenkungen an andere Bewerber, den Prinzen Murat und den Herzog von Arenberg, als künftigen Gemahl eines Fräuleins Tascher, auch einer Verwandten der Kaiserin, geäussert hat:
«Cependant je ne m'inquiète nullement de ce partage, j'espère au contraire qu'il devra tourner à notre avantage et favoriser nos espérances par rapport à la Suisse; on m'en a encore parlé tout récemment comme d'une chose assez certaine. Loin de prétendre à la totalité de ce pays, n'ayant jamais sérieusement convoité la partie italienne et française, dont la première pourrait très bien être
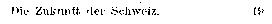 donnée au Prince Borghese, je crois que nous aurons
suffisamment lieu de nous féliciter, si nous parviendrons
à obtenir la Suisse allemande.»
donnée au Prince Borghese, je crois que nous aurons
suffisamment lieu de nous féliciter, si nous parviendrons
à obtenir la Suisse allemande.»
Den Abschluss dieses ganzen Länderschachers bildete der sog. «Rheinbund» und die Auflösung des alten deutschen Reichs, wozu ein patriotisch gesinnter badischer Geheimrath, Brauer, die Bemerkung macht, die «deutschen Fürsten, die an ihrem alten Kaiser die kleinste Machtanmassung nicht dulden konnten, werden nun lernen müssen das Gewicht des Wortes Caesar sich zu vergegenwärtigen.» Der Kurfürst von Baden nahm jetzt den eigentlich auch undeutschen Titel eines Grossherzogs an.
Es ist der jetzigen badischen Regierung sehr zu verdanken, dass sie diese Materialien ihrer geheimen Archive Jedermann zugänglich gemacht hat. Es liegt darin das beste eigene Urtheil über diese vergangenen Zeiten. Die Unbefangenheit, wie sich diese offizielle Publikation auch über die eigenen fürstlichen und diplomatischen Personen ausspricht, und die Offenheit, mit der noch weitere Aufklärungen von daher, wo sie sich noch befinden, gewünscht werden, verdient die höchste Anerkennung.
Ob diese Verhandlungen bei uns mehr oder weniger bekannt gewesen seien, muss dahingestellt bleiben. In den Archiven finden sich solche Spuren unseres Wissens nicht und ebensowenig in unseren bisherigen Darstellungen der Schweizergeschichte.
Immerhin ist bekannt, wie unsere damaligen Staatsmänner im Allgemeinen dachten. Den mächtigen Vermittler nicht zu reizen, sondern wenigstens soweit bei guter Laune zu erhalten, damit er uns, nach einem damaligen
Bonmot, wie Polyphem den Odysseus wenigstens zuletzt fresse, und wo möglich bei einem Zusammensturz dieser in das Kolossale sich ausdehnenden Imperialpolitik noch am Leben zu sein, das war die Summe ihrer Politik und dieses massige Ziel haben sie auch mit vieler Klugheit und Selbstverleugnung am Ende erreicht.
Ebenso, wie dem neuzähringischen «Königreich Helvetien» entgingen wir ohne unser Zuthun ja man darf hier ziemlich sicher sagen, ohne unser Wissen, Projekten, welche in den Jahren 1814/15 auftauchten, und sich vielleicht. leicht etwas mehr als jene, allfällig mit heutigen Ideen decken mögen.
In den Jahren 1813-15, als es sich um die Rekonstruktion des deutschen Bundes handelte, wurden verschiedene Versuche gemacht, demselben die Schweiz und Holland in irgend einer Weise anzugliedern, Plane, die zum Theil auch erst in neuerer Zeit bekannt geworden worden sind. 1).
Ein besonderer Befürworter dieses Projektes war der damalige englisch-hannoveranische Staatsmann Graf Münster, welcher in einer Denkschrift vom 5. Januar 1843 ausführte, dass die Angliederung dieser beiden Länder an den deutschen Bund die Gränzen desselben gegen Frankreich reich decken würde. 2) . .
in einer weitern Aeusserung vom folgenden Jahre (30. März 1814) will er demgemäss den beiden Ländern auch eine Vertretung in dem Direktorium des Bundes einräumen. Der ausgezeichnete preussische Staatsmann Wilhelm von Humboldt hielt hingegen eine solche Annexion, namentlich der Schweiz für unthunlich, da das deutsche Nationalgefühl nicht bloss auf einer Gemeinsamkeit der Sitten, Sprache und Litteratur, sondern vor Allem auf gemeinsam erlebter Geschichte beruhe, wobei es überdies gerathen sei, die Reibungen der grossen Staaten durch dazwischenliegende kleinere zu vermindern.
Dagegen schlägt er im April 1814 folgendes klug ausgedachte System vor:
«Die von den deutschen Staaten völlig verschiedenen Verfassungen dieser beiden Länder gestatten ihnen augenscheinlich nicht, um Bunde eigentlich theilzunehmen. Aber es wäre möglich und äusserst nützlich. Sie durch ewige Allianzverträge mit Deutschland in innigerer und speziellerer Weise zu verbinden, als es die andern europäischen Staaten sein werden».
In Bezug auf Holland wäre ein combinirtes Festungssystem die Hauptsache dabei
«Die Schweiz wird nicht leicht ihr Neutralitätssystem aufgeben, und man konnte es sogar durch den zu schliessenden Vertrag auf ewig sanktioniren, vorausgesetzt, dass sie sich verpflichtet:
a) in jedem Kriegsfall zwischen dem deutschen Bund und Frankreich ihre Gränzen mit einer bestimmten Truppenzahl zu besetzen, um jede Verletzung ihres Gebiets wirksam zu vermeiden;
b) dass sie ein für allemal eine gewisse Truppenzahl in deutschen Sold gebe und verspreche, sie im Kriegsfall zu vermehren.
Da es Hollands beständige Sitte war, fremde Truppen in Sold zu nehmen und die Schweiz solche zu geben, so könnte das erstere Deutschland eine bestimmte Geldsumme für die deutschen Truppen bezahlen, welche einen Theil der Garnisonen der holländischen Festungen bilden würden, und diese selbe Summe konnte Deutschland zur Bezahlung der Schweizertruppen verwenden».
In Hardenberg's definitivem Entwurf der Grundlagen einer deutschen Bundesverfassung nimmt der Gedanke dann (im Art 40) eine unserer Mediationsverfassung ähnliche Gestaltung an, nämlich so «Die vereinigten Niederlande und wo möglich auch die Schweiz sind zu einem beständigen Bündnisse mit dem deutschen Bunde einzuladen».
In den Verhandlungen, welche vom 7.-14 Oktober 1814 zu Wien zwischen Österreich, Preussen und Hannover über diesen Entwurf stattfanden, wurde jedoch dieser Artikel 40 wieder fallen gelassen, und es ging aus allen solchen Projekten schliesslich nur die bekannte europäische Garantie der schweizerischen Neutralität bei Anlass des zweiten Pariser Friedens von 1815 hervor, die wir auch festzuhalten gedenken.
IV.
«Feliciter Helvetia evasit» müsste unter dieses ganze Kapitel der Schweizergeschichte von 1801 bis 1816 geschrieben werden.
Wird das aber stets so sein und welches sind die Mittel, um es zu verhüten, soweit menschliche Kraft und Klugheit reichen. Das ist die Frage, welche die schweizerische Politik sich stets wird stellen müssen.

Darüber gestatten Sie mir noch folgendes zu sagen:
Die Machtverhältnisse Europa's, die Ausdehnung und Stärke unseres Staates im Verhältniss zu anderen, namentlich den benachbarten Staaten, können wir nicht mehr ändern. Es gab eine Zeit, im 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts noch, wo dies möglich gewesen wäre, die Schweiz eine republikanisch organisirte Grossmacht in Europa hätte werden können. Aber nicht mit den damaligen aristokratischen Städten wie Zürich und Bern, welche wohl immer mehr Unterthanen, aber möglichst wenige gleichberechtigte Vollbürger haben wollten, oder den damaligen Landsgemeinde-Kantonen, deren Sinn ebensowenig auf mehr Theilhaber an ihrer demokratischen Freiheit ging. Es hätte ein ganz anderer, modernerer Begriff von Freiheit in der damaligen Eidgenossenschaft leben müssen, um ein grosser Staat zu werden.
Wir sind nun seit der Schlacht von Marignano und dem ewigen Frieden mit Franz I. von Frankreich, und vielleicht noch mehr seit der damit historisch zusammenfallenden Glaubenstrennung darauf angewiesen und dazu berufen, auf immer ein kleiner Staat zu sein.
Ein solcher aber muss heutzutage eine moralische Grösse sein, wenn er fortbestehen will. Darauf kommt Alles an; dafür ist auch die Menschheit noch empfänglich, das weiss sie in seinem eigenthümlichen Werthe zu schätzen, um so mehr, je mehr andere Staaten gerade durch ihre Grösse darüber hinauswachsen und diesen Typus zu verlieren in Gefahr sind.
Die Eidgenossenschaft hat zwei grosse und unvergängliche Leistungen hinter sich, die ihr auf immer ihren Platz inder Geschichte anweisen werden:
Sie hat die Ausführbarkeit der republikanischen Staatsform in Europa bewiesen, die an wahrer Kultur und Sorge für die besten und höchsten Güter des Lebens hinter der Monarchie in keiner ihrer Formen zurücksteht.
Sie hat ferner auf ihrem Boden die, nach unserer Ansicht wenigstens, gelungenste und verständigste Ausgestaltung des beseeligenden christlichen Glaubens in eine äussere kirchliche Gemeinschaft erzeugt, eine Kirche, die ein Muster für andere Länder geworden ist und es vielleicht noch fürderhin wird
Beides hat den gleichen geistigen Untergrund. Was uns vor andern Völkern vortheilhaft auszeichnet und unsere Geschicke vielfach anders bestimmt hat, ist nicht ein grösseres Durchschnittsmass von Talent oder Bildung unseres Volkes, wohl aber ein gewisser. allgemein verbreiteter gesunder Menschenverstand, ein richtiges Urtheil, das sich in einem Masshalten in allen Dingen äussert, welches die Weisheit in das Gemeinverständliche übersetzt ist
Ein drittes Werk der Eidgenossenschaft, das von manchen Schriftstellern mit besonderer Vorliebe angeführt wird, die Vereinigung verschiedener Racen und Sprachen in eine unauflösliche politische Gemeinschaft, schätze ich meinerseits nicht ebenso hoch. Die Eidgenossenschaft würde ein stärkerer Staat sein, wenn sie einsprachig wäre; der «Sprachnationalität» wird ferner oft ein um zu grosses Gewicht beigelegt, wodurch sie kein Element der Kraft wird. Die wahre Nationalität eines Volkes, die allein zu betonen ist, bleibt stets die historisch-politsche das Zusammengewachsensein durch die Geschichte, während das Hinüberschielen über die Gränzen nach Kulturcentren, die jenseits derselben liegen, immer vom Bösen ist.
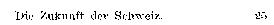
Damit begegnen wir dem ersten Fehler unserer Zeit, vor dem wir uns hüten müssen. Es ist der Seitenblick auf die Macht. Sei es mit Furcht, oder, was öfter noch vorkommt, mit heimlicher Neigung Hierüber sagt uns gerade in diesem Jahre ein deutscher Philosoph der Gegenwart folgendes, ganz zu richtiger Zeit:
«Den Zug in's Grosse zeigt die Politik nicht nur in der Steigerung der Aufgaben und Leistungen der innern Verwaltung, sondern auch im gegenseitigen Verhältniss der Nationen und dem äussern Wachsthum der Staaten. Dieses Wachsthum hatte solange eine natürliche Gränze, als dabei der Zusammenschluss zersplitterter Theile eines einzigen Volkes zu einem gemeinsamen Körper, die nationale Einigung, in Frage stand, wie in Deutschland und Italien. Aber die Bewegung zur Grösse und Macht; geht darüber weit hinaus, seit aus der europäischen Politik eine Weltpolitik geworden ist Nun scheint nur noch der Staat seinen Bürgern die volle Entfaltung und Verwerthung ihrer Kräfte bieten zu können, der seine Macht über den Erdball ausdehnt und seinem Willen an jeder Stelle Geltung verschafft.»
Solche von den Vorstellungen der Macht und Grösse berauschte Denkweise hat keinen Platz für die kleineren Völker und Staaten; das äusserlich Kleine gilt für kleinlich und der Erhaltung unwerth. Ueber jene scheint die Fluth der Weltgeschichte, unbekümmert um ihr Wohl und Wehe, dahinzubrausen, die Zeit ihrer Existenzberechtigung, so meint man, ist vorbei, sie müssen es sich wohl oder übel gefallen lassen, ein Opfer des Expansionsdranges der Grossen zu werden Eine solche Ueberzeugung lähmt, ja ertödtet alle Sympathie mit den Bestrebungen der Kleineren ihre Selbständigkeit zu erhalten. Was könnte
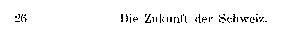 es helfen, dem Rad der Weltgeschichte in die Speichen
zu fallen, wie thöricht wäre es, eine Bewegung anhalten
oder ablenken zu wollen, die sicher und unaufhaltsam
ihrem Ziele zustrebt? ..........
es helfen, dem Rad der Weltgeschichte in die Speichen
zu fallen, wie thöricht wäre es, eine Bewegung anhalten
oder ablenken zu wollen, die sicher und unaufhaltsam
ihrem Ziele zustrebt? ..........
Die Voraussetzungen dieses Gedankenganges mit seinem Fatalismus seien hier dahingestellt. Nur das sei bemerkt, dass das Bild der Zukunft, welches er uns vorhält, sehr trüber Art ist Immer ausschliesslicher würde der Gedanke der Macht die Gemüther einnehmen, immer krasser sich der Egoismus der Nationen gestalten, immer mehr würden die Fragen der innern Kultur vor den Leidenschaften jenes Kampfes zurückweichen; nicht nur äusserlicher, auch ärmer und einförmiger würde bei solcher Wendung das Leben der Menschheit werden. ....
Das alles sind Gefahren, denen widerstanden werden kann und denen widerstanden wird. Wer sie ernst nimmt und grosse Güter bedroht glaubt, der wird jede Unterstützung willkommen heissen, die in diesem Kampf geboten wird. Eine solche Unterstützung verspricht eine selbständige Entwicklung auch der kleineren Völker. Denn dass hier das Interesse an den grossen Weltkämpfen mit ihren Leidenschaften nicht so direkt erregt wird, muss der Ruhe der Betrachtung und der Gerechtigkeit des Urtheils zu Gute kommen; es lässt: sich von hier aus zur Verständigung und Ausgleichung der Gegensätze wirken, auch können hier die allgemeinen und rein menschlichen Probleme mit besonderer Kraft durchlebt und gefördert werden Eine Manigfaltigkeit individueller Bildung wird sich hier eher nebeneinander vertragen, als da, wo alles zu grosser, gemeinsamer Leistung zusammendrängt. Endlich sind Versuche zu Neugestaltungen in günstigerer Lage. als da, wo es ungeheure Massen zu bewegen giebt.
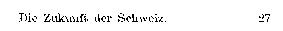
Wie viel freilich von solchen Möglichkeiten zur Wirklichkeit wird, das liegt an den einzelnen Völkern selber: nur eine Verbindung von Anlage und Energie kann sie zu geistigen Individualitäten machen und ihrem Streben einen Werth für das Ganze verleihen. Dass aber in der That auch jetzt noch kleinere Völker eine solche Stellung erreichen und behaupten können, das lehrt die Erfahrung des 19. Jahrhunderts mit unwidersprechlicher Deutlichkeit. Wie liesse sich die innere Geschichte dieses Jahrhunderts verfolgen, ohne der Theilnahme der Schweiz zu gedenken, ohne die zahlreichen Anregungen zu würdigen, die von dorther den verschiedenen Gebieten des Lebens zugegangen sind ohne die gegenseitigen Mittheilungen und Ausgleichungen anzuerkennen, welche dort grössere Nationen gefunden haben. .......
Es war der grösste und klarste Denker der Neuzeit. der das Wort aussprach: «Wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Werth mehr, dass Menschen auf Erden leben! Sollte ein Volk, das mannhaft und auf dem Boden des Gesetzes für sein Recht kämpft, nicht die Achtung und Theilnahme aller derer verdienen, welche mit Kant an den Gütern festhalten, die allein das Leben des Menschen lebenswerth machen?»
Wir wollen diese Anerkennung und Bundesgenossenschaft, die uns von einer deutschen Universität her angeboten wird, mit Dank annehmen 1), nicht selbst nach
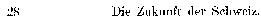 Macht und Grösse streben und sie auch nicht bewundern
und verehren helfen, sondern unsere Eigenart bewahren.
Macht und Grösse streben und sie auch nicht bewundern
und verehren helfen, sondern unsere Eigenart bewahren.
«Höchstes Gut der Erdenkinder ist doch die Persönlichkeit», sagt der vorhin angeführte grosse Dichter, und er hat, selbst wenn das für den einzelnen Menschen nicht unter allen Umständen gelten kann, doch sicherlich Recht für die Völker, die sich nur darin wohlbefinden.
Ein weiterer Zug, den wir vermeiden müssen und der sehr in der Zeit und auch in der Natur unseres Volkes liegt, ist der allzu ökonomische, die ausschliessliche Freude an Erwerb, Besitz und Genuss daraus. Es ist das eine Art Stärke unseres Volkes, aber auch eine Schwäche. Wir sind ein viel ökonomischeres Volk als z. B. unsere Stammverwandten im Reich. Bei uns lebt nicht leicht Jemand über seine Verhältnisse hinaus, sondern legt Jeder zurück, und Leute, die sich durch Lebensmittelzölle vom Staat erhalten lassen und, auf tief verschuldeten Gütern dennoch die grossen Herren spielen, giebt es bei uns keine. Bei uns gilt es noch als ein feststehender Ehrenpunkt keine Schulden zu haben und Niemand seine ökonomische Selbständigkeit danken zu müssen, und ebenso, selbst unter den günstigsten Vermögensverhältnissen zu arbeiten, nicht bloss von der Arbeit, vergangener oder gegenwärtiger, anderer Leute leben zu wollen. Das sind Züge unseres Charakters, auf die wir stolz sind und die wir ungern, durch allzustarke Verbindung mit andern Nationen, an den Gränzen sich verwischen sehen.
Aber dieser gesunde ökonomische Sinn hat auch seine starken Schattenseiten:
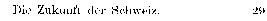
Eine bloss auf Erwerb und Genuss gerichtete sogenannte «bessere Klasse» der Bevölkerung, über der kaum mehr eine andere, wirklich bessere steht; daher eine Taxirung aller Dinge und Menschen nach Geldwerth, wenn auch nur annähernd so, wie sie in Amerika bereits in das Ungeheuerliche ausgewachsen ist.
Als Hauptindustrie des Landes die sogen. Fremdenindustrie, die bloss von dem Vergnügen Anderer lebt und die Schweiz zu einem «Kurgarten Europa's» machen will, während die wirkliche Industrie anfängt über die Gränzen sich zu verlegen, oder nach Zollunionen auszuschauen, die nichts Anderes sind, als ein schwach verhülltes und mit unserer Neutralität in Widerspruch stehendes Protektorat.
In der Politik entweder der Kaufmannsgeist, wie wir ihn in England dermalen in voller Hässlichkeit sehen. oder die sogenannte Sozialpolitik, welche bei uns theilweise auf Nachahmung fremder Parteiverhältnisse beruht. Oder zum mindesten die übermässige Betonung der sogenannten «wirthschaftlichem Fragen» gegenüber den politischen, worüber eine zeitgemässe Betrachtung in einer deutschen Zeitung sagt: .'
«Wenn das 20. Jahrhundert wirklich unter keiner anderen Signatur als der des wirtschaftlichen Ringens stehen würde, dann könnte man allerdings versucht werden, den, die Zeiten der berüchtigten Kabinetskriege noch immer den «guten alten» zuzurechnen. Das wäre der Kampf Aller gegen Alle, in dem gerade das Heissumstrittenste — der Besitz — verloren gehen müsste. Leider kann man sich nicht verhehlen, dass wir auf dieser abschüssigen Ebene schon ein recht hübsches Stück Wegs zurückgelegt haben.»
Daneben natürlich, dem allgemeinen. Zuge der Zeit
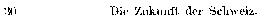 entsprechend, eine zunehmende Neigung das Leben nach
der Summe des Genusses, nicht nach der Summe der
Arbeit zu beurtheilen, die es enthält; daher die Festsucht,
die bereits in das ökonomisch Unmögliche gewachsen
ist, und die jeden Anlass benutzende Schauspielerei, welche
den Sinn für den Ernst des Lebens, auf dem am Ende
doch die geistige Gesundheit eines Volkes beruht, allmählig
zu untergraben droht.
entsprechend, eine zunehmende Neigung das Leben nach
der Summe des Genusses, nicht nach der Summe der
Arbeit zu beurtheilen, die es enthält; daher die Festsucht,
die bereits in das ökonomisch Unmögliche gewachsen
ist, und die jeden Anlass benutzende Schauspielerei, welche
den Sinn für den Ernst des Lebens, auf dem am Ende
doch die geistige Gesundheit eines Volkes beruht, allmählig
zu untergraben droht.
Vieles davon liegt ja, wie bereits gesagt, in dem allgemeinen Zeitgeist in der materialistischen Richtung der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und es ist schwer für ein einzelnes Land, es ganz von sich fernzuhalten.
Anderes liegt in den besondern Verhältnissen der Schweiz, dem industriellen und übervölkerten Land, das mit einer schweren Konkurrenz zu kämpfen hat, der Vertheuerung der allgemeinen Lebensbedürfnisse, dem beständigen Anwachsen der bereits zu gross gewordenen Städte, die kein Glück für irgend ein Land sind.
Die Hauptsache bleibt aber dabei doch immer, dessen seien wir gewiss, die materialistische: oder idealistische Weltanschauung und die Frage, welches die bessere sei Darüber sollte bei uns wenigstens und in den gebildeten Kreisen eines Landes, welche den Ton angeben, kein Zweifel bestehen. 1)
Die Errungenschaften der Techniken und ihrer Wissenschaft, oder der modernen Kunst und des
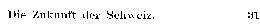 Kunstgewerbes haben. das Leben nicht leichter und fröhlicher
gemacht. Im Gegentheil die heutige Fröhlichkeit
hat etwas Lautes und Erzwungenes, wenigstens mit vielen
äusseren Veranstaltungen nothwendig verbundenes; das
n a t natürliche Gesicht der Zeit ist nicht heiter.
Kunstgewerbes haben. das Leben nicht leichter und fröhlicher
gemacht. Im Gegentheil die heutige Fröhlichkeit
hat etwas Lautes und Erzwungenes, wenigstens mit vielen
äusseren Veranstaltungen nothwendig verbundenes; das
n a t natürliche Gesicht der Zeit ist nicht heiter.
Auch bei der Kunst, die vor Allem das Leben verschönern sollte, und die nun statt dessen mitunter bloss ein Selbstzweck für sich sein will, denken wir jetzt oft an den scharfen Ausspruch von Tolstoi:
«Die Schönheit und die Freude, nur als solche, unabhängig vom Guten betrachtet, sind für einen gesunden Menschen widerlich und für den Staat verderblich.»
Sogar das Christenthum unserer Zeit, das doch dem Idealismus am nächsten stehen und die eigentliche Pflanzschule desselben bilden muss, hat einen unruhigen, agitatorischen Charakter angenommen, und arbeitet auch lieber grossartig und laut, wie um sieh selbst zu überreden, als still, und überzeugt; mit Schuldenmachen, statt mit Opfermuth, und ebenfalls mit Festanlässen ungezählter Art für seine Angehörigen, ohne die sie nicht beisammen zu behalten wären.
Der moderne Götze «Verkehr», der aus den Menschen, statt Bürger eines Landes, nur noch ewig wandernde Kosmopoliten macht, dem die Originalität unserer Städte und die Schönheit unseres Landes allzu rücksichtslos geopfert wird, damit er sie dafür mit noch mehr Lärm und Kohlenstaub erfüllen könne, befriedigt im Grund gar kein Herz und verlangt nur immer neue Opfer.
Dienen endlich will auch bei uns Niemand mehr, sondern womöglich frei sein von allen Banden, sogar
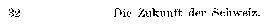 von Welt und Staatsordnung, und wenn er es erreicht,
so fällt er in's Leere, da ihm jeder Halt fehlt. Die natürlichsten
Lebensberufe sind dadurch die schwersten geworden;
eine Hausfrau mit einigen kleinen Kindern hat
aus Mangel an Hülfe ein schwereres und geplagteres
Leben, als eine Dienstmagd, oder eine Fabrikarbeiterin mit
bloss 10 oder 11 stündigem Arbeitstag, oder selbst als eine
Diakonissin, die nicht über ihre Kräfte angestrengt werden
darf, ihre gesicherte Existenz hat, und bei weniger Arbeit
und Sorgen noch im Geruche der Heiligkeit stirbt.
von Welt und Staatsordnung, und wenn er es erreicht,
so fällt er in's Leere, da ihm jeder Halt fehlt. Die natürlichsten
Lebensberufe sind dadurch die schwersten geworden;
eine Hausfrau mit einigen kleinen Kindern hat
aus Mangel an Hülfe ein schwereres und geplagteres
Leben, als eine Dienstmagd, oder eine Fabrikarbeiterin mit
bloss 10 oder 11 stündigem Arbeitstag, oder selbst als eine
Diakonissin, die nicht über ihre Kräfte angestrengt werden
darf, ihre gesicherte Existenz hat, und bei weniger Arbeit
und Sorgen noch im Geruche der Heiligkeit stirbt.
Und wie sieht es in Folge von allem dem mit der eigentlichen Widerstandskraft des Staates gegen die äussern Gefahren aus?
Täuschen wir uns darüber auch nicht ganz. Eine grosse allgemeine Wohlhabenheit, oder vollends der Reichthum eines Landes, macht erfahrungsgemäss sehr leicht vorsichtig, um nicht zu sagen feig. Nur eine gewisse Einfachheit der Lebensweise und relative Armuth erzeugt natürlich-tapfere Leute Der Beweis hiefür steht auf jeder Seite unserer und aller Geschichte. Das hatte die alte Eidgenossenschaft im Jahre 1798 zu erfahren, als sie sich aus langjähriger Gewohnheit des Wohlergehens nicht mehr rechtzeitig entschliessen konnte, der ganz offenbar herannahenden Gefahr in's Auge zu sehen Man denkt jetzt oft unwillkürlich daran, dass der bernische Stadtpfarrer Müslin am Bettags von 1797 predigte: i
«Ein Volk, welches, von der Gewinnsucht besessen, sich reich fühle, müsse untergehen und aus seinen Trümmern ein neues erstehen.»
Mit einer nur um einen Grad noch verfeinerten Generation hätten auch die Boeren ihren Freiheitskrieg nicht
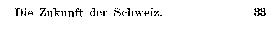 mehr geführt, sondern die Einverleibung in das britische
Weltreich ruhig vorgezogen. 1)
mehr geführt, sondern die Einverleibung in das britische
Weltreich ruhig vorgezogen. 1)
Die Verfeinerung ist also kein Glück, auch für uns. Unter allen Umständen aber müssen die damit verbundenen Laster fort, welche unsere Volkskraft direkt untergraben und unseren Charakter in den Augen der Mitlebenden herabsetzen: die zum öffentlichen Aergerniss gewordenen Spielhäuser, die sehr verbreitete Trunksucht, nebst allen anderem, was dazu gehört, und wenn es nicht gelingt die Behörden für schärfere Massnahmen hiegegen zu erwärmen, so wird das Volk selbst diese Sachen in seine Hand nehmen müssen.
Unser alter Geschichtsschreiber Joh. von Müller sagt von den Ursprüngen unseres Staates:
«Die alten Schweizer waren ein gutes, redliches Volk, am grössten in grossen Gefahren.»
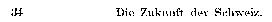
So sollte es allezeit bleiben; es ist die Frage jetzt, ob es so im Grossen und Ganzen noch ist. Das entscheidet die Zukunft der Eidgenossenschaft. Antworten Sie darauf selbst, Jeder für sich im Stillen.
Die I. helvetische Verfassung hatte in einen ihrer Artikel den berühmten Satz aufgenommen: «Die Aufklärung ist dem Wohlstande vorzuziehen». Wir würden das vielleicht heute nicht mehr so ausdrucken, aber der Satz: Die politische Freiheit ist dem Wohlstande vorzuziehen, das ist ein Glaubensartikel, den jeder wahre Eidgenosse unbedingt annehmen muss und an dem sich in einer auch für uns kommenden Prüfung unserer Staatskonsistenz die Geister scheiden werden.
V
Nicht ganz mit Unrecht sagt einer unserer älteren schweizerischen Geschichtskenner, das nähere Studium der Schweizergeschichte hinterlasse eigentlich den Eindruck der Traurigkeit Selten finde man dieses Volk seiner Pflicht und seinem wahren Glücke treu. Immer misskenne oder vergifte es abwechselnd die eigentlichen Quellen seines Lebens, und man könne sich einer gewissen Niedergeschlagenheit bei Abschluss der Betrachtung aller seiner einzelnen Geschichtsperioden oft gar nicht erwehren. 1)
Wir wollen mit ihm darüber nicht rechten, vielleicht hat die Zeit, mit der er sich beschäftigte und in der er schrieb, auch ein wenig auf diese Stimmung eingewirkt
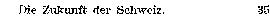
Wahr ist aber, dass wir unserer Aufgabe nicht immer treu gewesen sind und ebenso wahr, dass es manche Leuchte auch heute giebt, die an eine solche Staatsaufgabe eigentlich gar nicht denken und sich jedes politische Geschick gegen ein Entgelt an Wohlstand gefallen liessen.
Dagegen müssen wir jetzt einen kräftigen Widerstand organisiren Nach Aussen nicht bloss durch eine beständige Stärkung unserer Wehrkraft und Aufrechthaltung einer geistigen Verbindung mit allen Tapfern und Guten aller Länder, besonders aller Universitäten, die sie, Gott sei Dank, noch zahlreich besitzen, sondern auch positiver noch durch einen festen Zusammenschluss aller kleinen Staaten behufs Aufrechthaltung eines gesicherten Völkerrechts.
Ferner durch eine scharfe Opposition gegen eine rücksichtslose Zollpolitik der grossen Staaten und gegen die ebenso gefährlichen privaten Zusammenballungen von Kapital zur Vertheuerung aller Lebensbedürfnisse; gegen diese Anarchisten muss so gut wie gegen die andern gemeinsam vorgegangen werden, sie sind sogar die bei weitem gefährlicheren.
Nach Innen muss die Volksseele gesund erhalten werden. Daran fehlt es hauptsächlich. Nicht so viel vielleicht als an andern Orten, aber doch genug, um die Stimmung zu verdüstern.
Das wird aber niemals mit materiellen Mitteln bewirkt; da gehört ein Fonds von gesundem Idealismus dazu, der bei der nüchtern-verständigen Anlage unseres Volkscharakters wohl selten zu weit gehen wird, ohne den aber unser Land und seine politische Freiheit überhaupt
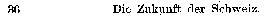 nicht bestehen kann. Auch die «Wissenschaft»
würde ihm das nicht ersetzen können.
nicht bestehen kann. Auch die «Wissenschaft»
würde ihm das nicht ersetzen können.
«We know all things from pole to pole, And glance and nod and bustle by, And never once possess our soul Before we die.»
Und hier wende ich mich nun ganz speziell an die jüngere Generation der anwesenden Versammlung.
Wollen Sie nicht wieder Besitz von dieser Seele in ihrer ganzen Kraft, die möglich ist, ergreifen?
Wollen Sie auch ein Leben des Genusses in der Jugend und dafür des Pessimismus und der Verbitterung im Alter führen (was unmittelbar zusammenhängt), oder schon frühzeitig dem kalten, kritischen Geist anheimfallen, der alles herabsetzt, weil er nichts selber leisten und auch nicht dankbar sein kann. Oder wollen Sie an etwas Grossem mitarbeiten, was das einzige wahre Glück dieser Erde ist?
Des Lebens Ziel ist nicht, die Welt zu geniessen. auch nicht einmal sie wissenschaftlich zu erkennen, sondern aus dieser Erde ein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit und der Liebe zu machen, soweit es jeweilen möglich erscheint, und nur soweit wir daran mitgeholfen haben, soweit hat unser Leben einen Werth gehabt.
Ich möchte auch den Frauen, die hier anwesend sind, sagen: helfen Sie doch auch mit, seien Sie nicht bloss passive Mitbürger und bloss schön, was viel zu wenig geleistet ist. Sie haben ja nach ohne politisches Stimmrecht da&oft angeführte Beispiel der Stauffacherin vor Augen, die ihren Mann erst aufmuntern musste, das Muthige und Rechte zur rechten Stunde zu thun: oder wenn Sie an diese längst. verschollenen Dinge nicht mehr recht glauben wollen,
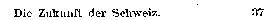 das jetzige grossartige Beispiel der Boerenfrauen, ohne die
der Krieg nicht geführt würde, wie er geführt wird. Helfen
Sie also recht mit zu allem Guten und Grossen in unserem
Lande, nicht bloss zu Theater, Conzerten und Bazaren. Auch
für Sie wird die neue Hochschule gebaut, die der allezeit treffende
Volkswitz ja bereits wegen Ihrer starken Frequenz
die «neue Mädchenschule» genannt hat. Wir wollen das
Wort insoweit acceptiren, als es eine Hoffnung ausdrückt,
dass aus derselben auch ein Geschlecht neuer und tüchtiger
Mädchen neben den wackern Knaben hervorgehen
möge. Beides gehört zusammen zur Erhaltung unseres
Staates. Das weibliche Geschlecht soll seinen Antheil an
dem Bildungsschatze unserer Zeit auch erhalten. Aber
es soll dann auch etwas damit anzufangen wissen.
das jetzige grossartige Beispiel der Boerenfrauen, ohne die
der Krieg nicht geführt würde, wie er geführt wird. Helfen
Sie also recht mit zu allem Guten und Grossen in unserem
Lande, nicht bloss zu Theater, Conzerten und Bazaren. Auch
für Sie wird die neue Hochschule gebaut, die der allezeit treffende
Volkswitz ja bereits wegen Ihrer starken Frequenz
die «neue Mädchenschule» genannt hat. Wir wollen das
Wort insoweit acceptiren, als es eine Hoffnung ausdrückt,
dass aus derselben auch ein Geschlecht neuer und tüchtiger
Mädchen neben den wackern Knaben hervorgehen
möge. Beides gehört zusammen zur Erhaltung unseres
Staates. Das weibliche Geschlecht soll seinen Antheil an
dem Bildungsschatze unserer Zeit auch erhalten. Aber
es soll dann auch etwas damit anzufangen wissen.
Der Idealismus, der uns allein über alle Schwierigkeiten unserer Lage hinweghilft, ist —ich wiederhole es — im Wesentlichen Entschluss einer andern Weltanschauung, die den Werth des Lebens überhaupt nicht in dem Genuss verlegt. Die Kraft dazu kommt durch den Entschluss schon zum Theil, noch mehr aber durch Uebung. Auch dafür ist uns jetzt das Boerenvolk als ein Spiegel und ein Fragezeichen gegeben. Würden wir auch so lange aushalten, oder die Selbständigkeit fahren lassen um den Preis der intensiveren Theilnahme an einer gewissen Civilisation und staatlichen Grösse? Dann wäre unsere ganze Geschichte vielleicht ein grosser Irrthum gewesen; denn das hätten wir schon 1291, 1499 und 1803 mit geringerer Mühe haben können.
Um diesen Entschluss zum Idealismus zu erleichtern und zu leiten, dafür sind in der Schweiz seit dem letzten
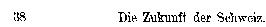 Jahrhundert mehrere Hochschulen geschaffen worden.
Deshalb stellt man sie jetzt auf die Hohen, Angesichts der
ewigen Berge, die auch höhere Gedanken erzeugen sollen,
als bloss an künftiges Auskommen und Berufsthätigkeit,
und daher nennt man solche Schulen überhaupt Hochschulen,
und nicht bloss Berufslehranstalten.
Jahrhundert mehrere Hochschulen geschaffen worden.
Deshalb stellt man sie jetzt auf die Hohen, Angesichts der
ewigen Berge, die auch höhere Gedanken erzeugen sollen,
als bloss an künftiges Auskommen und Berufsthätigkeit,
und daher nennt man solche Schulen überhaupt Hochschulen,
und nicht bloss Berufslehranstalten.
Wie hoffen am meisten auf sie, wenn wir an die nächste Zukunft der Eidgenossenschaft denken.
Es muss bei uns jetzt eine neue Zeit mit neuen Entschlüssen und neuer Kraft dazu kommen.
Und an den schweizerischen Hochschulen muss sie ihren Ursprung und Ausgangspunkt haben. Ein anderes Centrum dafür kennen wir nicht.
Wenn einst das Denkmal Albrecht's von Haller vor der neuen Hochschule steht (möge es bald geschehen), was wird sich der Fremde, der es betrachtet, wohl dabei am ehesten denken? Schwerlich wird er auf seine naturwissenschaftlichen, oder national-ökonomischen Forschungen allein sich besinnen, auch wenn er sie kennt; noch weniger auf seine speziell bernischen Verdienste um eine längst vergangene Staatsform; sondern, wenn er etwas von ihm überhaupt. gelesen hat, so ist es muthmasslich der Vers:
«Sag an Helvetien, du Heldenvaterland, Wie ist dein heutig Volk dem einstigen verwandt?»
Das ist die Frage, die das Denkmal beständig stellen wird an Alle, die an ihm vorbeigehen. Die Antwort muss immer ganz besonders jede Generation von jungen Leuten beiderlei Geschlechts ertheilen, welche die bernische Hochschule in das Leben hinaus schickt Dazu ist sie in
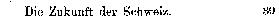 erster Linie und vor allen Dingen gegründet werden und
das verlangt auch das jetzige bernische Volk von ihr
Es will eine starke Generation von führenden
Geistern haben, denen das übrige Volk vertrauensvoll
folgen kann.
erster Linie und vor allen Dingen gegründet werden und
das verlangt auch das jetzige bernische Volk von ihr
Es will eine starke Generation von führenden
Geistern haben, denen das übrige Volk vertrauensvoll
folgen kann.
Unsere jetzt bald absterbende Generation von 1848 hat die Antwort gegeben, so gut sie es vermochte.
Nun ist es an Ihnen, und zwar an allen jüngeren
Angehörigen, Lehrern, Lernenden und Freunden der
Hochschule. Aufwärts aus diesen alten Räumen,
höher hinauf!